
Sign up to save your podcasts
Or


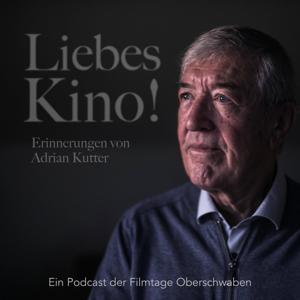

In dieser Episode des Podcasts „Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter“ vertiefen wir uns in die faszinierende und oft kontroverse Geschichte der Filmfreigaben in Deutschland. Moderator Michael Scheyer begleitet Adrian Kutter, einen ausgewiesenen Experten der Kinogeschichte und selbst langjährigen Kinobetreiber, durch einen regen Austausch über die Herausforderungen, die sowohl Finanzierungsproblematiken als auch religiöse Sensibilitäten im Filmgeschäft mit sich bringen.
Wir beginnen mit dem Überraschungsmoment der zwölften Episode, in der die beiden Protagonisten sowohl die Höhepunkte der vorherigen Folgen reflektieren als auch auf die heutige Thematik eingehen – den stillen Feiertag. Hierbei wird deutlich, dass bei der Freigabe von Filmen auch die sozialen und religiösen Kontexte eine entscheidende Rolle spielen. Adrian hebt hervor, dass über 700 Filme für die Vorführung an stillen Feiertagen in Deutschland nicht freigegeben werden – eine Zahl, die sowohl historische als auch aktuelle Dimensionen in die Diskussion beihebt.
Besonders spannend wird es, als Adrian die Liste der Filme durchgeht, die in der Vergangenheit an Feiertagen für nicht geeignet erklärt wurden. Diese Filme reichen von Horror- bis Actionfilmen, doch auch überraschende Titel finden sich darunter, wie Jacques Tatis „Traffic“. Adrian diskutiert die Veränderungen in den Freigabekriterien über die Jahrzehnte und wie die Wahrnehmung von Kunst und Schaffensfreiheit sich gewandelt hat.
Eine weitere zentrale Thematik der Folge sind die gesellschaftlichen Reaktionen auf kontroverse Filme. Anhand von Adrian Kutters eigenen Erfahrungen mit dem Film „Die letzte Versuchung Christi“ von Martin Scorsese schildert er die heftigen Reaktionen, die bei der Aufführung des Films in Deutschland, insbesondere in seiner Region, von verschiedenen religiösen Gemeinschaften und Einzelpersonen angestoßen wurden. Diese Erzählungen sind nicht nur informativ, sondern verdeutlichen auch wie Film als Medium sowohl als Kunstform als auch als gesellschaftliches Werkzeug fungiert, das polarisieren und Debatten entfachen kann.
Adrian erzählt eindringlich von den Drohungen, den massiven Protesten und den Beschwerden, die er als Kinobetreiber erleben musste, als er entschloss, diesen Film zu zeigen. Dabei wird klar, dass es hierbei nicht nur um den Inhalt des Films geht, sondern auch um die zivilgesellschaftlichen Grundlagen der Meinungsfreiheit und der künstlerischen Freiheit im Allgemeinen. Seine unerschütterliche Entschlossenheit, das Publikum mit hochwertigen Filmen zu unterhalten und zu bilden, zeigt sich auch in der Rückschau auf die Filmfestspiele sowie den kulturellen Einfluss, den er über die Jahre hatte.
Die Episode schließt mit einem Aufruf zur Sensibilisierung für süchtig machende Themen in der Film- und Medienwelt, während Adrian und Michael sich auf die nächste Folge freuen, in der weitere spannende Einblicke in die Erinnerungen und die Kinogeschichte von Adrian Kutter gegeben werden. Es ist eine tiefgründige und reflektierte Diskussion, die die Hörer zum Nachdenken anregt und umfassendes Wissen über die Filmfreigabe-Problematik in Deutschland bietet.
 View all episodes
View all episodes


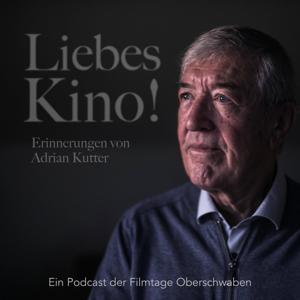 By Adrian Kutter und Michael Scheyer
By Adrian Kutter und Michael Scheyer
In dieser Episode des Podcasts „Liebes Kino, Erinnerungen von Adrian Kutter“ vertiefen wir uns in die faszinierende und oft kontroverse Geschichte der Filmfreigaben in Deutschland. Moderator Michael Scheyer begleitet Adrian Kutter, einen ausgewiesenen Experten der Kinogeschichte und selbst langjährigen Kinobetreiber, durch einen regen Austausch über die Herausforderungen, die sowohl Finanzierungsproblematiken als auch religiöse Sensibilitäten im Filmgeschäft mit sich bringen.
Wir beginnen mit dem Überraschungsmoment der zwölften Episode, in der die beiden Protagonisten sowohl die Höhepunkte der vorherigen Folgen reflektieren als auch auf die heutige Thematik eingehen – den stillen Feiertag. Hierbei wird deutlich, dass bei der Freigabe von Filmen auch die sozialen und religiösen Kontexte eine entscheidende Rolle spielen. Adrian hebt hervor, dass über 700 Filme für die Vorführung an stillen Feiertagen in Deutschland nicht freigegeben werden – eine Zahl, die sowohl historische als auch aktuelle Dimensionen in die Diskussion beihebt.
Besonders spannend wird es, als Adrian die Liste der Filme durchgeht, die in der Vergangenheit an Feiertagen für nicht geeignet erklärt wurden. Diese Filme reichen von Horror- bis Actionfilmen, doch auch überraschende Titel finden sich darunter, wie Jacques Tatis „Traffic“. Adrian diskutiert die Veränderungen in den Freigabekriterien über die Jahrzehnte und wie die Wahrnehmung von Kunst und Schaffensfreiheit sich gewandelt hat.
Eine weitere zentrale Thematik der Folge sind die gesellschaftlichen Reaktionen auf kontroverse Filme. Anhand von Adrian Kutters eigenen Erfahrungen mit dem Film „Die letzte Versuchung Christi“ von Martin Scorsese schildert er die heftigen Reaktionen, die bei der Aufführung des Films in Deutschland, insbesondere in seiner Region, von verschiedenen religiösen Gemeinschaften und Einzelpersonen angestoßen wurden. Diese Erzählungen sind nicht nur informativ, sondern verdeutlichen auch wie Film als Medium sowohl als Kunstform als auch als gesellschaftliches Werkzeug fungiert, das polarisieren und Debatten entfachen kann.
Adrian erzählt eindringlich von den Drohungen, den massiven Protesten und den Beschwerden, die er als Kinobetreiber erleben musste, als er entschloss, diesen Film zu zeigen. Dabei wird klar, dass es hierbei nicht nur um den Inhalt des Films geht, sondern auch um die zivilgesellschaftlichen Grundlagen der Meinungsfreiheit und der künstlerischen Freiheit im Allgemeinen. Seine unerschütterliche Entschlossenheit, das Publikum mit hochwertigen Filmen zu unterhalten und zu bilden, zeigt sich auch in der Rückschau auf die Filmfestspiele sowie den kulturellen Einfluss, den er über die Jahre hatte.
Die Episode schließt mit einem Aufruf zur Sensibilisierung für süchtig machende Themen in der Film- und Medienwelt, während Adrian und Michael sich auf die nächste Folge freuen, in der weitere spannende Einblicke in die Erinnerungen und die Kinogeschichte von Adrian Kutter gegeben werden. Es ist eine tiefgründige und reflektierte Diskussion, die die Hörer zum Nachdenken anregt und umfassendes Wissen über die Filmfreigabe-Problematik in Deutschland bietet.