
Sign up to save your podcasts
Or


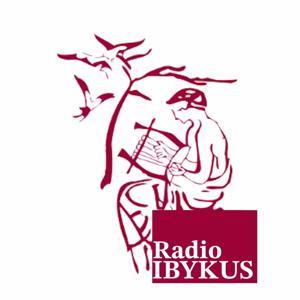

Herzlich willkommen, liebe Freunde klassischer Kunst, zur siebten Ausgabe von Radio IBYKUS, hier auf OS Radio 104,8 und an den Podcasts. An jedem ersten Donnerstag im Monat präsentieren Ihnen mein Kollege und Co-Moderator Siggi Ober-Grefenkämper und ich, Uwe Alschner, Inhalte der Klassik, weil wir überzeugt sind, dass gerade die Besinnung auf und die Beschäftigung mit dem Guten, Schönen und Wahren einen Beitrag zur Bewältigung anstehender Herausforderungen leisten kann und sollte.
In der vergangenen Sendung haben wir Ihnen in diesem Sinne den ersten Teil eines Programms über die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller präsentiert, an den wir heute anknüpfen möchten. Die Jungfrau ist unserer Meinung nach eine bewusste und ausdrückliche Zurückweisung der radikalen Aufklärung, wie sie von Voltaire und nach ihm von Kant und anderen vertreten wurde, die Schiller ablehnte. Und zwar aus gutem Grund, wie wir meinen.
Ganz Menschsein ist das, wonach sich heute viele Menschen sehnen. Doch was bedeutet das? Voltaire und die von ihm geprägte moderne Philosophie haben dem heute vorherrschenden Materialismus, also der Reduktion der Realität, auf das dem Verstand Zugängliche und empirisch Messbare den Weg bereitet. Dies hat dazu geführt, dass heute sogar die Existenz des freien Willens von vermeintlich angesehenen Wissenschaftlern bestritten wird. Schon zu Zeiten Schillers wurde die Liebe als romantische Schwärmerei und Laune abgetan bzw. auf die rein erotische Stimulanz zur Artherhaltung reduziert.
Dem hat Schiller vehement widersprochen und durch sein romantisches Trauerspiel die agapische Liebe, die sich in der Johanna verkörpert als elementares Wesen der Menschlichkeit, hervorgehoben. In der Johanna hatte sich diese Liebe zu den Menschen und zu ihrem Volk zum Leitmotiv ihres Handelns erhoben, was jedoch durch die Verliebung zu Lionel auf dem Schlachtfeld vorübergehend zu einer Krise führte.
Wir setzen unsere Betrachtung daher nun an diesen Punkten fort und werden sehen, wie Schiller diese Krise nützt, um den Punkt zu machen.
— Wie kann Johanna ihrem Auftrag, der sie aus dem stillen Frieden ihres Hirtenidylls gerissen hat, gerecht werden und dennoch inneren Frieden wiederfinden? Man kann diese Frage beantworten, indem man vom Ende des Stücks, wo Johanna mit sich und ihrem Schicksal ausgesöhnt ist, rückwärts auf das Drama schaut und dabei einen kleinen Umweg über Schillers Aufsatz “Über die naive und sentimentalische Dichtung” nimmt – ein Umweg, der sich gewiss lohnt.
Die Ähnlichkeit der letzten Zeilen des Johanna-Dramas mit dem Ende des Gedichts “Das Ideal und das Leben” ist augenfällig.
“Seht ihr den Regenbogen in der Luft?Der Himmel öffnet seine goldnen Tore,Im Chor der Engel steht sie glänzend da,Sie hält den ew’gen Sohn an ihrer Brust,Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen.Wie wird mir – leichte Wolken heben mich –Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.Hinaus –hinauf – Die Erde flieht zurück –Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!”
Am Ende von “Das Ideal und das Leben” wird die Himmelfahrt des Herkules so beschrieben:
“… Bis sein Lauf geendigt ist –Bis der Gott, des irdischen entkleidet,Flammend sich vom Menschen scheidet,Und des Äthers leichte Lüfte trinkt.Froh des neuen ungewohnten SchwebensFließt er aufwärts und des ErdenlebensSchweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.
Des Olympus Harmonien empfangenDen Verklärten in Chronions Saal,Und die Göttin mit den RosenwangenReicht ihm lächelnd den Pokal.”
Als Wilhelm von Humboldt dieses Gedicht von Schiller zugeschickt erhielt, dankte er dem Freund Schiller am 21.8.1795 “für den unbeschreiblich hohen Genuss”, den ihm das Gedicht gegeben habe.
“Es hat mich seit dem Tage, an dem ich es empfing, im eigentlichsten Verstande ganz besessen, ich habe nichts Anderes gelesen, kaum etwas Anderes gedacht… Solch einen Umfang und solch eine Tiefe der Ideen enthält es, und so fruchtbar ist es, woran ich vorzüglich das Gepräge des Genies erkenne, selbst wieder neue Ideen zu wecken… Man muss es erst durch eine gewisse Anstrengung verdienen, es bewundern zu dürfen; zwar wird jeder, der irgend dafür empfänglich ist, auch beim ersten aufmerksamen lesen den Gehalt und die Schönheit jeder Stelle empfinden, aber zugleich drängt sich das Gefühl auf, bei diesem Gedichte nicht anders, als in einer durchaus verstandenen Bewunderung ausruhen zu können.”
Aus Humboldts Worten kann man entnehmen, dass eine umfassende Würdigung dieses einzigartigen Gedichts in wenigen Zeilen nicht zu leisten ist, aber ein wichtiger Aspekt für das Verständnis der Johanna kann skizziert werden. Im Zentrum des Gedichtes stehen vier Strophenpaare, von denen die erste immer mit “wenn” und die Gegenstrophe mit “aber” beginnt. Sie beschreiben, wie der Mensch sein geistiges Wesen behauptet, während er als materielles Wesen handelt, welches Gesellschaft und Geschichte formt und in die Natur eingreift, und als Wesen, das dem Sittengesetz unterworfen ist. Das vierte Strophenpaar, und dieses ist für Johanna Drama besonders wichtig, beschreibt, wie der Mensch sein sinnliches und geistiges Wesen in harmonischen Einklang bringen kann. Wo der Mitmensch leidet, da soll ihn die “Sympathie” für den Mitmenschen so mit Mitleid erfüllen, dass er seine geistige Natur ganz vergisst. Der “heiligen Sympathie” soll “das Unsterbliche” im Menschen “erliegen”. Ja, er soll in seinem Schmerz für den Nächsten sogar “empört” den “Himmel” anklagen.
Wenn der Mensch sich jedoch über sein Schicksal erhoben hat und in der Lage ist, sein Leid als notwendiges Übel einer universalen Ordnung zu sehen, dann ist das Leid zwar nicht verschwunden, aber es rührt ihn nun vor allem der Blick auf die pathetische und erhabene Seelenkraft, mit der dieses Leiden ertragen wird. Deswegen fließen die Mitleidstränen nicht mehr wegen der unmittelbaren Erfahrung der Schrecken und der Qual, sondern wegen "des Geistes tapfrer Gegenwehr"; die Empörung gegen die Ungerechtigkeit des Himmels weicht einer wehmütigen und ruhigen Ergebenheit in das Schicksal. Nur so kann der Mensch sein sinnliches und sein geistiges Wesen aussöhnen, das Leid als des “Erdenlebens schweres Traumbild” ertragen, ohne an seiner göttlichen Bestimmung zu zweifeln. Der Mensch, so beschreibt es Schiller in diesem Gedicht, reicht an die Gottheit heran. Das ist keine Erlösungsverheißung, sondern eine Aufgabe, die sich dem Menschen tagtäglich stellt, und die er mehr oder weniger gut meistern wird.
In einem Brief an Wilhelm Humboldt vom 30.11.1795 schrieb Schiller:
“Ich habe ernstlich im Sinne, da fortzufahren, wo das 'Ideal und das Leben' aufhört…Herkules ist in den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht. Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle sein. Über diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Übertritt des Menschen in den Gott würde diese Idylle handeln... Gelänge mir dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphiert zu haben.”
— Für Schiller als Poeten, der die schöne Kunst weiterentwickeln und voranbringen will, ist die Möglichkeit einer solchen “Idylle” von größter Bedeutung. Weiter unten in dem Brief schreibt er, dass er bereit sei, seine “ganze Kraft aufzubrauchen”, um diesen “Triumph” der “sentimentalischen Poesie über die naive” zu bewerkstelligen. Auch die “schillernde” Verwendung des Begriffs in seiner Schrift “Über naive und sentimentalische Dichtung” ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Diese Schrift ist für ihn besonders wichtig, weil er darin auslotet, wie weit er als moderner Dichter über das hinausgehen kann, was die klassischen Dichter des Altertums geleistet haben. Bezüglich des Begriffs der Idylle geschieht in dieser Schrift etwas sehr Interessantes. Im ersten Teil steht nämlich:
“Die Darstellung des sentimentalischen, d.h. des modernen Dichters wird bezüglich der Empfindungsweise also entweder satirisch, oder sie wird elegisch sein: An eine von diesen beiden Empfindungsarten wird jeder sentimentalische Dichter sich halten.”
Das Idyll sei für den moderneren Dichter nicht realisierbar und nur eine Unterform der Elegie. Nachdem Schiller genauer auf die Satire und die Elegie eingegangen ist, beginnt er den letzten Abschnitt über die Idylle mit den Worten: “Es bleiben mir noch einige Worte über diese dritte Spezies sentimentalischer Dichtung zu sagen übrig”.
Da er bereits zu Beginn des Abschnitts über die Elegie in einer Fußnote “rechtfertigte”, warum er “die Idylle selbst zur elegischen Gattung rechne”, sind nun tatsächlich nur noch einige Worte dazu zu erwarten. Aber ganz im Gegensatz dazu gerät Schiller dieser letzte Abschnitt mehr als doppelt so lang wie beide Abschnitte über Satire und Elegie zusammen genommen. In einer Fußnote zu Beginn gesteht er außerdem plötzlich der Idylle einen gleichwertigen Platz neben Satire und Elegie zu. Er schreibt nun Folgendes:
“Die sentimentalische Dichtung nämlich unterscheidet sich dadurch von der naiven, dass sie den wirklichen Zustand, bei dem die letztere stehen bleibt, auf Ideen bezieht und Ideen auf die Wirklichkeit anwendet.”
Sie hatte es also entweder mit dem “Widerspruch” oder der “Übereinstimmung” des “wirklichen Zustandes mit dem Ideal” zu tun. Daraus folgerte er ursprünglich die Existenz der beiden Gattungen Satire und Elegie – mit deren Unterform Idyll. Nun fährt er fort:
“In dem ersten Fall wird es durch die Kraft des innern Streits, durch die energische Bewegung, in dem andern wird es durch die Harmonie des innern Lebens, durch die energische Ruhe, befriedigt, in dem dritten wechselt Streit mit Harmonie, wechselt Ruhe mit Bewegung. Dieser dreifache Empfindungszustand gibt drei verschiedenen Dichtungsarten die Entstehung, denen die gebrauchten Benennungen Satire, Idylle, Elegie vollkommen entsprechend sind.”
Diese neue Deutung des Begriffs rührt von dem Gedicht “Das Ideal und das Leben” her, welches während der Abfassung des Aufsatzes “Über naive und sentimentalische Dichtung” entstand. Es ließ Schiller die Möglichkeit erkennen , dass auch der moderne Dichter eine Idylle schaffen kann, welche (wie er in dem bereits erwähnten Brief an Humboldt schreibt) “der Begriff eines völlig aufgelösten Kampfes” ist, “einer freien Vereinigung der Neigungen mit dem Gesetz, einer zur höchsten sittlichen Würde hinauf geläuterten Natur.” Die Idylle gilt Schiller von nun an als das höchste Ziel des modernen Dichters.
Kommen wir nach dem kleinen Umweg nun wieder zur Johanna zurück. Wenn man nach der Empfindungsweise fragt, die sich im 5. Aufzug der “Jungfrau von Orleans” zunehmend durchsetzt, so erkennt man, dass Schiller sich immer mehr der Idylle annähert.
Wie in “Das Ideal und das Leben” beschrieben, sehen wir anfangs Johanna aus ihrem Schäferidyll, aus ihrer inneren Harmonie, gerissen. Für sie gilt jetzt, im Leben “zu herrschen und zu schirmen,” wo “Kühnheit sich an Kraft zerschlagen” mag und “sich der Mensch empöre, wenn der Menschheit Leiden euch umfangen.” Aber nach der “Verliebung” mit Lionel, nachdem ihre Zerrissenheit ans Tageslicht gekommen ist und sie sich selbst erkannt hat, sehen wir sie in dem für Schillers neuen Begriff des Idylls charakteristischen Zustand eines völlig aufgelösten inneren Kampfes. Ihr “rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr, keine Träne fließt hier mehr dem Leiden, nur des Geistes tapfrer Gegenwehr,” und “durch der Wehmut düstern Schleier schimmert lieblich der Ruhe heitres Blau.” Nachdem das Gewitter ausgetobt hat, sagt Johanna:
“Doch in der Öde lernt’ ich mich erkennen.Da, als der Ehre Schimmer mich umgab,Da war der Streit in meiner Brust; ich warDie Unglückseligste, da ich der WeltAm meisten zu beneiden schien – Jetzt bin ichGeheilt...In mir ist Friede – Komme, was da will,Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewusst!”
In einem Brief vom 4.4.1801 schrieb Schiller an Goethe in Bezug auf den letzten Akt:
“Er erklärt den ersten, und so beißt sich die Schlange in den Schwanz. Weil die Heldin darin auf sich allein steht… zeigt sich ihre Selbständigkeit.”
Die Jungfrau handelt jetzt als autonomes, freies Wesen und nicht mehr als von einem Geist auf dämonische Weise Getriebene. Im letzten Akt braucht Johanna deshalb das “als lebendiger Geist” agierende Schwert nicht mehr. Sie ist in Gefangenschaft und alles scheint verloren, als ein englischer Soldat ruft “Der König ist gefangen!” Da springt Johanna auf und “in demselben Augenblick stürzt sie sich auf den nächststehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus” in die Schlacht, um deren Wende für die französische Seite herbeizuführen.
Johanna, die von der rauen Wirklichkeit des Krieges aus ihrer Schäferidylle – ihr Arkadien, zu dem sie nie wieder zurückkehren kann – gerissen wurde, hat nun ihr inneres Gleichgewicht wieder erlangt, sie ist nicht nach Arkadien zurückgekehrt, sie ist nun groß und erhaben, sie ist nun in Elysium. In dieser Erhabenheit reißt sie uns Zuschauer mit sich empor, weit über den bitterbösen Nebeldunst des Skeptizismus und der bösartigen Satire.
Dass ihr dieses gelingen konnte, ist nicht selbstverständlich. In dem Fragment “Demetrius” entwickelt Schiller z.B. ein Gegenbild zur Jungfrau, in dem Demetrius zur “tragischen Person” wird, “wenn er durch fremde Leidenschaften… dem Glück und dem Unglück zugeschleudert wird.” Er befreit das Volk nicht vom falschen Zaren, weil er es liebt; deshalb verliert er sein Charisma in dem Augenblick, als er erfährt, dass seine adelige Abstammung ein Betrug ist. Bei der Jungfrau ist das ganz anders. Die Grundlage für ihr Handeln ist nicht nur “der Ruf des Geistes”, sondern die Liebe zu ihrem Volk. Deshalb findet sie die Kraft, in einer Situation, in der sie an sich selbst zweifelt, alle an ihr zweifeln, selbst Raimond, der einzige Mensch, der ihr treu bleibt, sie für eine Hexe hält, mit sich ins Reine zu kommen. Wenn man Johannas Liebe zu den Mitmenschen nicht sieht, dann wird ihr Handeln unerklärlich, denn der “Ruf des Geistes” kann sie aus ihrer “Schuld” nicht erlösen. Wie Demetrius wäre sie tragisch gescheitert.
— Dabei werden viele, wenn nicht alle wunderlichen Dinge des Dramas verständlich, wenn man sie, wie es hier versucht wurde, auf der Grundlage der "Philosophischen Briefe" und Schillers Idee des Idylls in “Über naive und sentimentalische Dichtung” betrachtet.
In der “Jungfrau von Orleans” sind verschiedene Ebenen ineinander verwoben. Obwohl sich Schiller in diesem Drama so weit wie in keinem anderen von der Geschichte entfernt, existiert dennoch “soweit als möglich” die historische Jeanne d’Arc. Mit dem Bezug auf die politische Situation und die Ereignisse zu Schillers Lebzeit gibt es in dem Drama eine weitere historische Ebene. Und dann gibt es die Bezüge zur Literatur und Philosophie. Das ist alles da. Sobald allerdings eine dieser Ebenen überbewertet wird, wird dieses wunderschöne und großartige Werk verkürzt und deformiert. Will man das vermeiden, so bleibt nur der Zugang über den Versuch, Schillers Wirken und Absicht als Künstler zu verstehen, seinen leidenschaftlichen Kampf für eine neue Klassik und die Entwicklung der “schönen Kunst”.
Schiller sagt in seiner Vorrede zu “Die Braut von Messina”, dem Stück, das er unmittelbar nach der “Jungfrau von Orleans” schrieb:
“Es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuss verschafft. Der höchste Genuss aber ist die Freiheit des Gemüts in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte. Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich und in der Tat frei zu machen.”
Kurz bevor er mit der Niederschrift seiner “Jungfrau von Orleans” begann, gelang Schiller das in der Weltliteratur einzigartige Gedicht “Das Ideal und das Leben”. Es ermutigte ihn, an die “Möglichkeit einer solchen Idylle zu glauben” und zu erkennen, dass die Idylle die höchste, aber auch die schwierigste Kunstform ist, welche den “höchsten poetischen Effekt hervorbringen” kann. Mit der “Jungfrau von Orleans” bot sich Schiller der geeignete Stoff für die Vertiefung und Weiterführung dieser schwierigen Aufgabe.
Dieses wurde bereits angesprochen, aber wir wollen es nun abschließen noch eingehender darlegen, d.h. wir wollen betrachten, wieso Friedrich Schiller sein Drama "Die Jungfrau von Orleans" als Idylle verstand, und warum das seiner Meinung nach ein Höhepunkt der poetische Kunst darstellt. Dazu hören wir uns nun das vollständige Gedicht "Das Ideal und das Leben" an, welches in der Ursprünglichen Version den von vielen Lesern missverstanden Titel “Das Reich der Schatten” trug.
Das Ideal und das Leben
Ewigklar und spiegelrein und ebenFließt das zephyrleichte LebenIm Olymp den Seligen dahin.Monde wechseln und Geschlechter fliehen,Ihrer Götterjugend Rosen blühenWandellos im ewigen Ruin.Zwischen Sinnenglück und SeelenfriedenBleibt dem Menschen nur die bange Wahl.Auf der Stirn des hohen UranidenLeuchtet ihr vermählter Strahl.
Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen,Frei sein in des Todes Reichen,Brechet nicht von seines Gartens Frucht.An dem Scheine mag der Blick sich weiden,Des Genusses wandelbare FreudenRächet schleunig der Begierde Flucht.Selbst der Styx, der neunfach sie umwindet,Wehrt die Rückkehr Ceres' Tochter nicht,Nach dem Apfel greift sie und es bindetEwig sie des Orkus Pflicht.
Nur der Körper eignet jenen Mächten,Die das dunkle Schicksal flechten,Aber frei von jeder Zeitgewalt,Die Gespielin seliger NaturenWandelt oben in des Lichtes Fluren,Göttlich unter Göttern, die Gestalt.Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben,Werft die Angst des Irdischen von euch,Fliehet aus dem engen dumpfen LebenIn des Ideales Reich!
Jugendlich, von allen ErdenmalenFrei, in der Vollendung StrahlenSchwebet hier der Menschheit Götterbild,Wie des Lebens schweigende PhantomeGlänzend wandeln an dem styg'schen Strome,Wie sie stand im himmlischen Gefild,Ehe noch zum traur'gen SarkophageDie Unsterbliche herunterstieg.Wenn im Leben noch des Kampfes WaageSchwankt, erscheinet hier der Sieg.
Nicht vom Kampf die Glieder zu entstricken,Den Erschöpften zu erquicken,Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz.Mächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten,Reißt das Leben euch in seine Fluten,Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz.Aber sinkt des Mutes kühner FlügelBei der Schranken peinlichem Gefühl,Dann erblicket von der Schönheit HügelFreudig das erflogne Ziel.
Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen,Kämpfer gegen Kämpfer stürmenAuf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn,Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen,Und mit krachendem Getös die WagenSich vermengen auf bestäubtem Plan.Mut allein kann hier den Dank erringen,Der am Ziel des Hippodromes winkt,Nur der Starke wird das Schicksal zwingen,Wenn der Schwächling untersinkt.
Aber der, von Klippen eingeschlossen,Wild und schäumend sich ergossen,Sanft und eben rinnt des Lebens FlußDurch der Schönheit stille Schattenlande,Und auf seiner Wellen SilberrandeMalt Aurora sich und Hesperus.Aufgelöst in zarter Wechselliebe,In der Anmut freiem Bund vereint,Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe,Und verschwunden ist der Feind.
Wenn das Tote bildend zu beseelen,Mit dem Stoff sich zu vermählenTatenvoll der Genius entbrennt,Da, da spanne sich des Fleißes Nerve,Und beharrlich ringend unterwerfeDer Gedanke sich das Element.Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet,Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born,Nur des Meisels schwerem Schlag erweichetSich des Marmors sprödes Korn.
Aber dringt bis in der Schönheit Sphäre,Und im Staube bleibt die SchwereMit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück.Nicht der Masse qualvoll abgerungen,Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen,Steht das Bild vor dem entzückten Blick.Alle Zweifel, alle Kämpfe schweigenIn des Sieges hoher Sicherheit,Ausgestoßen hat es jeden ZeugenMenschlicher Bedürftigkeit.
Wenn ihr in der Menschheit traur'ger BlößeSteht vor des Gesetzes Größe,Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht,Da erblasse vor der Wahrheit StrahleEure Tugend, vor dem IdealeFliehe mutlos die beschämte Tat.Kein Erschaffner hat dies Ziel erflogen,Über diesen grauenvollen SchlundTrägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen,Und kein Anker findet Grund.
Aber flüchtet aus der Sinne SchrankenIn die Freiheit der Gedanken,Und die Furchterscheinung ist entflohn,Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,Und sie steigt von ihrem Weltenthron.Des Gesetzes strenge Fessel bindetNur den Sklavensinn, der es verschmäht,Mit des Menschen Widerstand verschwindetAuch des Gottes Majestät.
Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen,Wenn Laokoon der SchlangenSich erwehrt mit namenlosem Schmerz,Da empöre sich der Mensch! Es schlageAn des Himmel Wölbung seine Klage,Und zerreiße euer fühlend Herz!Der Natur furchtbare Stimme siege,Und der Freude Wange werde bleich,Und der heil'gen Sympathie erliegeDas Unsterbliche in euch!
Aber in den heitern Regionen,Wo die reinen Formen wohnen,Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr.Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,Keine Träne fließt hier mehr dem Leiden,Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.Lieblich wie der Iris FarbenfeuerAuf der Donnerwolke duft'gem Tau,Schimmert durch der Wehmut düstern SchleierHier der Ruhe heitres Blau.
Tief erniedrigt zu des Feigen KnechteGing in ewigem GefechteEinst Alcid des Lebens schwere Bahn,Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen,Stürzte sich, die Freunde zu befreien,Lebend in des Totenschiffers Kahn.Alle Plagen, alle ErdenlastenWälzt der unversöhnten Göttin ListAuf die will'gen Schultern des Verhaßten,Bis sein Lauf geendigt ist -
Bis der Gott, des Irdischen entkleidet,Flammend sich vom Menschen scheidet,Und des Äthers leichte Lüfte trinkt.Froh des neuen ungewohnten SchwebensFließt er aufwärts und des ErdenlebensSchweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.Des Olympus Harmonien empfangenDen Verklärten in Chronions Saal,Und die Göttin mit den RosenwangenReicht ihm lächelnd den Pokal.”
In einem Brief an Wilhelm von Humboldt vom 20. November 1795 schrieb Friedrich Schiller folgendes über dieses Gedicht:
Rezitator1
“Ich habe ernstlich im Sinne, da fortzufahren, wo das 'Reich der Schatten' (das heißt das gerade gehörte Gedicht 'Das Ideal und das Leben') aufhört, aber darstellend und nicht lehrend. Herkules ist im den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht.
Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle sein. Über diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Übertritt des Menschen in den Gott würde diese Idylle handeln... Gelänge mit dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphiert zu haben...
Denken Sie sich aber den Genuss, lieber Freund, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen – keinen Schatten, keine Schranke, nichts von dem allen mehr zu sehen –, Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diese Aufgabe – wenn ich an die Möglichkeit ihrer Auflösung denke. Eine Szene im Olymp darzustellen, welcher höchste aller Genüsse!”
— Schiller hat diese Idee nicht in einem Gedicht verwirklichen können, aber in seinem Drama Johanna gelingt ihm dieses. Jeder einfühlsame Zuschauer wird das erkennen, wenn er die befreiende Schlussszene der “Johanna” erlebt und auf sich wirken lässt, sie gibt eine Vorahnung des “Übertrittes des Menschen in den Gott”, eine poetische Darstellung, die “alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen – keinen Schatten, keine Schranke”.
Und so stellt sich heraus, dass gerade das, was bisweilen als “romantisch” oder “opernhafter Schluss” des Dramas abwertend gesehen wird, für unsere heutige Zeit besonders aktuell ist, nämlich das Bild des Menschen als transzendentes Wesen, welches nicht durch kybernetische Prozessoren verbessert oder ersetzt werden kann.
Damit sind wir am Ende unseres Programms über Schillers Jungfrau von Orléans. Wir, Siggi Ober-Grefenkämper und ich, Uwe Alschner, bedanken uns bei Ralf Schauerhammer und dem Verein Dichterpflänzchen e.V. für die Möglichkeit, diese Produktion ins Radio bringen zu können. Herr Schauerhammer hat zudem erneut einen Part als Rezitator übernommen.
Sie hörten Beethovens Trio Nummer 4 für Klavier, Violine und Cello, Op. 11, in einer Aufnahme des Schiller-Instituts New York. Wir danken Ihnen, liebe Freunde von Radio IBYKUS, für Ihr Interesse. Danken möchten wir auch ganz besonders unserem Kollegen Frank Paul für die technische Leitung sowie den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes.
Wir kommen wieder mit der achten Ausgabe von Radio IBYKUS am Donnerstag, den 7. August, wieder hier auf OS Radio 104,8 um 18.03 Uhr nach den Nachrichten. Bis dahin empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden alle Ausgaben von Radio IBYKUS auf der Seite ganzmenschsein.substack.com und überall dort, wo Sie Podcasts hören und nach Radio IBYKUS suchen.
Bitte bewerten Sie und kommentieren Sie dort, denn das stimmt den Algorithmus gnädig und hilft anderen, unsere Sendung schneller zu finden. Vielen Dank.
Ganz Mensch sein ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Posts zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, ziehen Sie in Betracht, ein Free- oder Paid-Abonnent zu werden.
 View all episodes
View all episodes


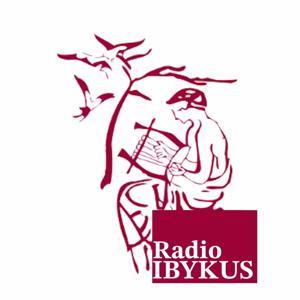 By Uwe Alschner und Siggi Ober-Grefenkämper
By Uwe Alschner und Siggi Ober-Grefenkämper
Herzlich willkommen, liebe Freunde klassischer Kunst, zur siebten Ausgabe von Radio IBYKUS, hier auf OS Radio 104,8 und an den Podcasts. An jedem ersten Donnerstag im Monat präsentieren Ihnen mein Kollege und Co-Moderator Siggi Ober-Grefenkämper und ich, Uwe Alschner, Inhalte der Klassik, weil wir überzeugt sind, dass gerade die Besinnung auf und die Beschäftigung mit dem Guten, Schönen und Wahren einen Beitrag zur Bewältigung anstehender Herausforderungen leisten kann und sollte.
In der vergangenen Sendung haben wir Ihnen in diesem Sinne den ersten Teil eines Programms über die Jungfrau von Orléans von Friedrich Schiller präsentiert, an den wir heute anknüpfen möchten. Die Jungfrau ist unserer Meinung nach eine bewusste und ausdrückliche Zurückweisung der radikalen Aufklärung, wie sie von Voltaire und nach ihm von Kant und anderen vertreten wurde, die Schiller ablehnte. Und zwar aus gutem Grund, wie wir meinen.
Ganz Menschsein ist das, wonach sich heute viele Menschen sehnen. Doch was bedeutet das? Voltaire und die von ihm geprägte moderne Philosophie haben dem heute vorherrschenden Materialismus, also der Reduktion der Realität, auf das dem Verstand Zugängliche und empirisch Messbare den Weg bereitet. Dies hat dazu geführt, dass heute sogar die Existenz des freien Willens von vermeintlich angesehenen Wissenschaftlern bestritten wird. Schon zu Zeiten Schillers wurde die Liebe als romantische Schwärmerei und Laune abgetan bzw. auf die rein erotische Stimulanz zur Artherhaltung reduziert.
Dem hat Schiller vehement widersprochen und durch sein romantisches Trauerspiel die agapische Liebe, die sich in der Johanna verkörpert als elementares Wesen der Menschlichkeit, hervorgehoben. In der Johanna hatte sich diese Liebe zu den Menschen und zu ihrem Volk zum Leitmotiv ihres Handelns erhoben, was jedoch durch die Verliebung zu Lionel auf dem Schlachtfeld vorübergehend zu einer Krise führte.
Wir setzen unsere Betrachtung daher nun an diesen Punkten fort und werden sehen, wie Schiller diese Krise nützt, um den Punkt zu machen.
— Wie kann Johanna ihrem Auftrag, der sie aus dem stillen Frieden ihres Hirtenidylls gerissen hat, gerecht werden und dennoch inneren Frieden wiederfinden? Man kann diese Frage beantworten, indem man vom Ende des Stücks, wo Johanna mit sich und ihrem Schicksal ausgesöhnt ist, rückwärts auf das Drama schaut und dabei einen kleinen Umweg über Schillers Aufsatz “Über die naive und sentimentalische Dichtung” nimmt – ein Umweg, der sich gewiss lohnt.
Die Ähnlichkeit der letzten Zeilen des Johanna-Dramas mit dem Ende des Gedichts “Das Ideal und das Leben” ist augenfällig.
“Seht ihr den Regenbogen in der Luft?Der Himmel öffnet seine goldnen Tore,Im Chor der Engel steht sie glänzend da,Sie hält den ew’gen Sohn an ihrer Brust,Die Arme streckt sie lächelnd mir entgegen.Wie wird mir – leichte Wolken heben mich –Der schwere Panzer wird zum Flügelkleide.Hinaus –hinauf – Die Erde flieht zurück –Kurz ist der Schmerz, und ewig ist die Freude!”
Am Ende von “Das Ideal und das Leben” wird die Himmelfahrt des Herkules so beschrieben:
“… Bis sein Lauf geendigt ist –Bis der Gott, des irdischen entkleidet,Flammend sich vom Menschen scheidet,Und des Äthers leichte Lüfte trinkt.Froh des neuen ungewohnten SchwebensFließt er aufwärts und des ErdenlebensSchweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.
Des Olympus Harmonien empfangenDen Verklärten in Chronions Saal,Und die Göttin mit den RosenwangenReicht ihm lächelnd den Pokal.”
Als Wilhelm von Humboldt dieses Gedicht von Schiller zugeschickt erhielt, dankte er dem Freund Schiller am 21.8.1795 “für den unbeschreiblich hohen Genuss”, den ihm das Gedicht gegeben habe.
“Es hat mich seit dem Tage, an dem ich es empfing, im eigentlichsten Verstande ganz besessen, ich habe nichts Anderes gelesen, kaum etwas Anderes gedacht… Solch einen Umfang und solch eine Tiefe der Ideen enthält es, und so fruchtbar ist es, woran ich vorzüglich das Gepräge des Genies erkenne, selbst wieder neue Ideen zu wecken… Man muss es erst durch eine gewisse Anstrengung verdienen, es bewundern zu dürfen; zwar wird jeder, der irgend dafür empfänglich ist, auch beim ersten aufmerksamen lesen den Gehalt und die Schönheit jeder Stelle empfinden, aber zugleich drängt sich das Gefühl auf, bei diesem Gedichte nicht anders, als in einer durchaus verstandenen Bewunderung ausruhen zu können.”
Aus Humboldts Worten kann man entnehmen, dass eine umfassende Würdigung dieses einzigartigen Gedichts in wenigen Zeilen nicht zu leisten ist, aber ein wichtiger Aspekt für das Verständnis der Johanna kann skizziert werden. Im Zentrum des Gedichtes stehen vier Strophenpaare, von denen die erste immer mit “wenn” und die Gegenstrophe mit “aber” beginnt. Sie beschreiben, wie der Mensch sein geistiges Wesen behauptet, während er als materielles Wesen handelt, welches Gesellschaft und Geschichte formt und in die Natur eingreift, und als Wesen, das dem Sittengesetz unterworfen ist. Das vierte Strophenpaar, und dieses ist für Johanna Drama besonders wichtig, beschreibt, wie der Mensch sein sinnliches und geistiges Wesen in harmonischen Einklang bringen kann. Wo der Mitmensch leidet, da soll ihn die “Sympathie” für den Mitmenschen so mit Mitleid erfüllen, dass er seine geistige Natur ganz vergisst. Der “heiligen Sympathie” soll “das Unsterbliche” im Menschen “erliegen”. Ja, er soll in seinem Schmerz für den Nächsten sogar “empört” den “Himmel” anklagen.
Wenn der Mensch sich jedoch über sein Schicksal erhoben hat und in der Lage ist, sein Leid als notwendiges Übel einer universalen Ordnung zu sehen, dann ist das Leid zwar nicht verschwunden, aber es rührt ihn nun vor allem der Blick auf die pathetische und erhabene Seelenkraft, mit der dieses Leiden ertragen wird. Deswegen fließen die Mitleidstränen nicht mehr wegen der unmittelbaren Erfahrung der Schrecken und der Qual, sondern wegen "des Geistes tapfrer Gegenwehr"; die Empörung gegen die Ungerechtigkeit des Himmels weicht einer wehmütigen und ruhigen Ergebenheit in das Schicksal. Nur so kann der Mensch sein sinnliches und sein geistiges Wesen aussöhnen, das Leid als des “Erdenlebens schweres Traumbild” ertragen, ohne an seiner göttlichen Bestimmung zu zweifeln. Der Mensch, so beschreibt es Schiller in diesem Gedicht, reicht an die Gottheit heran. Das ist keine Erlösungsverheißung, sondern eine Aufgabe, die sich dem Menschen tagtäglich stellt, und die er mehr oder weniger gut meistern wird.
In einem Brief an Wilhelm Humboldt vom 30.11.1795 schrieb Schiller:
“Ich habe ernstlich im Sinne, da fortzufahren, wo das 'Ideal und das Leben' aufhört…Herkules ist in den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht. Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle sein. Über diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Übertritt des Menschen in den Gott würde diese Idylle handeln... Gelänge mir dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphiert zu haben.”
— Für Schiller als Poeten, der die schöne Kunst weiterentwickeln und voranbringen will, ist die Möglichkeit einer solchen “Idylle” von größter Bedeutung. Weiter unten in dem Brief schreibt er, dass er bereit sei, seine “ganze Kraft aufzubrauchen”, um diesen “Triumph” der “sentimentalischen Poesie über die naive” zu bewerkstelligen. Auch die “schillernde” Verwendung des Begriffs in seiner Schrift “Über naive und sentimentalische Dichtung” ist in diesem Zusammenhang zu sehen. Diese Schrift ist für ihn besonders wichtig, weil er darin auslotet, wie weit er als moderner Dichter über das hinausgehen kann, was die klassischen Dichter des Altertums geleistet haben. Bezüglich des Begriffs der Idylle geschieht in dieser Schrift etwas sehr Interessantes. Im ersten Teil steht nämlich:
“Die Darstellung des sentimentalischen, d.h. des modernen Dichters wird bezüglich der Empfindungsweise also entweder satirisch, oder sie wird elegisch sein: An eine von diesen beiden Empfindungsarten wird jeder sentimentalische Dichter sich halten.”
Das Idyll sei für den moderneren Dichter nicht realisierbar und nur eine Unterform der Elegie. Nachdem Schiller genauer auf die Satire und die Elegie eingegangen ist, beginnt er den letzten Abschnitt über die Idylle mit den Worten: “Es bleiben mir noch einige Worte über diese dritte Spezies sentimentalischer Dichtung zu sagen übrig”.
Da er bereits zu Beginn des Abschnitts über die Elegie in einer Fußnote “rechtfertigte”, warum er “die Idylle selbst zur elegischen Gattung rechne”, sind nun tatsächlich nur noch einige Worte dazu zu erwarten. Aber ganz im Gegensatz dazu gerät Schiller dieser letzte Abschnitt mehr als doppelt so lang wie beide Abschnitte über Satire und Elegie zusammen genommen. In einer Fußnote zu Beginn gesteht er außerdem plötzlich der Idylle einen gleichwertigen Platz neben Satire und Elegie zu. Er schreibt nun Folgendes:
“Die sentimentalische Dichtung nämlich unterscheidet sich dadurch von der naiven, dass sie den wirklichen Zustand, bei dem die letztere stehen bleibt, auf Ideen bezieht und Ideen auf die Wirklichkeit anwendet.”
Sie hatte es also entweder mit dem “Widerspruch” oder der “Übereinstimmung” des “wirklichen Zustandes mit dem Ideal” zu tun. Daraus folgerte er ursprünglich die Existenz der beiden Gattungen Satire und Elegie – mit deren Unterform Idyll. Nun fährt er fort:
“In dem ersten Fall wird es durch die Kraft des innern Streits, durch die energische Bewegung, in dem andern wird es durch die Harmonie des innern Lebens, durch die energische Ruhe, befriedigt, in dem dritten wechselt Streit mit Harmonie, wechselt Ruhe mit Bewegung. Dieser dreifache Empfindungszustand gibt drei verschiedenen Dichtungsarten die Entstehung, denen die gebrauchten Benennungen Satire, Idylle, Elegie vollkommen entsprechend sind.”
Diese neue Deutung des Begriffs rührt von dem Gedicht “Das Ideal und das Leben” her, welches während der Abfassung des Aufsatzes “Über naive und sentimentalische Dichtung” entstand. Es ließ Schiller die Möglichkeit erkennen , dass auch der moderne Dichter eine Idylle schaffen kann, welche (wie er in dem bereits erwähnten Brief an Humboldt schreibt) “der Begriff eines völlig aufgelösten Kampfes” ist, “einer freien Vereinigung der Neigungen mit dem Gesetz, einer zur höchsten sittlichen Würde hinauf geläuterten Natur.” Die Idylle gilt Schiller von nun an als das höchste Ziel des modernen Dichters.
Kommen wir nach dem kleinen Umweg nun wieder zur Johanna zurück. Wenn man nach der Empfindungsweise fragt, die sich im 5. Aufzug der “Jungfrau von Orleans” zunehmend durchsetzt, so erkennt man, dass Schiller sich immer mehr der Idylle annähert.
Wie in “Das Ideal und das Leben” beschrieben, sehen wir anfangs Johanna aus ihrem Schäferidyll, aus ihrer inneren Harmonie, gerissen. Für sie gilt jetzt, im Leben “zu herrschen und zu schirmen,” wo “Kühnheit sich an Kraft zerschlagen” mag und “sich der Mensch empöre, wenn der Menschheit Leiden euch umfangen.” Aber nach der “Verliebung” mit Lionel, nachdem ihre Zerrissenheit ans Tageslicht gekommen ist und sie sich selbst erkannt hat, sehen wir sie in dem für Schillers neuen Begriff des Idylls charakteristischen Zustand eines völlig aufgelösten inneren Kampfes. Ihr “rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr, keine Träne fließt hier mehr dem Leiden, nur des Geistes tapfrer Gegenwehr,” und “durch der Wehmut düstern Schleier schimmert lieblich der Ruhe heitres Blau.” Nachdem das Gewitter ausgetobt hat, sagt Johanna:
“Doch in der Öde lernt’ ich mich erkennen.Da, als der Ehre Schimmer mich umgab,Da war der Streit in meiner Brust; ich warDie Unglückseligste, da ich der WeltAm meisten zu beneiden schien – Jetzt bin ichGeheilt...In mir ist Friede – Komme, was da will,Ich bin mir keiner Schwachheit mehr bewusst!”
In einem Brief vom 4.4.1801 schrieb Schiller an Goethe in Bezug auf den letzten Akt:
“Er erklärt den ersten, und so beißt sich die Schlange in den Schwanz. Weil die Heldin darin auf sich allein steht… zeigt sich ihre Selbständigkeit.”
Die Jungfrau handelt jetzt als autonomes, freies Wesen und nicht mehr als von einem Geist auf dämonische Weise Getriebene. Im letzten Akt braucht Johanna deshalb das “als lebendiger Geist” agierende Schwert nicht mehr. Sie ist in Gefangenschaft und alles scheint verloren, als ein englischer Soldat ruft “Der König ist gefangen!” Da springt Johanna auf und “in demselben Augenblick stürzt sie sich auf den nächststehenden Soldaten, entreißt ihm sein Schwert und eilt hinaus” in die Schlacht, um deren Wende für die französische Seite herbeizuführen.
Johanna, die von der rauen Wirklichkeit des Krieges aus ihrer Schäferidylle – ihr Arkadien, zu dem sie nie wieder zurückkehren kann – gerissen wurde, hat nun ihr inneres Gleichgewicht wieder erlangt, sie ist nicht nach Arkadien zurückgekehrt, sie ist nun groß und erhaben, sie ist nun in Elysium. In dieser Erhabenheit reißt sie uns Zuschauer mit sich empor, weit über den bitterbösen Nebeldunst des Skeptizismus und der bösartigen Satire.
Dass ihr dieses gelingen konnte, ist nicht selbstverständlich. In dem Fragment “Demetrius” entwickelt Schiller z.B. ein Gegenbild zur Jungfrau, in dem Demetrius zur “tragischen Person” wird, “wenn er durch fremde Leidenschaften… dem Glück und dem Unglück zugeschleudert wird.” Er befreit das Volk nicht vom falschen Zaren, weil er es liebt; deshalb verliert er sein Charisma in dem Augenblick, als er erfährt, dass seine adelige Abstammung ein Betrug ist. Bei der Jungfrau ist das ganz anders. Die Grundlage für ihr Handeln ist nicht nur “der Ruf des Geistes”, sondern die Liebe zu ihrem Volk. Deshalb findet sie die Kraft, in einer Situation, in der sie an sich selbst zweifelt, alle an ihr zweifeln, selbst Raimond, der einzige Mensch, der ihr treu bleibt, sie für eine Hexe hält, mit sich ins Reine zu kommen. Wenn man Johannas Liebe zu den Mitmenschen nicht sieht, dann wird ihr Handeln unerklärlich, denn der “Ruf des Geistes” kann sie aus ihrer “Schuld” nicht erlösen. Wie Demetrius wäre sie tragisch gescheitert.
— Dabei werden viele, wenn nicht alle wunderlichen Dinge des Dramas verständlich, wenn man sie, wie es hier versucht wurde, auf der Grundlage der "Philosophischen Briefe" und Schillers Idee des Idylls in “Über naive und sentimentalische Dichtung” betrachtet.
In der “Jungfrau von Orleans” sind verschiedene Ebenen ineinander verwoben. Obwohl sich Schiller in diesem Drama so weit wie in keinem anderen von der Geschichte entfernt, existiert dennoch “soweit als möglich” die historische Jeanne d’Arc. Mit dem Bezug auf die politische Situation und die Ereignisse zu Schillers Lebzeit gibt es in dem Drama eine weitere historische Ebene. Und dann gibt es die Bezüge zur Literatur und Philosophie. Das ist alles da. Sobald allerdings eine dieser Ebenen überbewertet wird, wird dieses wunderschöne und großartige Werk verkürzt und deformiert. Will man das vermeiden, so bleibt nur der Zugang über den Versuch, Schillers Wirken und Absicht als Künstler zu verstehen, seinen leidenschaftlichen Kampf für eine neue Klassik und die Entwicklung der “schönen Kunst”.
Schiller sagt in seiner Vorrede zu “Die Braut von Messina”, dem Stück, das er unmittelbar nach der “Jungfrau von Orleans” schrieb:
“Es gibt keine höhere und keine ernsthaftere Aufgabe, als die Menschen zu beglücken. Die rechte Kunst ist nur diese, welche den höchsten Genuss verschafft. Der höchste Genuss aber ist die Freiheit des Gemüts in dem lebendigen Spiel aller seiner Kräfte. Die wahre Kunst aber hat es nicht bloß auf ein vorübergehendes Spiel abgesehen; es ist ihr ernst damit, den Menschen nicht bloß in einen augenblicklichen Traum von Freiheit zu versetzen, sondern ihn wirklich und in der Tat frei zu machen.”
Kurz bevor er mit der Niederschrift seiner “Jungfrau von Orleans” begann, gelang Schiller das in der Weltliteratur einzigartige Gedicht “Das Ideal und das Leben”. Es ermutigte ihn, an die “Möglichkeit einer solchen Idylle zu glauben” und zu erkennen, dass die Idylle die höchste, aber auch die schwierigste Kunstform ist, welche den “höchsten poetischen Effekt hervorbringen” kann. Mit der “Jungfrau von Orleans” bot sich Schiller der geeignete Stoff für die Vertiefung und Weiterführung dieser schwierigen Aufgabe.
Dieses wurde bereits angesprochen, aber wir wollen es nun abschließen noch eingehender darlegen, d.h. wir wollen betrachten, wieso Friedrich Schiller sein Drama "Die Jungfrau von Orleans" als Idylle verstand, und warum das seiner Meinung nach ein Höhepunkt der poetische Kunst darstellt. Dazu hören wir uns nun das vollständige Gedicht "Das Ideal und das Leben" an, welches in der Ursprünglichen Version den von vielen Lesern missverstanden Titel “Das Reich der Schatten” trug.
Das Ideal und das Leben
Ewigklar und spiegelrein und ebenFließt das zephyrleichte LebenIm Olymp den Seligen dahin.Monde wechseln und Geschlechter fliehen,Ihrer Götterjugend Rosen blühenWandellos im ewigen Ruin.Zwischen Sinnenglück und SeelenfriedenBleibt dem Menschen nur die bange Wahl.Auf der Stirn des hohen UranidenLeuchtet ihr vermählter Strahl.
Wollt ihr schon auf Erden Göttern gleichen,Frei sein in des Todes Reichen,Brechet nicht von seines Gartens Frucht.An dem Scheine mag der Blick sich weiden,Des Genusses wandelbare FreudenRächet schleunig der Begierde Flucht.Selbst der Styx, der neunfach sie umwindet,Wehrt die Rückkehr Ceres' Tochter nicht,Nach dem Apfel greift sie und es bindetEwig sie des Orkus Pflicht.
Nur der Körper eignet jenen Mächten,Die das dunkle Schicksal flechten,Aber frei von jeder Zeitgewalt,Die Gespielin seliger NaturenWandelt oben in des Lichtes Fluren,Göttlich unter Göttern, die Gestalt.Wollt ihr hoch auf ihren Flügeln schweben,Werft die Angst des Irdischen von euch,Fliehet aus dem engen dumpfen LebenIn des Ideales Reich!
Jugendlich, von allen ErdenmalenFrei, in der Vollendung StrahlenSchwebet hier der Menschheit Götterbild,Wie des Lebens schweigende PhantomeGlänzend wandeln an dem styg'schen Strome,Wie sie stand im himmlischen Gefild,Ehe noch zum traur'gen SarkophageDie Unsterbliche herunterstieg.Wenn im Leben noch des Kampfes WaageSchwankt, erscheinet hier der Sieg.
Nicht vom Kampf die Glieder zu entstricken,Den Erschöpften zu erquicken,Wehet hier des Sieges duft'ger Kranz.Mächtig, selbst wenn eure Sehnen ruhten,Reißt das Leben euch in seine Fluten,Euch die Zeit in ihren Wirbeltanz.Aber sinkt des Mutes kühner FlügelBei der Schranken peinlichem Gefühl,Dann erblicket von der Schönheit HügelFreudig das erflogne Ziel.
Wenn es gilt, zu herrschen und zu schirmen,Kämpfer gegen Kämpfer stürmenAuf des Glückes, auf des Ruhmes Bahn,Da mag Kühnheit sich an Kraft zerschlagen,Und mit krachendem Getös die WagenSich vermengen auf bestäubtem Plan.Mut allein kann hier den Dank erringen,Der am Ziel des Hippodromes winkt,Nur der Starke wird das Schicksal zwingen,Wenn der Schwächling untersinkt.
Aber der, von Klippen eingeschlossen,Wild und schäumend sich ergossen,Sanft und eben rinnt des Lebens FlußDurch der Schönheit stille Schattenlande,Und auf seiner Wellen SilberrandeMalt Aurora sich und Hesperus.Aufgelöst in zarter Wechselliebe,In der Anmut freiem Bund vereint,Ruhen hier die ausgesöhnten Triebe,Und verschwunden ist der Feind.
Wenn das Tote bildend zu beseelen,Mit dem Stoff sich zu vermählenTatenvoll der Genius entbrennt,Da, da spanne sich des Fleißes Nerve,Und beharrlich ringend unterwerfeDer Gedanke sich das Element.Nur dem Ernst, den keine Mühe bleichet,Rauscht der Wahrheit tief versteckter Born,Nur des Meisels schwerem Schlag erweichetSich des Marmors sprödes Korn.
Aber dringt bis in der Schönheit Sphäre,Und im Staube bleibt die SchwereMit dem Stoff, den sie beherrscht, zurück.Nicht der Masse qualvoll abgerungen,Schlank und leicht, wie aus dem Nichts gesprungen,Steht das Bild vor dem entzückten Blick.Alle Zweifel, alle Kämpfe schweigenIn des Sieges hoher Sicherheit,Ausgestoßen hat es jeden ZeugenMenschlicher Bedürftigkeit.
Wenn ihr in der Menschheit traur'ger BlößeSteht vor des Gesetzes Größe,Wenn dem Heiligen die Schuld sich naht,Da erblasse vor der Wahrheit StrahleEure Tugend, vor dem IdealeFliehe mutlos die beschämte Tat.Kein Erschaffner hat dies Ziel erflogen,Über diesen grauenvollen SchlundTrägt kein Nachen, keiner Brücke Bogen,Und kein Anker findet Grund.
Aber flüchtet aus der Sinne SchrankenIn die Freiheit der Gedanken,Und die Furchterscheinung ist entflohn,Und der ew'ge Abgrund wird sich füllen;Nehmt die Gottheit auf in euren Willen,Und sie steigt von ihrem Weltenthron.Des Gesetzes strenge Fessel bindetNur den Sklavensinn, der es verschmäht,Mit des Menschen Widerstand verschwindetAuch des Gottes Majestät.
Wenn der Menschheit Leiden euch umfangen,Wenn Laokoon der SchlangenSich erwehrt mit namenlosem Schmerz,Da empöre sich der Mensch! Es schlageAn des Himmel Wölbung seine Klage,Und zerreiße euer fühlend Herz!Der Natur furchtbare Stimme siege,Und der Freude Wange werde bleich,Und der heil'gen Sympathie erliegeDas Unsterbliche in euch!
Aber in den heitern Regionen,Wo die reinen Formen wohnen,Rauscht des Jammers trüber Sturm nicht mehr.Hier darf Schmerz die Seele nicht durchschneiden,Keine Träne fließt hier mehr dem Leiden,Nur des Geistes tapfrer Gegenwehr.Lieblich wie der Iris FarbenfeuerAuf der Donnerwolke duft'gem Tau,Schimmert durch der Wehmut düstern SchleierHier der Ruhe heitres Blau.
Tief erniedrigt zu des Feigen KnechteGing in ewigem GefechteEinst Alcid des Lebens schwere Bahn,Rang mit Hydern und umarmt' den Leuen,Stürzte sich, die Freunde zu befreien,Lebend in des Totenschiffers Kahn.Alle Plagen, alle ErdenlastenWälzt der unversöhnten Göttin ListAuf die will'gen Schultern des Verhaßten,Bis sein Lauf geendigt ist -
Bis der Gott, des Irdischen entkleidet,Flammend sich vom Menschen scheidet,Und des Äthers leichte Lüfte trinkt.Froh des neuen ungewohnten SchwebensFließt er aufwärts und des ErdenlebensSchweres Traumbild sinkt und sinkt und sinkt.Des Olympus Harmonien empfangenDen Verklärten in Chronions Saal,Und die Göttin mit den RosenwangenReicht ihm lächelnd den Pokal.”
In einem Brief an Wilhelm von Humboldt vom 20. November 1795 schrieb Friedrich Schiller folgendes über dieses Gedicht:
Rezitator1
“Ich habe ernstlich im Sinne, da fortzufahren, wo das 'Reich der Schatten' (das heißt das gerade gehörte Gedicht 'Das Ideal und das Leben') aufhört, aber darstellend und nicht lehrend. Herkules ist im den Olymp eingetreten, hier endigt letzteres Gedicht.
Die Vermählung des Herkules mit der Hebe würde der Inhalt meiner Idylle sein. Über diesen Stoff hinaus gibt es keinen mehr für den Poeten, denn dieser darf die menschliche Natur nicht verlassen, und eben von diesem Übertritt des Menschen in den Gott würde diese Idylle handeln... Gelänge mit dieses Unternehmen, so hoffte ich dadurch mit der sentimentalischen Poesie über die naive selbst triumphiert zu haben...
Denken Sie sich aber den Genuss, lieber Freund, in einer poetischen Darstellung alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen – keinen Schatten, keine Schranke, nichts von dem allen mehr zu sehen –, Mir schwindelt ordentlich, wenn ich an diese Aufgabe – wenn ich an die Möglichkeit ihrer Auflösung denke. Eine Szene im Olymp darzustellen, welcher höchste aller Genüsse!”
— Schiller hat diese Idee nicht in einem Gedicht verwirklichen können, aber in seinem Drama Johanna gelingt ihm dieses. Jeder einfühlsame Zuschauer wird das erkennen, wenn er die befreiende Schlussszene der “Johanna” erlebt und auf sich wirken lässt, sie gibt eine Vorahnung des “Übertrittes des Menschen in den Gott”, eine poetische Darstellung, die “alles Sterbliche ausgelöscht, lauter Licht, lauter Freiheit, lauter Vermögen – keinen Schatten, keine Schranke”.
Und so stellt sich heraus, dass gerade das, was bisweilen als “romantisch” oder “opernhafter Schluss” des Dramas abwertend gesehen wird, für unsere heutige Zeit besonders aktuell ist, nämlich das Bild des Menschen als transzendentes Wesen, welches nicht durch kybernetische Prozessoren verbessert oder ersetzt werden kann.
Damit sind wir am Ende unseres Programms über Schillers Jungfrau von Orléans. Wir, Siggi Ober-Grefenkämper und ich, Uwe Alschner, bedanken uns bei Ralf Schauerhammer und dem Verein Dichterpflänzchen e.V. für die Möglichkeit, diese Produktion ins Radio bringen zu können. Herr Schauerhammer hat zudem erneut einen Part als Rezitator übernommen.
Sie hörten Beethovens Trio Nummer 4 für Klavier, Violine und Cello, Op. 11, in einer Aufnahme des Schiller-Instituts New York. Wir danken Ihnen, liebe Freunde von Radio IBYKUS, für Ihr Interesse. Danken möchten wir auch ganz besonders unserem Kollegen Frank Paul für die technische Leitung sowie den Kolleginnen und Kollegen von OS Radio 104,8 für die Bereitstellung des Sendeplatzes.
Wir kommen wieder mit der achten Ausgabe von Radio IBYKUS am Donnerstag, den 7. August, wieder hier auf OS Radio 104,8 um 18.03 Uhr nach den Nachrichten. Bis dahin empfehlen Sie uns gerne weiter. Sie finden alle Ausgaben von Radio IBYKUS auf der Seite ganzmenschsein.substack.com und überall dort, wo Sie Podcasts hören und nach Radio IBYKUS suchen.
Bitte bewerten Sie und kommentieren Sie dort, denn das stimmt den Algorithmus gnädig und hilft anderen, unsere Sendung schneller zu finden. Vielen Dank.
Ganz Mensch sein ist eine von Lesern unterstützte Publikation. Um neue Posts zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, ziehen Sie in Betracht, ein Free- oder Paid-Abonnent zu werden.