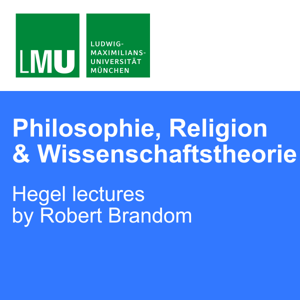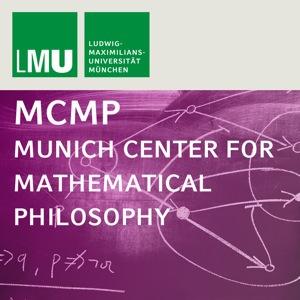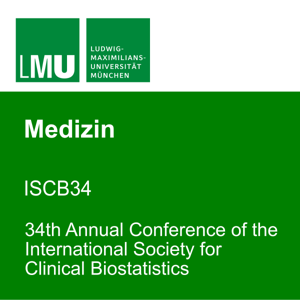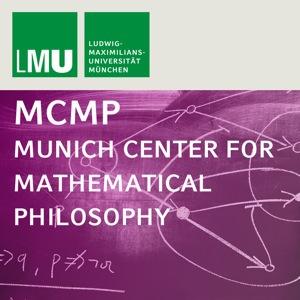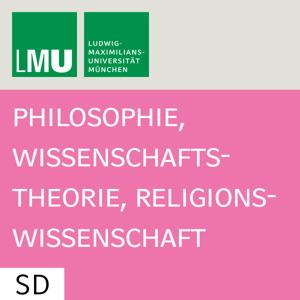Die vorliegende prospektive Studie stellt eine Zusammenfassung der
Ergebnisse der Schulterendoprothetik am Universitätsklinikum München
Großhadern dar.
Während eines Beobachtungszeitraumes von 11 Jahren (1994–2005)
wurden 102 Patienten mit einem anatomischen Schulterprothesendesign
der dritten Generation vom Typ Aequalis versorgt. 64-mal wurde eine
Hemiprothese implantiert, bei 38 Patienten wurde auch das Glenoid
ersetzt.
Das durchschnittliche Alter der Studienteilnehmer betrug 65,8 Jahre. Die
Prothesenstandzeit belief sich im Mittel auf 44,5 Monate, bei einem
Follow-up von 1,3 bis 126,8 Monaten.
Alle Indikationen, die zu einem Gelenkersatz der Schulter führen können,
wurden berücksichtigt.
42-mal wurde die Diagnose einer Omarthrose gestellt, 24 Patienten litten
an der Folge einer alten Oberarmkopffraktur. Die Ätiologie einer
Humeruskopfnekrose trat in 10 Fällen auf. 8-mal wurde eine Rheumatoide
Arthritis diagnostiziert. 7 Patienten erlitten ein akutes Trauma des
Humeruskopfes. Der Befund einer Instabilitätsarthropathie lag bei 4
Studienteilnehmern vor, die Sparte der Rotatorenmanschetten-
Defektarthropathie war einmal besetzt. Insgesamt wurden 6
Revisionsoperationen durchgeführt.
Die Patienten wurden sowohl klinisch als auch radiologisch
nachuntersucht und mit den etablierten Scores nach Constant und Wülker
bewertet.
Es konnte bei allen Studienteilnehmern eine signifikante Verbesserung in
den Score-Wertungen und im Bewegungsausmaß bewiesen werden. Im
Adjusted Score nach Constant bedeutet dies einen Anstieg von 50,7 % auf
88,4 %.
134
Eine Gegenüberstellung der Hemi- und der Totalendoprothesen zeigte bei
einem Glenoidersatz die besseren Ergebnisse. Im Constant-Score
erlangten die Patienten mit Totalprothese 68,6 Punkte, die mit einer
Hemiprothese versorgten Patienten 61,2 Punkte. Im Adjusted Constant-
Score bedeutet dies einen Unterschied von 92,9 % für die TEP-Gruppe
und 85,7 % für die Gruppe mit Teilimplantat.
Es konnte zudem bei den Studienteilnehmern ohne Glenoidersatz die
Ausbildung einer sekundären Glenoidarthrose beobachtet werden. Mit
Auftreten dieses Pfannendefektes nahm auch die Wertung in den Scores
und im Bewegungsausmaß zum Teil signifikant ab (Wülker-Score,
Abduktion).
Diese Resultate führen zu dem Schluss, die Indikation einer
Totalendoprothese künftig großzügiger zu stellen, wenn auch die
Implantation des Glenoidersatzes derzeit die größte Herausforderung
darzustellen scheint.
Beim direkten Vergleich der Patientengruppen mit akut erlittenem Trauma
und veralteter Fraktur des Humeruskopfes schnitt die Kategorie der
frischen Verletzung in allen Rubriken besser ab. Sie erreichte im Adjusted
Constant-Score im Mittel Werte von über 100 %, also eine altersgerechte
Funktion.
Die Erstversorgung einer Humeruskopffraktur mit einer anatomischen
Schulterprothese scheint nach diesen Erkenntnissen eine gute Option.
Die Unterteilung der Patientengruppe mit veraltetem Trauma zeigte ein
deutlich besseres Abschneiden derjenigen Patienten, die eine niedrige
Kategorie nach Boileau belegten. Eine vorangegangene Malposition der
Tuberkula oder eine Pseudarthrose führen demnach zu weniger guten
Resultaten im Bewegungsausmaß und in den Score-Wertungen als bei
Patienten, die präoperativ weniger anatomische Fehlstellungen aufweisen.
In den Gruppen ohne traumatische Genese berechneten sich vor allem für
die Omarthrose und die Humeruskopfnekrose sehr gute Resultate. Aber
auch die Patientengruppe mit Polyarthritis konnte sich im Vergleich mit
den präoperativ erreichten Wertungen signifikant verbessern.
Für das Outcome der Patienten mit nichttraumatischer Indikationsstellung
ist eine zufriedenstellende präoperative Funktion ausschlaggebend.
135
Bei der Behandlung von Erkrankungen des Schultergelenkes ist an eine
frühe Implantation einer Prothese zu denken, um die Lebensqualität
längstmöglich zu erhalten.
Radiologisch diagnostizierte Lysezonen und Subluxationsstellungen
blieben bis auf einen Fall einer Glenoidlockerung ohne klinische
Konsequenz