„Wir haben im Juni 2019 mit dem Ziel angefangen, einen Austausch
zwischen Juden und Muslimen bundesweit zu initiieren, nicht zuletzt um
Antisemitismus vorzubeugen oder abzubauen“, konstatierte der Präsident
des Zentralrats der Juden, Dr. Josef Schuster, als er Anfang 2020 eine
erste Bilanz zog. Das Projekt „Schalom Aleikum“ des Zentralrats der
Juden stellt den jüdisch-muslimischen Dialog in den Mittelpunkt und
organisiert bundesweite Dialogveranstaltungen – obwohl nicht wenige
Vertreter der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland die Frage umtreibt,
warum ausgerechnet Juden auf Muslime zugehen sollen. Sind doch
Übergriffe von Muslimen auf Juden für viele ein gravierendes Problem.
Folglich seien Muslime in der Pflicht, der Gewalt Abhilfe durch Dialog
zu schaffen. Doch der Zentralrat der Juden tut bewusst, was auf
muslimischer Seite organisatorisch schwieriger ist, nämlich: Als
zentrale politische Vertretung von Juden in Deutschland, einen
landesweiten Dialog mit einer anderen religiösen Minderheit zu starten.
Der Name „Schalom Aleikum“ ist Programm: Die hebräische Grußformel
„Schalom Alejchem“ und das arabische „Salaam Aleikum“ meinen dasselbe –
„Friede sei mit Dir“.
Im jüdisch-muslimischen Gespräch
„offen und ehrlich“ zu sein, ist nach Daniel Botmann, dem
Geschäftsführer des Zentralrats der Juden, die Grundvoraussetzung für
sein Gelingen. „Schalom Aleikum“ versteht sich grundsätzlich als ein
Projekt zur Prävention von Antisemitismus und Radikalisierung. Neben
verbindenden Themen werden auch ganz offen Probleme, wie eben Judenhass
unter Muslimen, angesprochen. Radikalisierte fallen jedoch nicht unter
die Adressaten von „Schalom Aleikum“. Als ein Präventions- und zugleich
als ein Dialogprojekt auf Augenhöhe wird „Schalom Aleikum“ von der
Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und
Integration, Staatsministerin Annette Widmann-Mauz, gefördert.
DialogplattformenDer
Dialog findet bewusst abseits der Funktionärsebene und direkt in der
Zivilgesellschaft statt. Solche Teilnehmer bringen sich anders als
Amtsträger in ein Gespräch ein: mit der ganzen Person und ohne eine
positionsbedingte Agenda. Diesen Stimmen gibt „Schalom Aleikum“ durch
seine Medienwirksamkeit eine signifikante Reichweite. Durch die
Umsetzung und Verbreitung von Beispielen gelungenen Dialogs entzieht es
den Nährboden für Ressentiments und Radikalisierung in der Gesellschaft.
Seine Reichweite gewinnt das Projekt auch durch das Zusammenbringen von
Juden und Muslimen auf Basis von grundlegenden Gemeinsamkeiten: Bei der
Auftaktveranstaltung in Berlin diskutierten jüdische und muslimische
Startup-Unternehmer unter anderem die Frage, ob ihre
Religionszugehörigkeit eine Rolle bei ihren unternehmerischen
Aktivitäten spielt.
In Würzburg trafen jüdische, muslimische und
christliche Familien zu einem Trialog zusammen. Die Teilnehmer redeten
u. a. über Vorurteile gegenüber Juden und Muslimen im Netz. In Leipzig
tauschten sich Frauen über ihre Rolle und ihre Identität als Muslimas
oder Jüdinnen aus. In Osnabrück sprachen jüdische und muslimische
Seniorinnen und Senioren über ihre Erfahrungen in der Bundesrepublik.
Klar wurde dabei: Auch diese Menschen mit ihren zum Teil dramatischen
Einwanderungsbiographien sind ein Teil von Deutschland.
StimmungsbilderWarum
ist der jüdisch-muslimische Dialog in dieser Form überhaupt notwendig
und welche Stimmungsbilder gibt es bei den Teilnehmern und Gästen von
„Schalom Aleikum“? Dieser Frage wurde durch die eigens vom Projekt
durchgeführten Umfragen nachgegangen. Aufgrund der geringen Fallzahl
waren diese zwar nicht repräsentativ, zeigten dennoch bemerkenswerte
Tendenzen auf. Eine zentrale Rolle spielte die Verfügbarkeit von Wissen
über Juden und Muslime in der Gesellschaft.
Im Oktober 2019 fand
eine einmonatige Online-Erhebung statt, an der über 200 Personen...



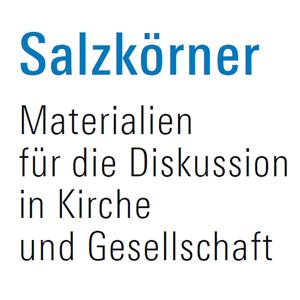

 View all episodes
View all episodes


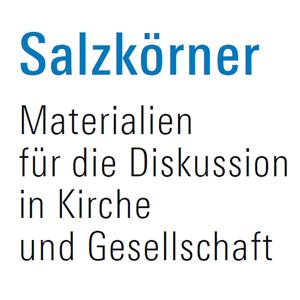 By Zentralkomitee der deutschen Katholiken
By Zentralkomitee der deutschen Katholiken