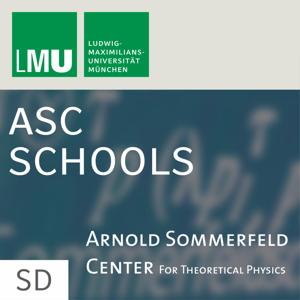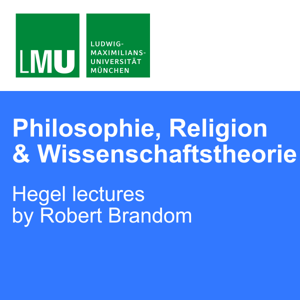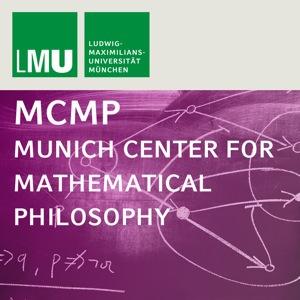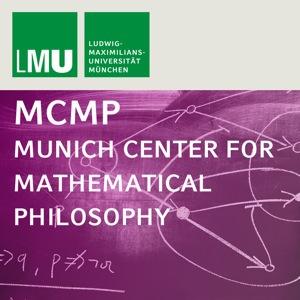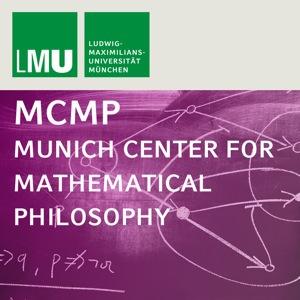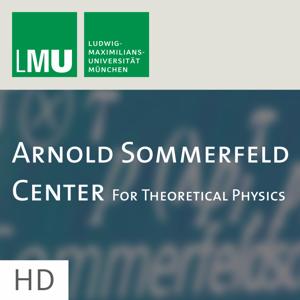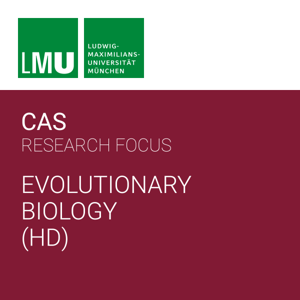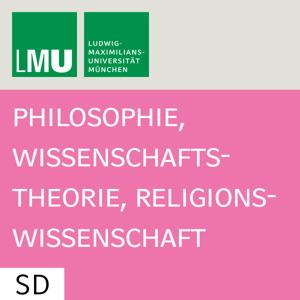In dieser Arbeit wurden einhundert Vögel mit der Verdachtsdiagnose Neuropathische
Magendilatation untersucht. Es handelt sich um Papageienvögel, die entweder klinisch,
vorberichtlich oder pathologisch-anatomisch Anzeichen einer NPMD zeigten. Bei
insgesamt 73 % der Vögel wurde die Erkrankung in Form einer Neuritis nonpurulenta
im Bereich des Magen-Darm-Trakts, des Herzens, der adrenalen Ganglien oder des
Gehirns histologisch bestätigt.
Klinisch zeigten 56,2 % der an NPMD erkrankten Tiere NPMD typische Symptome. In
der Mehrzahl handelte es sich bei den erkrankten Vögeln um Bestandstiere (64,4 %).
Dabei waren, bis auf Nestlinge alle Altersgruppen vertreten, mit einem deutlichen Anteil
von Jungtieren bis zu einem Jahr (15,1 %). Die Auswertung der Daten hinsichtlich der
erkrankten Vogelgattungen ergab, dass in der untersuchten Klientel besonders
Graupapageien (41,1 %) und Aras (30,1 %) vertreten waren. Amazonen, welche
ebenfalls sehr häufig als Heimtiere gehalten werden, wurden dagegen deutlich seltener
(4,1 %) untersucht. Eine saisonale Häufung von Erkrankungen zeichnete sich nicht ab.
Bei der pathologisch-anatomischen Untersuchung zeigten nahezu alle Tiere (87,7 %)
einen starken Grad der Auszehrung. In 75,3 % der Fälle war eine
Drüsenmagendilatation vorhanden und in 37 % eine Atrophie der Magenwand des
Muskelmagens.
Die wichtigsten histologischen Ergebnisse bei diesen Tieren waren Veränderungen im
Sinne einer Neuritis nonpurulenta. Im Bereich des Magen-Darm-Trakts trat diese in
83,6 % aller an NPMD erkrankten Papageien auf. Besonders häufig wies der
Muskelmagen (68,6 %) eine Neuritis auf, während im Vergleich dazu der Drüsenmagen
(59,6 %) seltener betroffen war. Noch seltener wurden derartige Veränderungen in
Kropf (28,0 %) und Dünndarm (12,5 %) gefunden. Darüber hinaus traten
Veränderungen im Sinne einer Neuritis auf, die das Gehirn (41,1 %) und das Herz
(43,1 %) betrafen. Beeindruckend war, dass jedes Gehirn histologische Veränderungen
zeigte, wobei es sich in der Hauptsache um degenerative Veränderungen (96,4 %)
handelte. Degenerative Veränderungen (Plexus-brachialis-Bereich 66,7 %,
Thorakalbereich 83,3 %, Synsakralbereich 73,3 %) wurden ebenfalls häufig im
ZUSAMMENFASSUNG 98
Rückenmark gefunden, jedoch keine Entzündungszellen. Eine Neuritis zeigten dagegen
in 36,4 % der Fälle die adrenalen Ganglien. Darüber hinaus ergab die Untersuchung
der Nebennieren selbst eine Degeneration der Markzellen (52,3 %), sowie Infiltration
mit nichteitrigen Entzündungszellen (81,8 %). Weitere degenerative Veränderungen
fanden sich in den Parenchymen von Leber (73,3 %), Herz (43,1 %) und Nieren, die
sich dort in Form einer Tubulonephrose (85,7 %) und Glomerulopathie (49,2 %)
äußerten.
Bei 27 % der Patienten, die klinisch bzw. pathologisch-anatomisch Merkmale der
NPMD aufwiesen, konnte histologisch keine Polyneuritis als Zeichen einer NPMD
diagnostiziert werden. Tiere dieser Gruppe wiesen allerdings Organveränderungen auf,
die mit denen der NPMD-Vögel zum Teil vergleichbar waren. In den Organen des
Magen-Darm-Trakts konnten sehr häufig Neurodegenerationen (Kropf 66,7 %,
Muskelmagen 72 %) gefunden werden, sowie seltener nichteitrige Entzündungszellen
(Drüsenmagen 31,3 %, Muskelmagen 28 %), die außerhalb neuronalen Gewebes
gelegen waren. Wie auch bei den bestätigten NPMD-Fällen, waren im Vergleich zu den
Drüsenmägen (50 %) besonders die Muskelmägen (72 %) histologisch in
Mitleidenschaft gezogen worden. Sämtliche Nebennieren wiesen histologische
Veränderungen auf, davon mehr als drei Viertel (76,9 %) Markzelldegeneration. Zu
100 % verändert waren die Gehirne, welche durchweg degenerative Veränderungen
zeigten und hier zudem sehr häufig Gliazellproliferation und Neuronophagie (85 %)
nachgewiesen werden konnte. Diese mit den NPMD-Vögeln vergleichbaren
degenerativen Veränderungen lassen vermuten, dass es auch bei diesen Vögeln
infolge von Neurodegeneration zur Drüsenmagenerweiterung kam. Somit kann es sich
auch bei diesen unbestätigten Fällen um an NPMD