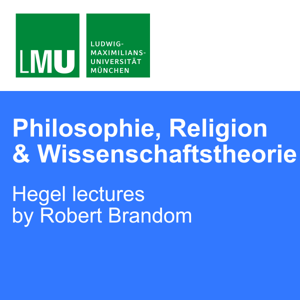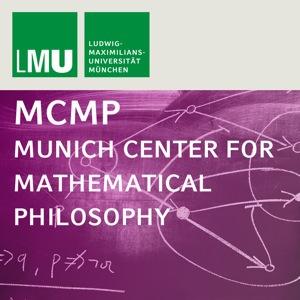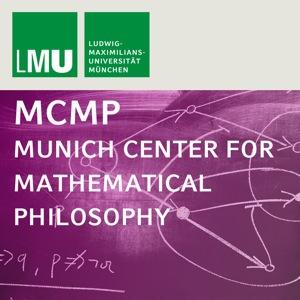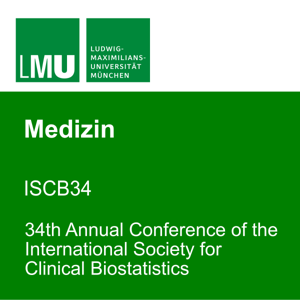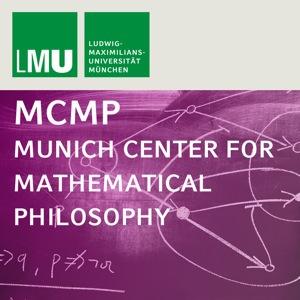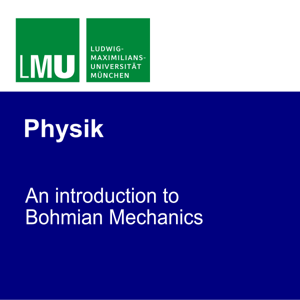Chris Ofili spielt mit etablierten Repräsentationsweisen. Er adaptiert stereotype Vorstellungen von Identität, Herkunft und Aussehen, spickt diese mit unterschiedlichen Bezügen und Motiven und schafft durch die künstlerische Transformation ein neuartiges, hybrides Menschenbild. Er schöpft dabei aus den disparatesten Quellen wie Pornografie, christlicher Ikonografie, griechischer Mythologie, afrikanischer Höhlenmalerei, 1970er Motivik aus der Populärkultur sowie von Künstlern wie David Hammons, Francis Picabia, Pablo Picasso und den Bildkonzepten der Moderne. Die Technik der Adaption und Transformation von Motiven, Repräsentationen und bildhaften Vorstellungen kann mit dem Konzept des Samplings erklärt werden, welches in der schwarzen Tradition und vor allem im HipHop fest verankert ist. Die Technik des Samplings zielt nicht allein auf die reine Kopie von Bildern und Geschichten. Stattdessen wird sie als künstlerisches Konzept eingesetzt, um mit dem Akt des Aneignens und Übersetzens von fremden Dingen in die eigene künstlerische Gegenwart gebräuchliche Traditionen und Konventionen zu manipulieren. Diese Technik macht sich der afro-britische Künstler Chris Ofili für seine Bilder, Skulpturen und Zeichnungen sowie für seine Selbstinszenierung als kreative Person zu Eigen. Mit der subversiven Kulturtechnik des Samplings wird ein alternativer Raum geschaffen für eine neuartige Kreativität aus der Marginale, ein Raum für eine neue Sprache und letztlich für eine neue Art der Repräsentation. Chris Ofili nimmt durch den Einsatz dieser künstlerischen Strategien eine selbstbewusste Stellung innerhalb der immer noch mehrheitlich von Weißen dominierten Kunstwelt ein und artikuliert ein komplexes Menschenbild, das ungezwungen aus allen möglichen Bezügen der Welt eine neuartige Identität schöpft und nicht mehr einer veralteten Idee von Authentizität nacheifert.
Die Doktorarbeit Strategien der Repräsen-tation – Chris Ofili und das Konzept des Samplings setzt sich zum Ziel, Sampling als Technik des Aneignens und Transformierens am Werkbeispiel von Ofili zu erarbeiten. Dabei wird die Traditionslinie dieser kulturellen Produktionstechnik in seiner Entstehung nachgezeichnet und mit kultur-theoretischen Ansätzen in Anlehnung an Stuart Hall, Homi Bhabha sowie Franz Fanon als Strategie zur Artikulation von neuen Repräsentationsformen vorgestellt. Diese Strategie wird im Folgenden paradigmatisch erläutert.
Chris Ofili ist 1968 in Manchester geboren. Seine Eltern kommen aus Nigeria und sind kurz vor Ofilis Geburt nach England immigriert. Ofili kennt Afrika nur aus den Erzählungen seiner Eltern, bis er 1993 an einem Austauschprogramm nach Zimbabwe teilnimmt, wo er zum ersten Mal eine persönliche Beziehung und ethnische Bezugslinie zu Afrika aufgebaut hat. In Zimbabwe stößt Ofili auf Elefantendung als gestaltendes/gestaltbares Material sowie auf historische Höhlenmalereien in den Matopos Bergen. Diese starken Prägungen ziehen sich wie ein roter Faden durch das frühe Werk. Insbesondere die Entdeckung der animalischen Exkremente als Medium der Malerei wurde in der Folge in vielen Texten zu Ofili als Schlüsselelement gern aufgegriffen und letztendlich zu einer Art Mythos stilisiert, mit dem dann auch Ofili seinerseits selbst zu spielen beginnt. In einem Gespräch mit Godfrey Worsdale 1998 etwa deutet der Künstler an, dass die Geschichte aus Zimbabwe vielleicht von ihm einfach nur erfunden worden sei.1 1993 wiederum veranstaltet er sogenannte Shit Sales. Die Performance ist eine Anspielung auf den afro-amerikanischen Künstler David Hammons, der 1983 am Cooper Square in New York einen sogenannten Bliz-aard Ball Sale veranstaltet und dabei Passanten Schneebälle zum Kauf angeboten hatte, wie Ofili selbst erklärt: „I was sampling David Hammons' Snowball Sale. I called it Chris Ofilis Shit Sale.“2 Ofili übernimmt das Konzept jedoch nicht 1:1 von Hammons, sondern transformiert es für seine eigenen künstlerischen Zwecke um, und zwar ironischerweise als „an a