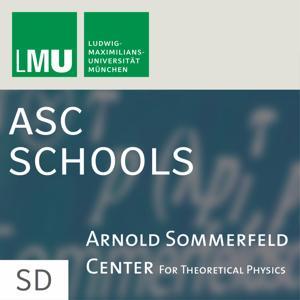Unter den Prognosefaktoren beim kolorektalen Karzinom hat das Tumorstaging den größten
Stellenwert und dient der weiteren Therapieplanung. In den letzten Jahren wurden zunehmend
auch Tumormarker hinsichtlich der prognostischen Aussagekraft untersucht, es existieren
aber kaum Studien, die an großer Fallzahl mehrere Tumormarker im Vergleich zu den
etablierten Prognosefaktoren multivariat evaluiert haben.
In der vorliegenden Arbeit wurden die Tumormarker CEA, CA 19-9, CA 242, CA 72-4,
CYFRA 21-1, hCGß, S100 und HGF hinsichtlich ihrer prognostischen Wertigkeit beim
kolorektalen Karzinom analysiert. Die präoperativen Tumormarkerwerte von CEA und CA
19-9 lagen bei 1089 Patienten (Kollektiv I) vor. Bei einem Teil dieser Patienten (n=450)
waren Restproben vorhanden, so dass retrospektiv zusätzlich die Tumormarker CA 242, CA
72-4, CYFRA 21-1, hCGß, S100 und HGF analysiert werden konnten (Kollektiv II).
Es zeigte sich bei allen Tumormarkern eine höhere Freisetzung mit zunehmender
Tumorinfiltrationstiefe. Bei CEA und CA 19-9 wurde außerdem ein signifikanter
Zusammenhang zwischen der Serumkonzentration und dem Lymphknotenstatus festgestellt.
Bezüglich der Korrelation der Tumormarker untereinander wurde der höchste Koeffizient für
CA 19-9 und CA 242 errechnet (rs=0.79).
Basierend auf den aktuellen Empfehlungen für adjuvante Therapien beim kolorektalen
Karzinom wurde eine Unterteilung in Prognosegruppen vorgenommen:
In der günstigen Prognosegruppe (GPG) befanden sich Patienten mit einem Kolonkarzinom
Stadium I-II oder Rektumkarzinom Stadium I, in der ungünstigen Prognosegruppe (UPG)
befanden sich Patienten mit einem Kolonkarzinom Stadium III oder einem Rektumkarzinom
Stadium II oder III. In Anlehnung an eine Studie von Harrison et al wurden zusätzlich alle
Patienten mit einem Kolonkarzinom ohne Lymphknotenbefall gesondert betrachtet.
Ziel unserer Studie war es zu untersuchen, ob durch Berücksichtigung von Tumormarkern
innerhalb der Prognosegruppen eine detailliertere prognostische Einschätzung mit
entsprechender therapeutischer Konsequenz erfolgen kann. Dabei war unser primäres
Zielkriterium das rezidivfreie Intervall, zusätzlich untersuchten wir das tumorbedingte
Gesamtüberleben.
161
In der statistischen Auswertung wurde zunächst überprüft, ob eine lineare Abhängigkeit
zwischen der Serumkonzentration der Tumormarker und dem Rezidivrisiko besteht. Eine
solche Linearität konnte nur für CEA gezeigt werden, es ging daher in logarithmierter Form
in die multivariate Analyse ein.
Bei den übrigen Tumormarkern musste ein Cut-Off gesucht werden, wobei in der
vorliegenden Arbeit weder die herstellerüblichen Cut-Off-Werte verwendet wurden, noch
nach dem für das Kollektiv optimalen Cut-Off gesucht wurde. Vielmehr wurde versucht,
mittels Bootstrapverfahren reproduzierbare Cut-Offs zu ermitteln.
Nach unseren Ergebnissen ist CEA zu Recht als Kategorie I Prognosemarker klassifiziert
worden. Dies konnte an großer Fallzahl und unter Berücksichtigung verschiedener anderer
Tumormarker bestätigt werden.
Auch in der Gruppe der Patienten mit einer günstigen Prognose sowie der N0-Kolontumoren
erwies sich CEA als unabhängiger Prognosefaktor. Die Patienten dieser Gruppen erhalten laut
dem aktuellen Konsensus keine adjuvante Therapie. Basierend auf den Ergebnissen dieser
Arbeit sollte CEA jedoch in den Leitlinien der American Society of Clinical Oncology als
prognostisch relevanter Parameter berücksichtigt werden und auch in die Therapieplanung mit
eingehen.
In der multivariaten Analyse hat sich darüber hinaus beim Kollektiv I gezeigt, dass neben
CEA auch CA 19-9 ein stadienunabhängiger Prognosefaktor ist, jedoch nur für die ungünstige
Prognosegruppe.
Innerhalb des Kollektivs II erreichten die Tumormarker CEA, CA 19-9, CA 242, CA 72-4,
S100 und HGF Signifikanz.
Die beiden neuen und wenig erforschten Tumormarker S100 und HGF waren starke
unabhängige Prädiktoren in der günstigen Prognosegruppe dieser Auswertung, sogar stärker
als CEA. Dieses Ergebnis muss durch prospek