
Sign up to save your podcasts
Or




Die beliebtesten Märchen auch in der Waldorfschule sind die der Gebrüder Grimm – zumindest im deutschsprachigen Raum. Es sind Volksmärchen, die von Archetypen erzählen, von Gut und Böse, von edlen und lasterhaften Eigenschaften. Wenn sie in der ersten Klasse der Waldorfschule erzählt werden, sollen die darin erscheinenden Personen keine Prototypen für Geschlechterrollen sein sondern Gestalten, die das höhere Wesen in uns verkörpern. Sie zeigen den Kindern, die sich in die Märchen hinein träumen und noch nicht zwischen Realität und Phantasie unterscheiden können, dass es das Böse in der Welt zwar gibt, es aber auch ein ausgleichendes Element gibt, dass dafür sorgt, dass die Bösen bestraft werden und das die Welt am Ende des Märchens immer gut und schön ist. Ambivalenzen und komplexe Charaktere erscheinen erst in den mythologischen Erzählungen der 4. Klasse.
Obwohl also die Geschlechterzuschreibungen angeblich keine Rolle spielen und gerade nicht als Vorbild dienen sollen, werden oft die gleichen Figuren benutzt: die böse Hexe bzw Stiefmutter, der mutige Prinz, die unschuldige Prinzessin, der weise König. Diese Rollenverteilung kommt nicht zuletzt aus dem historischen Kontext, im dem die Märchen vor Verschriftlichung durch die Gebrüder Grimm entstanden sind.
Wenn wir den Kindern also von diesen männlichen und weiblichen Figuren erzählen, bildet sich nach und nach ein inneres Bild einer Figur, so dass die Stiefmutter (auch außerhalb des Märchens, also in echt) immer erstmal negativ wahrgenommen wird.
Lässt sich dem nicht ganz einfach vorbeugen, indem der Lehrer die Protagonist*innen in ihrem Geschlecht verändert? Was passiert, wenn die Lehrerin die Rollen hin und wieder vertauscht, ganz beiläufig den Jungen, der 3 Prüfungen bestehen soll, zu einem Mädchen macht? Würde es den Charakter, die eigentliche Aussage des Märchens verfälschen? Müssen wir die Märchen wirklich wortgetreu wiedergeben oder dürfen wir sie verändern, ohne das der spezifische Duktus – den moderne Adaptionen der Grimmschen Märchen nicht mehr haben – verloren geht?
Zwei Lehrpersonen haben für uns den Test gemacht. Sven Saar erzählt von Rapunzel und liefert das Vor- und Nachwort dazu gleich mit. Kristina Braun erzählt von den drei goldenen Bällen und regt damit dazu an, Märchen nicht nur binär zu erzählen (also männliche und weibliche Rollen zu vertauschen) sondern mit Kombinationen und Geschlechtern zu spielen. Hört selbst, wie die Märchen auf Euch wirken und versucht es selbst einmal.
 View all episodes
View all episodes


 By waldorflernt
By waldorflernt
Die beliebtesten Märchen auch in der Waldorfschule sind die der Gebrüder Grimm – zumindest im deutschsprachigen Raum. Es sind Volksmärchen, die von Archetypen erzählen, von Gut und Böse, von edlen und lasterhaften Eigenschaften. Wenn sie in der ersten Klasse der Waldorfschule erzählt werden, sollen die darin erscheinenden Personen keine Prototypen für Geschlechterrollen sein sondern Gestalten, die das höhere Wesen in uns verkörpern. Sie zeigen den Kindern, die sich in die Märchen hinein träumen und noch nicht zwischen Realität und Phantasie unterscheiden können, dass es das Böse in der Welt zwar gibt, es aber auch ein ausgleichendes Element gibt, dass dafür sorgt, dass die Bösen bestraft werden und das die Welt am Ende des Märchens immer gut und schön ist. Ambivalenzen und komplexe Charaktere erscheinen erst in den mythologischen Erzählungen der 4. Klasse.
Obwohl also die Geschlechterzuschreibungen angeblich keine Rolle spielen und gerade nicht als Vorbild dienen sollen, werden oft die gleichen Figuren benutzt: die böse Hexe bzw Stiefmutter, der mutige Prinz, die unschuldige Prinzessin, der weise König. Diese Rollenverteilung kommt nicht zuletzt aus dem historischen Kontext, im dem die Märchen vor Verschriftlichung durch die Gebrüder Grimm entstanden sind.
Wenn wir den Kindern also von diesen männlichen und weiblichen Figuren erzählen, bildet sich nach und nach ein inneres Bild einer Figur, so dass die Stiefmutter (auch außerhalb des Märchens, also in echt) immer erstmal negativ wahrgenommen wird.
Lässt sich dem nicht ganz einfach vorbeugen, indem der Lehrer die Protagonist*innen in ihrem Geschlecht verändert? Was passiert, wenn die Lehrerin die Rollen hin und wieder vertauscht, ganz beiläufig den Jungen, der 3 Prüfungen bestehen soll, zu einem Mädchen macht? Würde es den Charakter, die eigentliche Aussage des Märchens verfälschen? Müssen wir die Märchen wirklich wortgetreu wiedergeben oder dürfen wir sie verändern, ohne das der spezifische Duktus – den moderne Adaptionen der Grimmschen Märchen nicht mehr haben – verloren geht?
Zwei Lehrpersonen haben für uns den Test gemacht. Sven Saar erzählt von Rapunzel und liefert das Vor- und Nachwort dazu gleich mit. Kristina Braun erzählt von den drei goldenen Bällen und regt damit dazu an, Märchen nicht nur binär zu erzählen (also männliche und weibliche Rollen zu vertauschen) sondern mit Kombinationen und Geschlechtern zu spielen. Hört selbst, wie die Märchen auf Euch wirken und versucht es selbst einmal.
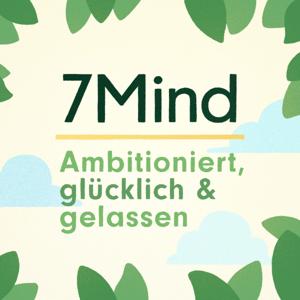
15 Listeners

198 Listeners
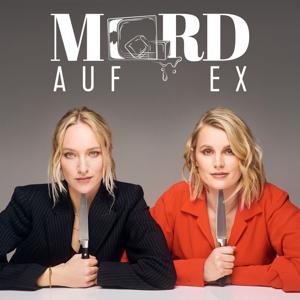
120 Listeners

30 Listeners