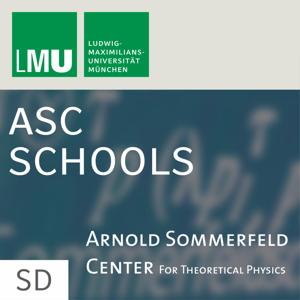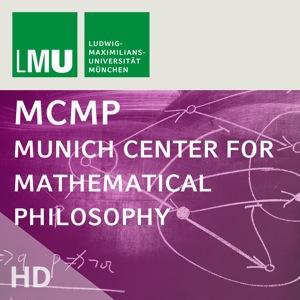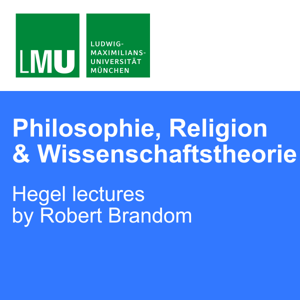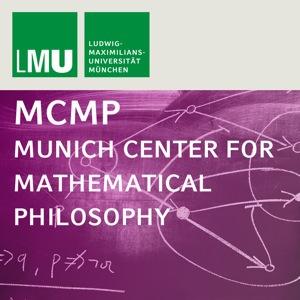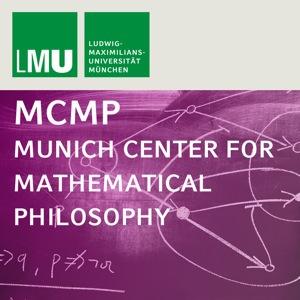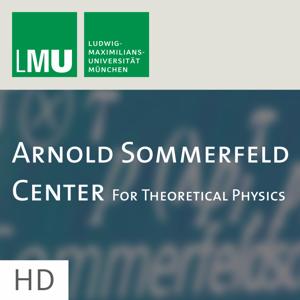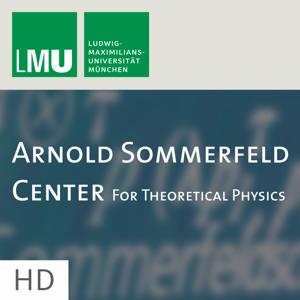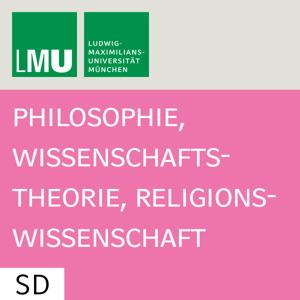Bandscheibenbedingte Rückenschmerzen stellen eine Gesundheitsstörung von
herausragender Bedeutung dar. Innovative Therapiekonzepte sind darauf
ausgerichtet, schmerzhaft degenerierte Bandscheiben in ihren natürlichen Strukturen
zu regenerieren. Allein durch den chirurgischen Eingriff zur Anwendung dieser
Therapiekonzepte wird jedoch die mechanische Kompetenz der Bandscheibe
empfindlich gestört. Derzeit ist nicht bekannt, ob neue Nukleusersatzmaterialien für
Tissue engineering Strategien an der Bandscheibe diesen Verlust kompensieren
können. Daher war es das Ziel der Dissertation in einem kombinierten
experimentellen Versuchsansatz aus In-vivo-, Ex-vivo-, In-vitro- und In-silico-
Untersuchungen, neu entwickelte Hydrogele als Nukleusersatz im Tiermodell Schaf
zu untersuchen und das Schaf als Tiermodell im Bereich der Bandscheibenforschung
näher zu charakterisieren.
Um ein physiologisches Lastprotokoll für die In-vitro-Untersuchungen zu etablieren,
wurde an drei Schafen der intradiskale Druck (IDP) über je 24 Stunden gemessen.
Der gesamte Datenpool des ersten Schafes wurde in eine Aktivitäts- und
Erholungsphase unterteilt und ex vivo aus den IDP-Durchschnittswerten beider
Phasen die entsprechenden axialen Kompressionskräfte abgeleitet. In vitro wurde
ein Kriech-Relaxations-Test an 36 ovinen lumbalen Bewegungssegmenten
durchgeführt. Die Segmente wurden drei Belastungszyklen ausgesetzt, die jeweils
aus einer 15-minütigen Belastungsphase (130 N) und einer 30-minütigen
Erholungsphase (58 N) bestanden. IDP-Verlauf und Höhenverlust der Segmente
wurden in sechs verschiedenen Versuchsgruppen untersucht: (i) INTAKT;
(ii) DEF-AN: Eine schräge Anulusinzision. Der Defekt wurde durch Naht und
Cyanoacrylatkleber verschlossen. (iii) DEF-NUKn+k: Nukleusgewebe wurde entfernt
und anschließend reimplantiert. Der Anulusverschluss erfolgte wie in DEF-AN.
(iv) DEF-NUKp: Entsprechend dem Vorgehen in Testgruppe DEF-NUKn+k wurde der
Nukleus entfernt und reimplantiert. Um eine Volumenverdrängung reimplantierten
Gewebes in den inneren Anulusdefekt zu vermeiden, erfolgte der Verschluss mittels
eines Plugs. Abschließend wurden zwei Hydrogele als Nukleusersatz untersucht:
(v) DDAHA und (vi) iGG-MA. Zur besseren Interpretation der In-vitro-Ergebnisse
wurden Finite-Elemente-Analysen an einem Bandscheibenmodell durchgeführt.
In vivo lag der Bandscheibendruck beim Schaf nahezu konstant höher als beim
Menschen. Niedrigste Druckwerte wurden intraoperativ mit ~0,5 MPa ermittelt.
Höchste Druckwerte wurden für Aufstehen oder Drehen mit 3,6 bzw. 2,6 MPa
gemessen und waren damit ungefähr zwei- bis viermal höher in der ovinen
Bandscheibe. Die IDP-Mittelwerte der Aktivitäts- und Erholungsphasen des ersten
Schafes lagen bei ~0,75 bzw. ~0,5 MPa, welche axialen Kompressionskräften von
130 bzw. 58 N entsprachen. Im Kriech-Relaxations-Test hatte ein isolierter
Anulusdefekt (DEF-AN) keinen Einfluss auf Höhenverlust und IDP der Segmente.
DEF-NUKn+k, DEF-NUKp, DDAHA und iGG-MA hingegen steigerten den
Höhenverlust und verringerten signifikant den IDP im Vergleich zu INTAKT. Die
Modellvorhersagen belegten erhebliche Auswirkungen eines reduzierten
Wassergehalts, Kompressionsmoduls und osmotischen Potentials des
reimplantierten Gewebes auf den Höhenverlust und IDP des Segmentes. Die
Lastübertragung innerhalb der Bandscheibe veränderte sich hierdurch deutlich und
ging mit einer erhöhten Belastung des Anulus einher.
Die vergleichsweise hohen Bandscheibendrücke des Schafes stehen der weit
verbreiteten Meinung gegenüber, dass aufgrund der horizontal ausgerichteten
Wirbelsäule des Vierbeiners, intradiskale Lasten geringer sein müssten als beim
Menschen. In Kenntnis der vorliegenden Untersuchungen sollte die Rechtfertigung
bzw. der Ausschluss des Schafes als Modell im Bereich der Wirbelsäule nicht auf
Unterschieden im Gang begründet werden, sondern auf mechanischen
Überlegungen bzgl. künftiger Einsatzgebiete. Die In-vitro-Ergebnisse zeigen