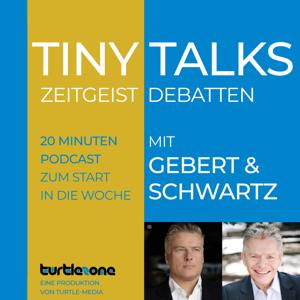Identitätspolitische Aktivisten reklamieren für sich oft die Interessenvertretung ganzer Kollektive, denn Herkunft, Geschlecht, Rasse und Hautfarbe oder Religion werden kollektiv verstanden und ideologisch regelmäßig stark betont. Plötzlich geht es nicht mehr um tatsächlichen Rassismus in Sport und Kultur, sondern bestimmte Sportarten, wie der Wintersport, oder auch Musikstile, wie die klassische Musik, werden per se als rassistisch verortet. In der Kunstszene werden sogar dediziert antirassistisch motivierte Bilder von Künstlern abgehangen. Es werden Yoga-Kurse mit dem Vorwurf des Identitätsraubs boykottiert und protestiert gegen Schauspielerinnen und Schauspieler, die in Film und Fernsehen oder im Theater Rollen von schwulen, lesbischen oder transsexuellen Charakteren übernehmen. Und auch die Hautfarbe eines Synchronsprechers oder einer Übersetzerin scheint im Kontext der Identitätsideologie wieder eine große Rolle zu spielen. Im universitären Umfeld nimmt die Identitätspolitik einen immer größeren Raum ein, hat aber auch längst den Mainstream erfasst. Es lohnt sich, mit den Motivationen und Argumenten der Aktivistinnen und Aktivisten auseinanderzusetzen, denn deren Forderungen erfolgen meist im Namen von wichtigen Werten wie Anti-Rassismus, Religion, Feminismus oder Minderheitenrechte. Und dennoch stellen viele Menschen befremdet fest, dass nicht primär die Gleichberechtigung oder der Abbau von noch existierenden Benachteiligungen im Vordergrund der Ideologie steht, sondern die Interessen und der Einfluß einer einzelnen, vermeintlich homogenen, Gruppen. Derzeit scheint es, dass der Dialog schwieriger wird und Lautstärke sowie Kompromisslosigkeit eine konstruktive Debatte verhindern.