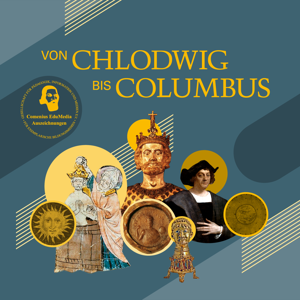Zum Inhalt: In den 1220er Jahren wurde im Süden Frankreichs, im Languedoc, ein neues kirchliches Untersuchungsverfahren eingeführt, mit dem ohne vorherige Anklage eine Untersuchung der Rechtgläubigkeit der Bewohner einzelner Regionen möglich wurde. Die Untersuchung – Inquisition – wurde von bestellten Inquisitoren, meist Dominikanermönchen, nach einem festen Fragenkatalog durchgeführt und protokolliert. Im Laufe der Zeit kamen verschiedene Zwangsmittel (Folter) bei der Befragung hinzu. Das Strafmaß reichte von einfachen Bußübungen bis hin zur Todesstrafe – dabei wurde die Häresie als Hochverrat gegen die göttliche Majestät (crimen laesae majestatis) behandelt. Damit trat die Inquisition als aktive Verfolgung Andersgläubiger in die Geschichte ein. Der mittelalterliche Start war noch verhalten, aber sie sollte noch eine lange Geschichte vor sich haben.
Beschlüsse der Synode von Toulouse, in: K.-V. Selge (Hg.): Texte zur Inquisition (Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte 4), Gütersloh 1967, S. 30–35 (lat.).