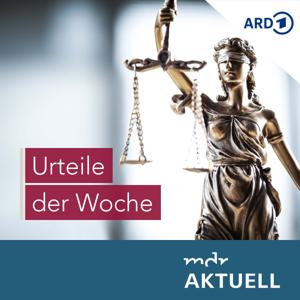Harte Strafen, blinde Vergeltung? Oder gilt für straffällig gewordene Jugendliche auch ein Erziehungsgedanke, der das Alter und die Reife berücksichtigt? Das deutsche Gesetz aus dem Jahr 1923 war vorbildlich und fortschrittlich – und wurde deshalb in der Nazizeit wieder zurückgenommen. 1943 ist im Reichsjugendgesetz wieder zu lesen: "Die Straftat eines Jugendlichen wird mit Strafe oder mit Zuchtmitteln geahndet". Auch galten in besonderen Fällen schon Kinder ab zwölf Jahren als strafmündig. Einige der mühsam erstrittenen Fortschritte des Jugendstrafgesetzes, das zwanzig Jahre zuvor in der Weimarer Republik eingeführt wurde, wurden zunichte gemacht. Das erste Jugendgerichtsgesetz von 1923, war viel differenzierter und zugewandter formuliert. Es ist die Rede davon, dass ein Gericht zu prüfen habe, "ob Erziehungsmaßregeln erforderlich sind". Dieses Gesetz für jugendliche Straftäter galt als Fortschritt – auch das Alter der Strafmündigkeit wurde auf 14 Jahre heraufgesetzt. Erst 1953 wurde das Gesetz in der Bundesrepublik wieder aufgegriffen. Bis dahin war noch die nationalsozialistische Terminologie zu finden. Die Debatte aber zwischen Befürwortern des Erziehungsgedanken und jenen, die harte Strafen fordern flackert in der Öffentlichkeit immer wieder auf.





 View all episodes
View all episodes


 By SR
By SR