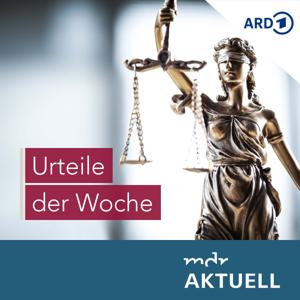Heute ist sie schlicht die deutsch-polnische Grenze. Und sie ist offen, zwei befreundete EU-Staaten auf beiden Seiten. Aber die Oder-Neiße-Linie war lange ein rotes Tuch, auch für heimatvertriebene Deutsche. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs bedeutet die neue Oder-Neiße-Grenze für zehn Millionen Deutsche Flucht und Vertreibung aus Schlesien und Ostpreußen. Polen wird nach Westen verschoben. Doch 1989, nach dem Fall der Berliner Mauer, werden die Karten neu gemischt. Die endgültige Grenzziehung zwischen Polen und Deutschland sei, so die Bestimmung der Alliierten von 1945, einem deutsch-polnischen Friedensvertrag vorbehalten. Dass die DDR die Oder-Neiße-Linie bereits 1950 als Grenze anerkannt hat, reichte da nicht aus. Die Regierung unter Kanzler Kohl zieht Ende 1990 nach: mit der Unterzeichnung des deutsch-polnischen Grenzvertrags. Das ist der Preis für die deutsche Vereinigung. Dann aber klagen Heimatvertriebene gegen den Grenzvertrag. Er sei, so ihre Überzeugung, verfassungswidrig. Denn er verletze ihre Eigentumsrechte und erkenne die Enteignungen deutschen Bodens nach 1945 als rechtens an. Sie ziehen bis vor das Bundesverfassungsgericht. Doch die Richter weisen die Klage ab. Dank dieses Urteils können die Polen ihre Angst vor einem vereinigten starken Deutschland, das die Rückgabe ihrer einstigen Ostgebiete einfordere, ad acta legen.





 View all episodes
View all episodes


 By SR
By SR