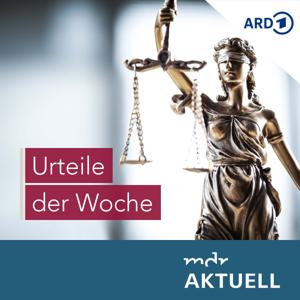Den "Parsifal" umgibt eine fast heilige Aura: Richard Wagner selbst nannte sein letztes Werk nicht Oper, sondern "Bühnenweihfestspiel". Kunst wird hier zur neuen Religion - das andächtig ergriffene Publikum sollte nicht einmal klatschen. Mit dem mittelalterlichen Parzival-Stoff hatte sich Richard Wagner schon in den 1840er Jahren befasst. Bereits in seinem "Lohengrin" taucht die Figur des Gralskönigs auf. Doch erst 1882 kam »Parsifal« im Bayreuther Festspielhaus zur Welt. Richard Wagner (und auch seinen Nachkommen) war dieses Werk so wichtig, dass sie sogar verfügten, der "Parsifal" dürfe nur im Festspielhaus aufgeführt werden. Opernhäuser und Sänger, die das Verdikt umgingen, wurden vom Wagner-Clan mit ewiger Verbannung aus Bayreuth gestraft. Fast wäre der "Parsifal" aber Richard Wagners erste amerikanische Oper geworden. Während der Fertigstellung der ersten Orchesterskizzen und nach der finanziellen Pleite mit dem "Ring" plante Wagner seine Emigration in die USA – den "Parsifal" wollte er mitnehmen. Im Stück spielt Wagner mit Symbolen und Motiven der christlichen Religion, die rituelle Speisung der Gralsritter ist dem Abendmahl verdächtig ähnlich. Der "reine Tor" Parsifal wird "durch Mitleid wissend" und erlöst den siechen Gralshüter Amfortas und mit ihm gleich eine ganze kranke Gesellschaft. Wagnerfreund Friedrich Nietzsche schäumte: Für ihn war Richard Wagner mit seinem letzten Werk zu Kreuze gekrochen. Doch Wagner zielte weiter, auf eine neue Kunst als Religionsersatz. Seine Jünger wollten es gern glauben und verboten gar Applaus nach dem ersten Aufzug.





 View all episodes
View all episodes


 By SR
By SR