
Sign up to save your podcasts
Or




Hier ist der Link zum ersten Kapitel des Sachstandsberichts.
Was macht Österreich besonders?
Österreich nimmt aufgrund seiner Geografie eine besondere Stellung in Europa ein. Zwei Drittel des Landes sind von Gebirgen geprägt. Diese topografische Vielfalt bringt sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen mit sich. So reichen die Jahresmitteltemperaturen in verschiedenen Regionen von minus sechs bis plus zwölf Grad. In einem Land dieser Größe ist das außergewöhnlich. Gleichzeitig treten extreme Unterschiede auf – von Schneefall im Hochgebirge bis zu heißen Sommertagen in Tieflagen. Die Folge: Österreich reagiert besonders empfindlich auf klimatische Veränderungen.
Der doppelte Temperaturanstieg
Besonders deutlich zeigt sich das am Anstieg der mittleren Lufttemperatur. Während die globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung um etwa 1,6 Grad gestiegen ist, beträgt die Erwärmung in Österreich bereits 3,1 Grad. Diese Erwärmung betrifft nicht nur das Flachland, sondern ist auch in mittleren Höhenlagen über 500 Meter sehr deutlich zu beobachten. Auch die Zahl tropischer Nächte – Nächte, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt – hat zugenommen. Österreich liegt also schon jetzt über dem globalen Mittel und wird laut Projektionen auch in Zukunft stets etwas stärker betroffen sein. Selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt würde, müsste Österreich mit rund zwei Grad Erwärmung rechnen. Bei zwei Grad globaler Erwärmung liegt die erwartete Erwärmung in Österreich bei etwa 2,6 Grad. Eine Faustregel, die der Bericht vorschlägt, lautet: Die österreichische Erwärmung beträgt etwa das 1,3-Fache der globalen Erwärmung – ein Verhältnis, das mit hoher wissenschaftlicher Sicherheit („High Confidence“) angenommen wird.
Unsicherheiten beim Niederschlag
Im Gegensatz zur Temperatur ist die Entwicklung des Niederschlags schwieriger vorherzusagen. Der Bericht geht davon aus, dass sich der Winterniederschlag erhöhen wird, während es im Sommer tendenziell trockener wird – besonders in den östlichen Landesteilen. Diese Projektionen basieren auf komplexen Modellen, die aufgrund der kleinräumigen Topografie Österreichs nur begrenzt genaue Aussagen auf lokaler Ebene zulassen. Gleichzeitig nimmt die Intensität kurzer, heftiger Niederschlagsereignisse zu – insbesondere zwischen Mai und September. Dies passt zur erhöhten Verdunstung durch steigende Temperaturen.
Wasserhaushalt unter Druck
Ein Thema, das Österreich besonders betrifft, ist der Wasserhaushalt. Durch die steigende Verdunstung in Folge höherer Temperaturen verlieren Flüsse und Seen zunehmend an Wasser. Besonders betroffen ist beispielsweise der Neusiedler See, der in den Jahren 2021 und 2022 stark unter Trockenheit litt. Obwohl der durchschnittliche Niederschlag in manchen Regionen sogar zugenommen hat, reicht das nicht aus, um die Verluste durch Verdunstung auszugleichen. Der Bericht betont, dass gleichbleibende Abflussmengen in Flüssen nicht automatisch bedeuten, dass sich der Wasserhaushalt nicht verändert hat – es kann sich auch der Prozess verändert haben, der zu diesen Mengen führt.
Ein interessanter Punkt in der Diskussion ist der Zusammenhang zwischen Niederschlagsveränderungen und Flutrisiken. In der östlichen Hälfte Österreichs hat sich die Saison für Überschwemmungen bereits verschoben: Während früher der Winter die Hochwassersaison war, treten heute häufiger Sommerfluten auf. Die Veränderungen sind jedoch regional sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich auch deutlich in Abbildung 1.12 des Berichts, die die erwarteten Veränderungen von Hoch- und Niedrigwasserereignissen in verschiedenen Regionen Österreichs visualisiert:
Gletscher in Österreich: Ein Abschied auf Raten
Besonders drastisch sind die Veränderungen bei den Gletschern. Seit 1969 hat Österreich rund 40 Prozent seiner Gletschermasse verloren. Der Bericht geht davon aus, dass eine nahezu vollständige Entgletscherung bis zum Ende des Jahrhunderts als nahezu sicher („virtually certain“) gilt – selbst bei Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. In diesem Szenario würden nur noch maximal sechs Prozent der heutigen Gletschermasse übrig bleiben. Diese Entwicklung wird in Abbildung 1.10 eindrucksvoll visualisiert:
Die projizierten Kurven der Gletschermasse sinken unter allen betrachteten Erwärmungsszenarien steil ab.
Naturgefahren im Wandel
Die Klimakrise verändert auch die Naturgefahrenlage in Österreich. Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände, Erdrutsche und Steinschläge nehmen zu oder werden zumindest intensiver. Der Bericht listet eine Vielzahl dieser Risiken in einer übersichtlichen Darstellung auf (Abbildung 1.18) und zeigt, welche Gefahren zunehmen, gleichbleiben oder eventuell sogar abnehmen könnten – wobei echte Entlastungen kaum zu erwarten sind:
Besonders betroffen sind Regionen mit steilen Hängen, dort nehmen durch häufigere Extremniederschläge auch die Risiken für Murenabgänge und andere gravitative Naturgefahren zu. Wer sich näher mit diesen Themen befassen möchte, findet in Kapitel 1.7 und Abbildung 1.17 eine ausführliche Übersicht über die verschiedenen Typen von Erdrutschprozessen und deren klimatische Auslöser.
Burning Embers: Risiken grafisch greifbar
Auch im AAR2 treffen wir die „Burning Embers“ – die Balkendiagramme, die das Risiko bestimmter Auswirkungen in Abhängigkeit vom Erwärmungsgrad zeigen. In Cross-Chapter Box 1, Abbildung 3, werden verschiedene Risikobereiche – etwa Hitzetote, Arbeitskraftverlust, Ernteausfälle oder Schneemangel – farblich gestaffelt dargestellt:
Die Farben reichen von Weiß (kaum Risiko) über Gelb und Rot bis zu Dunkelviolett (sehr hohes Risiko). Besonders eindrucksvoll ist, wie schnell das Risiko in bestimmten Bereichen ansteigt. So steigt beispielsweise das Risiko für hitzebedingte Gesundheitsprobleme bereits bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad in den hohen Bereich. Gleichzeitig zeigen sich abrupte Übergänge – etwa beim Ernteverlust, wo das Risiko bei etwa 2,5 Grad plötzlich deutlich steigt.
Das Diagramm enthält auch eine zweite Skala, die die jeweiligen Auswirkungen bei der österreichischen Durchschnittstemperatur abbildet – ein sehr hilfreiches Detail, da Österreich sich schneller erwärmt als der globale Durchschnitt.
Transparenz-Hinweis
Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt.
Live Shows
Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.
Werbung und Unterstützung
Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.
Kontakt und weitere Projekte
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an [email protected]. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.
Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.
Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.
Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:
Instagram Florian| Facebook Florian|
TikTok Claudia
Bluesky Florian|
Mastodon Florian|
Blog Florian|
 View all episodes
View all episodes


 By Florian Freistetter, Claudia Frick
By Florian Freistetter, Claudia Frick




5
11 ratings

Hier ist der Link zum ersten Kapitel des Sachstandsberichts.
Was macht Österreich besonders?
Österreich nimmt aufgrund seiner Geografie eine besondere Stellung in Europa ein. Zwei Drittel des Landes sind von Gebirgen geprägt. Diese topografische Vielfalt bringt sehr unterschiedliche klimatische Bedingungen mit sich. So reichen die Jahresmitteltemperaturen in verschiedenen Regionen von minus sechs bis plus zwölf Grad. In einem Land dieser Größe ist das außergewöhnlich. Gleichzeitig treten extreme Unterschiede auf – von Schneefall im Hochgebirge bis zu heißen Sommertagen in Tieflagen. Die Folge: Österreich reagiert besonders empfindlich auf klimatische Veränderungen.
Der doppelte Temperaturanstieg
Besonders deutlich zeigt sich das am Anstieg der mittleren Lufttemperatur. Während die globale Durchschnittstemperatur seit Beginn der Industrialisierung um etwa 1,6 Grad gestiegen ist, beträgt die Erwärmung in Österreich bereits 3,1 Grad. Diese Erwärmung betrifft nicht nur das Flachland, sondern ist auch in mittleren Höhenlagen über 500 Meter sehr deutlich zu beobachten. Auch die Zahl tropischer Nächte – Nächte, in denen es nicht unter 20 Grad abkühlt – hat zugenommen. Österreich liegt also schon jetzt über dem globalen Mittel und wird laut Projektionen auch in Zukunft stets etwas stärker betroffen sein. Selbst wenn die globale Erwärmung auf 1,5 Grad begrenzt würde, müsste Österreich mit rund zwei Grad Erwärmung rechnen. Bei zwei Grad globaler Erwärmung liegt die erwartete Erwärmung in Österreich bei etwa 2,6 Grad. Eine Faustregel, die der Bericht vorschlägt, lautet: Die österreichische Erwärmung beträgt etwa das 1,3-Fache der globalen Erwärmung – ein Verhältnis, das mit hoher wissenschaftlicher Sicherheit („High Confidence“) angenommen wird.
Unsicherheiten beim Niederschlag
Im Gegensatz zur Temperatur ist die Entwicklung des Niederschlags schwieriger vorherzusagen. Der Bericht geht davon aus, dass sich der Winterniederschlag erhöhen wird, während es im Sommer tendenziell trockener wird – besonders in den östlichen Landesteilen. Diese Projektionen basieren auf komplexen Modellen, die aufgrund der kleinräumigen Topografie Österreichs nur begrenzt genaue Aussagen auf lokaler Ebene zulassen. Gleichzeitig nimmt die Intensität kurzer, heftiger Niederschlagsereignisse zu – insbesondere zwischen Mai und September. Dies passt zur erhöhten Verdunstung durch steigende Temperaturen.
Wasserhaushalt unter Druck
Ein Thema, das Österreich besonders betrifft, ist der Wasserhaushalt. Durch die steigende Verdunstung in Folge höherer Temperaturen verlieren Flüsse und Seen zunehmend an Wasser. Besonders betroffen ist beispielsweise der Neusiedler See, der in den Jahren 2021 und 2022 stark unter Trockenheit litt. Obwohl der durchschnittliche Niederschlag in manchen Regionen sogar zugenommen hat, reicht das nicht aus, um die Verluste durch Verdunstung auszugleichen. Der Bericht betont, dass gleichbleibende Abflussmengen in Flüssen nicht automatisch bedeuten, dass sich der Wasserhaushalt nicht verändert hat – es kann sich auch der Prozess verändert haben, der zu diesen Mengen führt.
Ein interessanter Punkt in der Diskussion ist der Zusammenhang zwischen Niederschlagsveränderungen und Flutrisiken. In der östlichen Hälfte Österreichs hat sich die Saison für Überschwemmungen bereits verschoben: Während früher der Winter die Hochwassersaison war, treten heute häufiger Sommerfluten auf. Die Veränderungen sind jedoch regional sehr unterschiedlich. Dies zeigt sich auch deutlich in Abbildung 1.12 des Berichts, die die erwarteten Veränderungen von Hoch- und Niedrigwasserereignissen in verschiedenen Regionen Österreichs visualisiert:
Gletscher in Österreich: Ein Abschied auf Raten
Besonders drastisch sind die Veränderungen bei den Gletschern. Seit 1969 hat Österreich rund 40 Prozent seiner Gletschermasse verloren. Der Bericht geht davon aus, dass eine nahezu vollständige Entgletscherung bis zum Ende des Jahrhunderts als nahezu sicher („virtually certain“) gilt – selbst bei Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels. In diesem Szenario würden nur noch maximal sechs Prozent der heutigen Gletschermasse übrig bleiben. Diese Entwicklung wird in Abbildung 1.10 eindrucksvoll visualisiert:
Die projizierten Kurven der Gletschermasse sinken unter allen betrachteten Erwärmungsszenarien steil ab.
Naturgefahren im Wandel
Die Klimakrise verändert auch die Naturgefahrenlage in Österreich. Hitzewellen, Starkregen, Waldbrände, Erdrutsche und Steinschläge nehmen zu oder werden zumindest intensiver. Der Bericht listet eine Vielzahl dieser Risiken in einer übersichtlichen Darstellung auf (Abbildung 1.18) und zeigt, welche Gefahren zunehmen, gleichbleiben oder eventuell sogar abnehmen könnten – wobei echte Entlastungen kaum zu erwarten sind:
Besonders betroffen sind Regionen mit steilen Hängen, dort nehmen durch häufigere Extremniederschläge auch die Risiken für Murenabgänge und andere gravitative Naturgefahren zu. Wer sich näher mit diesen Themen befassen möchte, findet in Kapitel 1.7 und Abbildung 1.17 eine ausführliche Übersicht über die verschiedenen Typen von Erdrutschprozessen und deren klimatische Auslöser.
Burning Embers: Risiken grafisch greifbar
Auch im AAR2 treffen wir die „Burning Embers“ – die Balkendiagramme, die das Risiko bestimmter Auswirkungen in Abhängigkeit vom Erwärmungsgrad zeigen. In Cross-Chapter Box 1, Abbildung 3, werden verschiedene Risikobereiche – etwa Hitzetote, Arbeitskraftverlust, Ernteausfälle oder Schneemangel – farblich gestaffelt dargestellt:
Die Farben reichen von Weiß (kaum Risiko) über Gelb und Rot bis zu Dunkelviolett (sehr hohes Risiko). Besonders eindrucksvoll ist, wie schnell das Risiko in bestimmten Bereichen ansteigt. So steigt beispielsweise das Risiko für hitzebedingte Gesundheitsprobleme bereits bei einer globalen Erwärmung von zwei Grad in den hohen Bereich. Gleichzeitig zeigen sich abrupte Übergänge – etwa beim Ernteverlust, wo das Risiko bei etwa 2,5 Grad plötzlich deutlich steigt.
Das Diagramm enthält auch eine zweite Skala, die die jeweiligen Auswirkungen bei der österreichischen Durchschnittstemperatur abbildet – ein sehr hilfreiches Detail, da Österreich sich schneller erwärmt als der globale Durchschnitt.
Transparenz-Hinweis
Die Podcastfolgen zum Zweiten Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel sind in Zusammenarbeit mit dem Koordinationsteam des AAR2 entstanden und wurde vom Klima- und Energiefonds finanziell unterstützt.
Live Shows
Tickets für die Sternengeschichten Live Tour 2025 von Florian gibt es unter sternengeschichten.live.
Werbung und Unterstützung
Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.
Kontakt und weitere Projekte
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an [email protected]. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.
Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.
Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.
Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:
Instagram Florian| Facebook Florian|
TikTok Claudia
Bluesky Florian|
Mastodon Florian|
Blog Florian|

47 Listeners

11 Listeners

13 Listeners

5 Listeners

48 Listeners

15 Listeners

22 Listeners
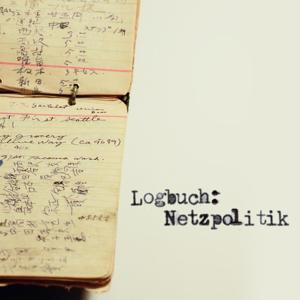
6 Listeners

11 Listeners
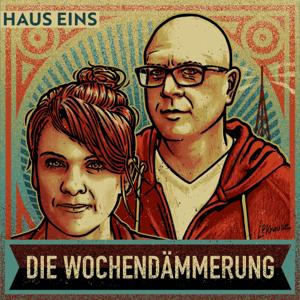
12 Listeners

15 Listeners

10 Listeners

12 Listeners

7 Listeners

8 Listeners