
Sign up to save your podcasts
Or




DK145: Energie, Arbeit, Rohstoffe: Wie wird das Versorgungssystem klimafreundlich?
Und: Wo erholen wir uns in der Klimakrise?
"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.
In Folge 145 geht es um viel. Nämlich einerseits um fast alles, was in Österreich so produziert wird. Aber auch um andere Sachen, die wichtig für uns sind, zum Beispiel Erholung, Tourismus und Arbeit. Und weil das alles mit Energie zu tun hat, schauen wir uns die komplette Energieversorgung von Österreich auch noch an.
Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.
Hier ist der Link zum vierten Kapitel des Sachstandsberichts.
Die Struktur des Versorgungssystems
Ein zentraler Lösungsansatz ist die Kreislaufwirtschaft. Studien zeigen, dass durch verstärktes Recycling von Stahl, Aluminium und Plastik bis zu 56 % der CO2-Emissionen in der Schwerindustrie eingespart werden könnten. Auch Sharing-Modelle wie Carsharing und Coworking können zur Reduktion beitragen. Eine umfassende Umstellung auf Kreislaufwirtschaft würde nicht nur Emissionen senken, sondern auch Ressourcen schonen.
In einer österreichischen Studie wurden vier Szenarien analysiert, wie sich bis 2040 der Gebäudesektor, der Transport und die Stromerzeugung dekarbonisieren lassen – je nach wirtschaftlichem Wachstum und politischer Ambition. Nur das ambitionierteste Szenario, das unter anderem keine neuen Straßen oder Gebäude auf unbebautem Land vorsieht, führt zu einer deutlichen Reduktion der Emissionen, wie Abbildung 4.5 zeigt.
Tourismus im Klimawandel
Der Tourismus ist für Österreich ein bedeutender Wirtschaftssektor – rund 7,5 % des BIP hängen direkt oder indirekt davon ab. Gleichzeitig verursacht Tourismus erhebliche Emissionen, vor allem durch Transport. Österreich ist ein sogenanntes „Net Origin Country“: Die Emissionen durch Auslandsreisen der Österreicher:innen sind höher als jene der ausländischen Tourist:innen im Inland.
Die Klimakrise bedroht den tourismusrelevanten Naturraum: Wintertourismus leidet unter Schneemangel, Sommerhitze beeinträchtigt den Städtetourismus, und zunehmender Starkregen sowie veränderte Wasserqualität in Seen könnten weitere Auswirkungen haben. Mögliche Strategien zur Anpassung sind z. B. längere Aufenthalte statt häufiger Kurzreisen, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nachhaltiger Hotelbetrieb.
Einige praktische Ideen: Hotels könnten Bahnreisen bewerben oder Rabatte für klimafreundliche Anreisen anbieten. Viele österreichische Hotels nutzen bereits heute überdurchschnittlich viel erneuerbare Energie – 54 % im Vergleich zu 34 % im nationalen Durchschnitt. Dennoch ist der Wintertourismus besonders gefährdet, da technologische Anpassungen wie Schneekanonen oft nicht mehr ausreichen werden.
Industrie und Herstellung
Österreich hat eine energieintensive Industrie mit hohem Anteil an Metall- und Papierproduktion. Zwar wird moderne, effiziente Technologie eingesetzt, der Gesamtenergiebedarf bleibt jedoch hoch. Besonders in der Stahlproduktion bestehen durch den Einsatz von Wasserstoff oder Recycling („Sekundärstahl“) Potenziale zur Emissionsminderung. Der Umbau erfordert allerdings große Investitionen und neue Energiequellen.
Das Energiesystem Österreichs
Der Anteil fossiler Energieträger am Energiemix ist in Österreich zwar leicht gesunken – von 75 auf 66 % – doch besonders beim Gasverbrauch gab es kaum Fortschritte. Wind- und Solarenergie haben stark zugelegt, vor allem durch den Ausbau von Biomasse, Windkraft und Photovoltaik. Trotzdem besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf, insbesondere im Verkehrssektor, der nach wie vor stark von Öl abhängig ist.
Windkraft gilt als besonders verlässlich und saisonal gut abgestimmt. Dennoch ist der Ausbau sehr ungleich verteilt: Über 800 von ca. 1400 Windrädern stehen in Niederösterreich, während es in Westösterreich (Tirol, Salzburg, Vorarlberg) gar keine gibt. Der Hauptgrund sind fehlende politische Vorgaben und mangelnde Akzeptanz auf Landesebene – nicht etwa geografische Einschränkungen.
Der Bericht betont, dass Österreichs Energieinfrastruktur ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung ist. Investitionen von 6 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr wären notwendig, um bis 2040 ein CO2-neutrales System zu etablieren. Hindernisse sind vor allem mangelnder politischer Wille, fragmentierte Gesetzgebung und geringe gesellschaftliche Akzeptanz.
Ein unerwarteter, aber wichtiger Aspekt in Kapitel 4 ist die Rolle von Arbeit im Kontext der Klimakrise. Der Bericht unterscheidet zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit (z. B. Pflege, Ehrenamt) und untersucht, wie beide mit Emissionen, Mobilität und gesellschaftlicher Transformation zusammenhängen.
90 % der österreichischen Bevölkerung sind in unbezahlte Care-Arbeit eingebunden, aber nur rund 50 % in bezahlte Erwerbsarbeit. Frauen übernehmen dabei den Großteil der unbezahlten Tätigkeiten. Zugleich sind viele Erwerbstätige überfordert: 17 bis 30 % fühlen sich als „over-employed“ – sie würden gerne weniger arbeiten. Dies beeinflusst auch die Bereitschaft, sich für Klimaschutz zu engagieren.
Arbeit beeinflusst Mobilität: Etwa 50 % der in Österreich zurückgelegten Wege stehen in Zusammenhang mit Arbeit. Menschen, die „grüne“ Arbeitsplätze haben oder deren Unternehmen Umweltbewusstsein leben, engagieren sich häufiger für Nachhaltigkeit. Umgekehrt fällt es Menschen mit belastenden Arbeitsbedingungen oder wenig Kontrolle schwerer, klimafreundlich zu handeln.
Der Bericht fordert daher strukturelle Veränderungen: Arbeitszeitverkürzung, bessere Bezahlung und Sichtbarkeit für Care-Arbeit, Förderung von grüner Beschäftigung sowie eine Verlagerung von Arbeit näher an Wohnorte. Gewerkschaften könnten als Akteure für Klimagerechtigkeit gestärkt werden, etwa durch Schutz vor Hitzebelastung oder faire Arbeitsbedingungen in der Transformation. Auch hier lautet das zentrale Fazit: Nur durch eine bewusste Umgestaltung von Arbeit wird der Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft gelingen.
.
Transparenz-Hinweis
Werbung und Unterstützung
Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.
Kontakt und weitere Projekte
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an [email protected]. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.
Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.
Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.
Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:
Instagram Florian| Facebook Florian|
TikTok Claudia
Bluesky Florian|
Mastodon Florian|
Blog Florian|
 View all episodes
View all episodes


 By Florian Freistetter, Claudia Frick
By Florian Freistetter, Claudia Frick




5
11 ratings

DK145: Energie, Arbeit, Rohstoffe: Wie wird das Versorgungssystem klimafreundlich?
Und: Wo erholen wir uns in der Klimakrise?
"Das Klima”, der Podcast zur Wissenschaft hinter der Krise. Wir lesen und erklären den aktuellen Österreichischen Sachstandsbericht zum Klimawandel.
In Folge 145 geht es um viel. Nämlich einerseits um fast alles, was in Österreich so produziert wird. Aber auch um andere Sachen, die wichtig für uns sind, zum Beispiel Erholung, Tourismus und Arbeit. Und weil das alles mit Energie zu tun hat, schauen wir uns die komplette Energieversorgung von Österreich auch noch an.
Wer den Podcast unterstützen will, kann das gerne tun: https://steadyhq.com/de/dasklima/ und https://www.paypal.me/florianfreistetter.
Hier ist der Link zum vierten Kapitel des Sachstandsberichts.
Die Struktur des Versorgungssystems
Ein zentraler Lösungsansatz ist die Kreislaufwirtschaft. Studien zeigen, dass durch verstärktes Recycling von Stahl, Aluminium und Plastik bis zu 56 % der CO2-Emissionen in der Schwerindustrie eingespart werden könnten. Auch Sharing-Modelle wie Carsharing und Coworking können zur Reduktion beitragen. Eine umfassende Umstellung auf Kreislaufwirtschaft würde nicht nur Emissionen senken, sondern auch Ressourcen schonen.
In einer österreichischen Studie wurden vier Szenarien analysiert, wie sich bis 2040 der Gebäudesektor, der Transport und die Stromerzeugung dekarbonisieren lassen – je nach wirtschaftlichem Wachstum und politischer Ambition. Nur das ambitionierteste Szenario, das unter anderem keine neuen Straßen oder Gebäude auf unbebautem Land vorsieht, führt zu einer deutlichen Reduktion der Emissionen, wie Abbildung 4.5 zeigt.
Tourismus im Klimawandel
Der Tourismus ist für Österreich ein bedeutender Wirtschaftssektor – rund 7,5 % des BIP hängen direkt oder indirekt davon ab. Gleichzeitig verursacht Tourismus erhebliche Emissionen, vor allem durch Transport. Österreich ist ein sogenanntes „Net Origin Country“: Die Emissionen durch Auslandsreisen der Österreicher:innen sind höher als jene der ausländischen Tourist:innen im Inland.
Die Klimakrise bedroht den tourismusrelevanten Naturraum: Wintertourismus leidet unter Schneemangel, Sommerhitze beeinträchtigt den Städtetourismus, und zunehmender Starkregen sowie veränderte Wasserqualität in Seen könnten weitere Auswirkungen haben. Mögliche Strategien zur Anpassung sind z. B. längere Aufenthalte statt häufiger Kurzreisen, Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder nachhaltiger Hotelbetrieb.
Einige praktische Ideen: Hotels könnten Bahnreisen bewerben oder Rabatte für klimafreundliche Anreisen anbieten. Viele österreichische Hotels nutzen bereits heute überdurchschnittlich viel erneuerbare Energie – 54 % im Vergleich zu 34 % im nationalen Durchschnitt. Dennoch ist der Wintertourismus besonders gefährdet, da technologische Anpassungen wie Schneekanonen oft nicht mehr ausreichen werden.
Industrie und Herstellung
Österreich hat eine energieintensive Industrie mit hohem Anteil an Metall- und Papierproduktion. Zwar wird moderne, effiziente Technologie eingesetzt, der Gesamtenergiebedarf bleibt jedoch hoch. Besonders in der Stahlproduktion bestehen durch den Einsatz von Wasserstoff oder Recycling („Sekundärstahl“) Potenziale zur Emissionsminderung. Der Umbau erfordert allerdings große Investitionen und neue Energiequellen.
Das Energiesystem Österreichs
Der Anteil fossiler Energieträger am Energiemix ist in Österreich zwar leicht gesunken – von 75 auf 66 % – doch besonders beim Gasverbrauch gab es kaum Fortschritte. Wind- und Solarenergie haben stark zugelegt, vor allem durch den Ausbau von Biomasse, Windkraft und Photovoltaik. Trotzdem besteht weiterhin hoher Handlungsbedarf, insbesondere im Verkehrssektor, der nach wie vor stark von Öl abhängig ist.
Windkraft gilt als besonders verlässlich und saisonal gut abgestimmt. Dennoch ist der Ausbau sehr ungleich verteilt: Über 800 von ca. 1400 Windrädern stehen in Niederösterreich, während es in Westösterreich (Tirol, Salzburg, Vorarlberg) gar keine gibt. Der Hauptgrund sind fehlende politische Vorgaben und mangelnde Akzeptanz auf Landesebene – nicht etwa geografische Einschränkungen.
Der Bericht betont, dass Österreichs Energieinfrastruktur ein zentraler Hebel zur Dekarbonisierung ist. Investitionen von 6 bis 11 Milliarden Euro pro Jahr wären notwendig, um bis 2040 ein CO2-neutrales System zu etablieren. Hindernisse sind vor allem mangelnder politischer Wille, fragmentierte Gesetzgebung und geringe gesellschaftliche Akzeptanz.
Ein unerwarteter, aber wichtiger Aspekt in Kapitel 4 ist die Rolle von Arbeit im Kontext der Klimakrise. Der Bericht unterscheidet zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit (z. B. Pflege, Ehrenamt) und untersucht, wie beide mit Emissionen, Mobilität und gesellschaftlicher Transformation zusammenhängen.
90 % der österreichischen Bevölkerung sind in unbezahlte Care-Arbeit eingebunden, aber nur rund 50 % in bezahlte Erwerbsarbeit. Frauen übernehmen dabei den Großteil der unbezahlten Tätigkeiten. Zugleich sind viele Erwerbstätige überfordert: 17 bis 30 % fühlen sich als „over-employed“ – sie würden gerne weniger arbeiten. Dies beeinflusst auch die Bereitschaft, sich für Klimaschutz zu engagieren.
Arbeit beeinflusst Mobilität: Etwa 50 % der in Österreich zurückgelegten Wege stehen in Zusammenhang mit Arbeit. Menschen, die „grüne“ Arbeitsplätze haben oder deren Unternehmen Umweltbewusstsein leben, engagieren sich häufiger für Nachhaltigkeit. Umgekehrt fällt es Menschen mit belastenden Arbeitsbedingungen oder wenig Kontrolle schwerer, klimafreundlich zu handeln.
Der Bericht fordert daher strukturelle Veränderungen: Arbeitszeitverkürzung, bessere Bezahlung und Sichtbarkeit für Care-Arbeit, Förderung von grüner Beschäftigung sowie eine Verlagerung von Arbeit näher an Wohnorte. Gewerkschaften könnten als Akteure für Klimagerechtigkeit gestärkt werden, etwa durch Schutz vor Hitzebelastung oder faire Arbeitsbedingungen in der Transformation. Auch hier lautet das zentrale Fazit: Nur durch eine bewusste Umgestaltung von Arbeit wird der Wandel zu einer klimafreundlichen Gesellschaft gelingen.
.
Transparenz-Hinweis
Werbung und Unterstützung
Ein kleiner Hinweis: In “Das Klima” gibt es keine Werbung. Wenn ihr Werbung hört, dann liegt das nicht an uns; dann hat jemand unerlaubt und ohne unser Wissen den Podcast-Feed kopiert und Werbung eingefügt. Wir machen keine Werbung - aber man kann uns gerne was spenden, geht auch bei PayPal.
Kontakt und weitere Projekte
Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, dann schickt uns einfach eine Email an [email protected]. Alle Folgen und alle Shownotes findet ihr unter https://dasklima.fm.
Florian könnt ihr in seinem Podcast “Sternengeschichten” zuhören, zum Beispiel hier: https://sternengeschichten.podigee.io/ oder bei Spotify - und überall sonst wo es Podcasts gibt. Außerdem ist er auch noch regelmäßig im Science Busters Podcast und bei WRINT Wissenschaft”-Podcast zu hören (den es ebenfalls bei Spotify gibt). Mit der Astronomin Ruth Grützbauch veröffentlicht er den Podcast “Das Universum”.
Claudia forscht und lehrt an der TH Köln rund um Wissenschaftskommunikation und Bibliotheken und plaudert im Twitch-Stream “Forschungstrom” ab und an über Wissenschaft.
Ansonsten findet ihr uns in den üblichen sozialen Medien:
Instagram Florian| Facebook Florian|
TikTok Claudia
Bluesky Florian|
Mastodon Florian|
Blog Florian|

47 Listeners

11 Listeners

13 Listeners

5 Listeners

48 Listeners

15 Listeners

22 Listeners
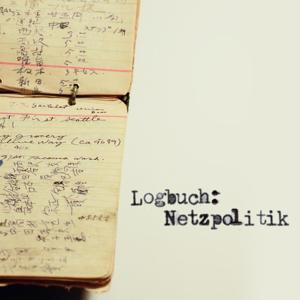
6 Listeners

11 Listeners
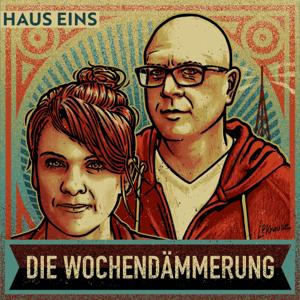
12 Listeners

15 Listeners

10 Listeners

12 Listeners

7 Listeners

8 Listeners