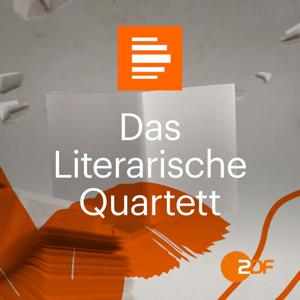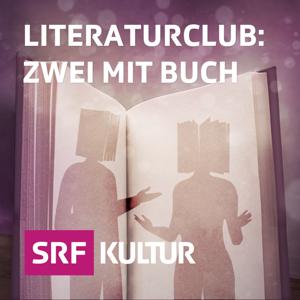Das Gedenken an die Opfer der Franco-Diktatur spaltet bis heute die spanische Gesellschaft: Viele wollen von der Vergangenheit nichts mehr wissen, andere suchen immer weiter nach Massengräbern, so erst vor kurzem in Valencia. Der Schatten der Vergangenheit ist nicht zu tilgen.
Der Diktator zu Pferde
Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass es 2007 erst eines Regierungsdekrets gegen die Verherrlichung Francisco Francos bedurfte, damit die Reiterdenkmäler – der Generalisimo auf einem stolzen Gaul, in Bronze gegossen – aus dem öffentlichen Raum verschwanden. Neun solcher Skulpturen wurden einst im ganzen Land aufgestellt und dienten seiner Glorifizierung als „Retter Spaniens“.
Kein anderer Diktator des 20. Jahrhunderts hat sich so häufig auf dem Rücken eines Pferdes verewigen lassen wie Franco.
Quelle: Julia Schulz-Dornburg – Wohin mit Franco? Das Unbehagen in der spanischen Erinnerungskultur
Schreibt die Autorin und Architektin Julia Schulz-Dornburg in ihrem Buch Wohin mit Franco? Das Unbehagen in der spanischen Erinnerungskultur. Sie lebt in Barcelona und hat es geschafft, diese Denkmäler in diversen Depots aufzuspüren.
Anlass für ihre Nachforschungen und dieses Buch war eine Ausstellung des Born-Museums in Barcelona, bei der sie 2016 eine Statue Francos öffentlich ausgestellt hat. Sie löste heftige Reaktionen bei der Bevölkerung aus, wurde mit Graffitis bemalt und mit Farbe übergossen, so dass sie nach vier Tagen entfernt werden musste.
Eine traumatische Erfahrung
Das war für mich eine so traumatische Erfahrung, dass ich als Gegengift eine Reise durch ganz Spanien unternahm, um herauszufinden, was mit den anderen Reiterdenkmälern des Diktators geschehen war.
Quelle: Julia Schulz-Dornburg – Wohin mit Franco? Das Unbehagen in der spanischen Erinnerungskultur
Bei deren Abtransport wurden einige von ihnen reichlich ramponiert, ein Bein oder ein Arm war abgefallen, der Kopf ging meist verloren. Danach wurden sie in den hintersten Ecken von Depots „entsorgt“, Ross und Reiter getrennt. Doch es gab auch noch intakte Stücke, beispielsweise bei der Armee.
Die riesige Metallkiste beherrscht etwas theatralisch die Szene. Die Zuschauer, viele in Tarnanzug und Kampfstiefeln, mit Barett und Sonnenbrille, unterbrechen ihre Gespräche, als die Arbeiter anfangen, das Material zu entfernen, das den Reiter bedeckt. Von seinem Leichentuch befreit, reitet Franco hinter Gittern. Er wirkt eher eingesperrt als geschützt.
Quelle: Julia Schulz-Dornburg – Wohin mit Franco? Das Unbehagen in der spanischen Erinnerungskultur
Verehrung eines Sockels
Mit ironischem Blick beschreibt Julia Schulz-Dornburg mitunter ihre Besichtigungen beispielsweise auch eines Sockels, von dem der Reiter abgeräumt wurde, und den zeitweise unverbesserliche Franco-Anhänger wie eine Kultstätte verehrten.
Geradezu obsessiv ist die Autorin den einzelnen Spuren nachgegangen und hat sie ausführlich dokumentiert. Dabei war es noch relativ unkompliziert, die Aufenthaltsorte der Franco-Statuen ausfindig zu machen.
Verglichen mit den Formalitäten, die für ihre Besichtigung erforderlich waren. Die Verhandlungen mit den Institutionen, die die Statuen verwahren (nationale Denkmalbehörden, Armee, Stiftungen und Stadtverwaltungen) zogen sich über mehr als ein Jahr.
Quelle: Julia Schulz-Dornburg – Wohin mit Franco? Das Unbehagen in der spanischen Erinnerungskultur
Alle denkbaren öffentlichen Verhaltensweisen hat Julia Schulz-Dornburg dabei erlebt: vom totalen Schweigen, über die schroffe Ablehnung bis zur freundlichen Zusage der Genehmigung.
Ein spannendes Reisetagebuch ist das Ergebnis ihrer Nachforschungen: reich illustriert mit Fotos ihrer heimlichen oder erlaubten Inspektionen der skulpturalen Überbleibsel der Franco-Diktatur.





 View all episodes
View all episodes


 By SWR
By SWR