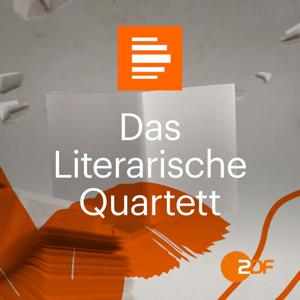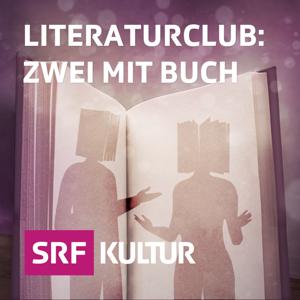Er ist allgegenwärtig auf den Philippinen. Das freundlich forschende Gesicht von José Rizal blickt Besuchern von Büsten, Bildern, Denkmälern und Geldscheinen entgegen. Straßen und Plätze, Krankenhäuser und Schulen sind nach ihm benannt. Der Historiker Ambeth Ocampo, der ein vieldiskutiertes Buch über Rizal geschrieben hat, kann erklären, warum der Schriftsteller so verehrt wird.
Er sagt: „Seine Schriften halfen den Filipinos zu verstehen, wer sie waren und was sie sein sollten. Bevor wir überhaupt eine Nation wurden, hatten wir einen Helden, der sich eine Nation vorstellte. Er erlebte die Freiheit und Unabhängigkeit der Philippinen nicht mehr, aber es sind im Grunde seine Ideen und seine Schriften, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind.“
Ein „krebskrankes Land“
José Rizal wurde 1896 von der spanischen Kolonialmacht in Manila hingerichtet. Mit 35 Jahren. Man warf ihm „Anstiftung zur Rebellion“ vor. Die Spanier beriefen sich dabei auf seine Schriften und vor allem auf den Roman, der sein berühmtester ist und Pflichtlektüre an philippinischen Schulen: „Noli Me Tangere“ – „Rühr mich nicht an“. Was im Buch angerührt wird, sind die Gegebenheiten im Land.
Rizal beschreibt die Philippinen unter spanischer Herrschaft als „krebskrank“. Das war das Ketzerische und Gefährliche. Hauptfigur ist der junge, idealistische Ibarra, der nach sieben Jahren in Europa mit großen Plänen in seine Heimat zurückkehrt. Er will seine Jugendliebe Maria Clara heiraten, vor allem aber die einfachen Menschen unterstützen und sein Land voranbringen.
Sein Plan ist es, eine Schule zu gründen, in der Bauernkinder mehr lernen als nur Gebete aufzusagen und sich vor dem Rohrstock zu fürchten. Ibarra rechnet nicht mit dem machtvollen, von Priestern angeführten Widerstand. Obwohl er von einem Freund gewarnt wird.
Um dieses Unternehmen durchzuführen, nützen Wollen und Geld allein nichts, in unserem Land erfordert es außerdem Selbstverleugnung, Stehvermögen und Vertrauen. Der Boden ist nicht vorbereitet, es wurde nur Unrat auf ihm gesät.
Quelle: José Rizal – Noli Me Tangere
Mord, Betrug und Hinterlist
José Rizal erzählt eine veritable Abenteuergeschichte, mit allem, was dazugehört: Intrigen, Folter, Mord, Betrug und Hinterlist, es gibt Helden und Schurken. Zuweilen wirkt das etwas konstruiert, um die Spannung hochzuhalten, müssen viele Zufälle helfen. Das eigentlich Interessante an dem Roman ist nicht die Story, auf die Rizal, so scheint es, selbst nicht besonders viel Wert gelegt hat.
Es sind die einprägsamen, präzise gezeichneten und zuweilen parodistisch überzeichneten Charaktere, für die der Autor zurecht bis heute gefeiert wird. Mächtige, eigensüchtige Patres, korrumpierte Beamte und inkompetente Milizionäre bestimmen nach Gutdünken über die einfachen Menschen im Land. Aber José Rizal ging es nicht nur darum, zynische Eliten und dysfunktionale Machtverhältnisse bloßzustellen. Sein Anspruch, „alles der Wahrheit zu opfern“, reichte weiter.
Das meint auch Ambeth Ocampo: „Wenn man den Roman genauer liest, wird deutlich, dass er zwar vordergründig das Kolonialsystem attackiert. Aber es geht auch um die Kolonialisierten, die nicht befreit werden wollen, deren Denk- und Gefühlswelten kolonialistisch sind. Es ist eine Mentalität, die sich schwer verändern lässt. Rizal zeigt den Menschen im Land: ‚So seid ihr‘.
Und er fragt: ‚Was werdet ihr sein, wenn das Kolonialsystem abgeschafft wird? Werdet ihr so schlecht sein, wie dieses System? Oder werdet ihr etwas Besseres schaffen?‘“
Andauernde Relevanz
In seinem berühmten Roman gibt José Rizal darauf keine Antwort. Für Ambeth Ocampo liegt gerade darin das Geheimnis seiner andauernden Relevanz. Amtsmissbrauch, Korruption und Patronage gibt es bis heute auf den Philippinen. Man kann es sich leicht machen und einzig auf die langen Jahre des Kolonialismus verweisen. Im Sinne von José Rizal wäre das sicher nicht.





 View all episodes
View all episodes


 By SWR
By SWR