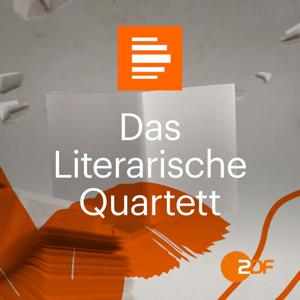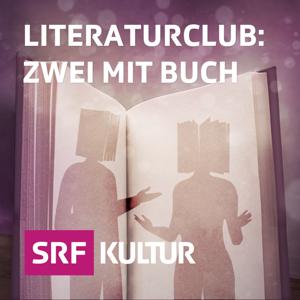Kann eine KI der Menschheit helfen, sich selbst zu retten? Auf diese Idee sind Politiker in Tom Hillebrands „Hologrammatica“-Reihe Mitte des 21. Jahrhunderts gekommen: Der Supercomputer Æther sollte Maßnahmen entwickeln, um den Klimawandel aufzuhalten.
Er ist eine künstliche Intelligenz – und zwar wirklich intelligent, nicht eines der Sprachlernmodelle, die gegenwärtig als KI firmieren.
„Sie hat ein Bewusstsein, sie hat Erinnerungen, sie hat einen Sense of Self, sie hat Theory of Mind, das heißt, sie kann also auch antizipieren, was denken denn andere Menschen eigentlich, was fühlen andere Lebewesen, und kann dies auch alles einsetzen, um langfristig zu planen und Strategien zu entwickeln, um eigene Ziele auch zu verwirklichen“, erzählt Tom Hillenbrand.
Eine KI, die selbständig handelt
Deshalb war Æther auch so klug zu wissen, dass die Menschen seine radikalen Maßnahmen niemals umsetzen würden. Also handelte er selbständig: Setzte ein Virus in die Welt, kopierte sich selbst auf leistungsstarke Quantencomputer, breitete sich im Datagrid aus.
Doch die Menschen bekamen mit, dass sie – nicht zum ersten Mal – etwas entwickelt haben, was sie nicht verstehen.
Wenn eine KI erst einmal da ist, liegt die weitere Zukunft jenseits unseres Vorstellungsvermögens. Genauso wenig wie Ameisen abschätzen können, was für Auswirkungen Albert Einsteins Gedanken haben werden, können Menschen sich ausmalen, was eine superintelligente KI tun könnte.
Quelle: Tom Hillenbrand – Hologrammatica
Dieses Szenario ist der Ausgangspunkt der Reihe, die im Jahr 2088 einsetzt – und es ist ein treffender Verweis auf die Gegenwart, in der viele Menschen mit Begriffen und Anwendungen hantieren, die sie nicht verstehen.
„Da kann man sich sagen, okay, das ist den Leuten halt egal, weil es convenient ist. Das ist natürlich nur Teil der Erklärung. Ich glaube, ein ganz wichtiger Teil ist auch, dass wir häufig sehr gerne Verantwortung abgeben“, so Hillenbrand.
„Das hat natürlich auch so eine politische Entlastungsfunktion, dass die Entscheider sagen können, also nicht wir bürden euch das auf, sondern die Maschine sagt, das muss so sein. Und das ist ein Satz, den wir in Zukunft, glaube ich, noch sehr oft hören werden.“
In der Romanwelt haben die Menschen die Kontrolle über Æther verloren. Sie wollen ihn abschalten. Aber superintelligente KIs lassen sich nicht so einfach abschalten:
Der Rechner hatte vorgesorgt und versucht nun seinerseits innerhalb der drei bisher erschienenen Bände, die Kontrolle über die Menschheit zu bekommen. Um sie zu retten, meint Æther. Um sie zu zerstören, meinen andere.
Eine Wissenschaftlerin verschwindet
In Hillenbrands Zukunftswelt ist die Erde größtenteils nicht mehr bewohnbar. Vieles ist verfallen, nur die Technologie schreitet voran: Statt Internet gibt es das Grid, ein hochleistendes globales Datennetz, in dem das sogenannte Holonet läuft: Ein Netzwerk von holographischen Projektionen, die Objekte, Texturen oder auch ein Aussehen erschaffen.
Längst haben auch einige Menschen, sogenannte Quandts, ihr Gehirn digitalisieren lassen: Aus dem Organ wird eine Art kleiner Computer, den sie in jede beliebige Hülle einsetzen können.
Dieses Zukunftsszenario verbindet Hillebrand mit aus Spannungsliteratur bekannten Erzählmustern: In „Hologrammatica“ bekommt ein Privatdetektiv den Auftrag, eine verschwundene Wissenschaftlerin zu suchen.
Der zweite Teil „Qube“ ist stärker als Thriller aufgezogen: Verschiedene Parteien machen Jagd auf den titelgebenden Qube, ein Kästchen, in dem ein weiterer Supercomputer steckt. Und im 2025 erschienenen dritten Teil „Thanatopia“ wird in Wien in der Donau die Leiche einer Frau angeschwemmt.
Eigentlich Routine für Kommissar Wenzel Landauer. Doch dann gibt es eine weitere Leiche, die exakt so aussieht wie die erste tote Frau.
An der Polizeihochschule hatte man ihnen seinerzeit erzählt, in Zukunft werde es praktisch keine Morde mehr geben – zu viele Kameras, zu viele digitale Spuren, zu viele DNA-Sniffer. Heute jedoch wusste Wenzel: Das war Schmarrn gewesen.
Quelle: Tom Hillenbrand –Thanatopia
„Ich glaube, dass die Krimi-Handlung es den Leuten viel einfacher macht in ein Genre wie die Science-Fiction, das ihnen vielleicht nicht so geläufig ist, reinzukommen“, erläutert der Autor.
Zu diesen vertrauten Erzählmustern kommen kulturelle Anker: Der Privatdetektiv lernt Saxophon mit einem Hologramm von John Coltrane. Es gibt viele Bezüge zur griechischen Mythologie.
Referenzen auf Jules Verne, im dritten Teil erscheint Æther sogar in einem menschlichen Avatar wie Kapitän Nemo. Das funktioniert. Außerdem steht im Mittelpunkt der Handlung stets ein Mensch, dessen Gehirn noch nicht digitalisiert ist.
Darf man ungestraft einen Klon töten?
„Das ist natürlich ein narrativer Griff, weil ich kann ja auch nicht davon ausgehen, dass die Leser im Zweifelsfall alle Bände gelesen haben. Die sind ja auch so als Stand-alone im Prinzip lesbar. Und jemand, der das nicht so gut versteht, wie denn das jetzt funktioniert mit dieser neuen Technologie, der kann das natürlich dem Leser, der es auch nicht so gut versteht, besser nahebringen oder erklären.“
Damit sich die Bücher eigenständig lesen lassen, kommt es zu Redundanzen: Stets wird noch einmal erklärt, warum die Welt ist, wie sie ist und wie wichtige Technologien funktionieren. Für diejenigen, die alle Bände kennen, gibt es immerhin ein Wiedersehen mit bekannten Figuren.
Auch wird im Verlauf der Reihe die Künstliche Intelligenz wie die schwarz-weißen Muster auf den Covern immer raffinierter: Im ersten Teil sichert Æther sein Überleben, im zweiten Teil beginnt er zunehmend, das Bewusstsein der Menschen zu kontrollieren. Und in „Thanatopia“ nimmt er es mit dem Tod auf.
Man lebt. Man stirbt. Das sind die Optionen.«
»Nicht mehr.«
Quelle: Tom Hillenbrand –Thanatopia
Hillenbrand greift interessante Fragen auf. Kleinere wie beispielsweise: Wenn man einen Klon tötet, ist es dann Sachbeschädigung oder Mord? Aber auch: Was passiert nach dem Tod?
Verpackt in gute Unterhaltung, oft sehr nah an der Realität. Genau das macht diese Romane, die vor allem vom Plot, den Dialogen und gelegentlichem Humor leben, so interessant.
Schafft es denn die KI, die Menschheit zu retten? Eine eindeutige Antwort liefern die Romane nicht. Noch sind die Menschen am Leben. Aber Hillenbrand macht auch sehr deutlich, zu welchem Preis. Technologiefeindlich oder gar pessimistisch sind die Romane und Tom Hillenbrand dennoch nicht.
„Wir malen uns das immer so aus, dass alles immer schlimmer wird. Aber wir wissen natürlich in Wahrheit gar nicht wie die Gesellschaft als Ganzes auf dieses dauernde Fake und dieses Hypervirtuelle am Ende reagiert.“
Chancen und Herausforderungen
Er ist überzeugt: In der Technologie stecken Chancen – aber eben auch große Herausforderungen.
„Aber was ich extrem beunruhigend finde, dass wir hier eine Technologie haben, die eigentlich der gesamten Menschheit gehören müsste, die auch aus dem Wissensschatz der gesamten Menschheit gebaut wird, dass die kontrolliert wird von einer sehr kleinen Gruppe von Leuten.
Und zwar teilweise von Personal, das deckungsgleich ist mit den Typen, die das mit Social Media komplett versemmelt haben. Diese Leute haben jetzt die Kontrolle über künstliche Intelligenz. Wie ist das gegangen? Das muss man sich mal fragen. Und was kann man dagegen tun?“





 View all episodes
View all episodes


 By SWR
By SWR