
Sign up to save your podcasts
Or




Es gilt als ein statisches Wunder und als triumphales Bauwerk, selbst ein halbes Jahrhundert nach seiner Erbauung: visionär, radikal modern, offen - das Münchner Olympiastadion. Organisch eingefügt in eine künstlich geschaffene, natürlich anmutende Landschaft. Von Susanne Hofmann (BR 2022)
Credits
Autorin: Susanne Hofmann
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Thomas Birnstiel, Ruth Geiersberger, Peter Veit
Technik: Susanne Harasim
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview: Stefan Behnisch, Prof. Fritz Auer
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025
Besonderer Linktipp der Redaktion:
BR: Tatort Geschichte – True Crime meets History
Bei Tatort Geschichte verlassen Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit: eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, der junge Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. True Crime aus der Geschichte unterhaltsam besprochen. Im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. "Tatort Geschichte" ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie. ZUM PODCAST
Linktipps
SWR (2024): Die Olympischen Spiele 1972 – Münchens Sommertragödie
München wollte 27 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues Deutschland präsentieren - heiter und offen. Doch die Terroranschläge machten aus dem Sportfest eine Tragödie. Von Michael Kuhlmann (SWR 2022) JETZT ANHÖREN
ARD alpha (2024): Das Münchener Olympiastadion
Nach dem Hofbräuhaus ist das Olympiastadion von 1972 Münchens berühmtestes Gebäude - und kunsthistorisch das wohl bedeutendste. Warum eigentlich? Was hat das spektakuläre Netz aus Stahl und Glas mit Seifenblasen zu tun? Was mit Demokratie? Und wie kam Architekt Frei Otto auf diese Verbindung von Baukunst und Ingenieurstechnik? Ein junger Kunsthistoriker geht diesen Fragen auf den Grund. Er entdeckt das Bauwerk für uns neu und zeigt so, was das Stadion zu einem Meilenstein gemacht hat. JETZT ANSEHEN
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
MUSIK
ERZÄHLERIN
Es ist Ende Oktober 1965 – aus dem Radio singen die Rolling Stones ihren Nummer Eins-Hit „I can’t get no satisfaction“, in Bonn ist Ludwig Erhard gerade zum zweiten Mal zum Bundeskanzler gewählt worden, und im Münchner Rathaus bekommt der Oberbürgermeister der Stadt München, Hans-Jochen Vogel, Besuch: Besuch von Willi Daume, einer Schlüsselfigur im Sport und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Er stellt dem Oberbürgermeister eine große Frage:
1a. ZUSPIELUNG Fritz Auer 00.50
„Sitzen Sie fest auf ihrem Stuhl? Und Vogel hat ihn gefragt, ja, wie meinen Sie das – politisch oder komfortabelmäßig? Und hat gesagt, Herr Vogel, wie wär’s, wenn Sie sich bewerben würden für die Austragung der Olympischen Spiele in München 1972!? Puh - Vogel hat einmal durchgeschnauft, da sagt er, da brauch ich ein bisschen Zeit … Vier Tage nur hat er gebraucht … und dann hat er gesagt okay, wir bewerben uns.“
ERZÄHLER
So ging damals die Erzählung, erinnert sich der Architekt Fritz Auer. Die Zeit drängt, die Bewerbungsfrist läuft in nur zwei Monaten ab. Innerhalb weniger Tage bringt Hans-Jochen Vogel den Münchner Stadtrat hinter seine Entscheidung, München bewirbt sich offiziell für die Olympischen Spiele und – erhält den Zuschlag. Die Ausschreibung zum Bau des Olympiageländes mitsamt dem Stadion gewinnt ein Architekturbüro aus Stuttgart: Behnisch und Partner. Sie haben bis dahin eher überschaubare Projekte geleitet – Landratsämter, Schulen und Kindergärten gebaut. Mitbegründer des Büros ist der Architekt Fritz Auer.
MUSIK
ERZÄHLERIN
Was in den Jahren darauf folgt, ist die Realisierung eines kühnen architektonischen Entwurfs, ein gewaltiger gemeinsamer Kraftakt und längst prägender Teil der Geschichte der Stadt München und der jungen Bundesrepublik. In München sieht man dem Bau mit Selbstbewusstsein und Zuversicht entgegen. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel:
1b. ZUSPIELUNG Vogel
„Es handelt sich sowohl der Funktion als auch dem Bauvolumen nach um eines der größten Bauvorhaben, das in unserer Stadt in diesem Jahrhundert abgewickelt wird. (…) Wenn wir es vernünftig machen, wenn wir uns von Übertreibungen freihalten, wenn wir, wie der Bundeskanzler es sagte, all unseren Gästen, die zu uns kommen, menschlich und freundlich begegnen, dann glaube ich in der Tat, dass die Bundesrepublik einen großen ideellen Nutzen davon haben kann.“
ERZÄHLER
Dabei ist die Ausgangslage auf den ersten Blick eher bescheiden. Zunächst einmal: München hat keine einzige olympiataugliche Sportstätte. Auch die Infrastruktur steckt noch in den Kinderschuhen - der Mittlere Ring, heute eine Hauptverkehrs-Ringstraße, ist noch lange nicht fertig, der Bau der ersten U-Bahn hat erst begonnen. Und als der Olympia-Architekt Fritz Auer, damals Mitte 30, sich ein Bild von München macht, ist er zunächst nicht besonders begeistert:
2. ZUSPIELUNG Fritz Auer
„Ich fand die Stadt schrecklich - gegenüber Stuttgart erst mal eben und grau, kein Baum, gar nichts. So war mein erster Eindruck.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Doch München ist eine aufstrebende, junge Stadt, regiert vom einst jüngsten Oberbürgermeister Europas, Hans-Jochen Vogel. Fast die Hälfte der Stadtbevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Siemens hatte sich nach dem Krieg hier angesiedelt, genauso wie das Messe- und Verlagswesen und die Filmindustrie. Die Stadt wächst rasant und die Aussicht auf die Olympiade beflügelt den Aufschwung. Die Stimmung der Zeit ist geprägt von Fortschrittsglaube und Optimismus, der parteiübergreifend wirkt. Daran erinnert sich auch der Architekt Stefan Behnisch, der Sohn des Architekten Günther Behnisch, der den Olympia-Bau plante und leitete.
3. ZUSPIELUNG Stefan Behnisch SB 22.35
„Politisch gab es eine Allianz zwischen Vogel, Strauß und Brandt - die Figuren kann ich mir heute überhaupt nicht in einem Raum vorstellen. Ja, aber die haben das gemeinsam getragen. Und das hat dem Projekt den Rücken gestärkt. Auch die Stimmung damals, die Aufbruchsstimmung, mehr Demokratie wagen… und man war auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die eben dieses Bittere überwinden konnte. Und die 50er und 60er-Jahre waren ja bitter. Teilweise ungeheuer spießig. Und ich glaube, diese Stimmung hat viel getragen, … In Rekordzeit hat München damals Ungeheures geleistet, ihre Stadt für die Zukunft fit gemacht. Und heute zehrt die Stadt noch davon.“
MUSIK
ERZÄHLER
Die Austragung der Spiele gab München und ganz Deutschland die Chance, sich der Welt nach dem verheerenden, von Deutschland angezettelten Weltkrieg neu zu präsentieren. Es galt, das preußisch-militärische Image Deutschlands zu überwinden. Das Olympiagelände mit seinen Sportstätten sollte für die junge Demokratie stehen, eine klare Abkehr von den Berliner Olympischen Spielen von 1936 mit ihrem auftrumpfenden Nationalismus und ihren Bauten, die Macht und Größe des Deutschen Reiches demonstrierten. Das neu zu errichtende Münchner Stadion sollte die Visitenkarte des gewandelten Deutschlands werden – ebenfalls ein Gegenentwurf zum monumentalen Berliner Stadion. Es herrschte, so der Olympia-Architekt Fritz Auer…
4. ZUSPIELUNG Fritz Auer FA2 30.25
„…einfach der absolute Wille der Politiker und des Olympischen Komitees: Wir wollen dieses Zeitdokument für eine junge Demokratie - fast egal, was es kostet.“
ERZÄHLERIN
Heiter sollten die Spiele und ihre Bauten sein, leicht, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch und frei von Ideologie.
5. ZUSPIELUNG Auer 3:58
„Es gab Leitlinien für die sogenannte Ausschreibung des Wettbewerbs, also die Aufgabenstellung. Und da waren drei Begriffe genannt: Spiele der kurzen Wege, Spiele im Grünen also, sprich Landschaft und Verbindung von Sport und Kunst.“
ERZÄHLER
All das verkörperte der Entwurf der Architekten Behnisch und Partner aus Stuttgart. Er sah eine Art Voralpenlandschaft vor, hügelig mit einem See, künstlich geschaffen auf dem drei Quadratkilometer großen Areal Oberwiesenfeld, Brachfläche und früherer Flugplatz, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Und, durchaus symbolträchtig: Der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg sollte begrünt und zum Olympiaberg transformiert werden. Die Sportstätten sollten in das Gelände eingebettet werden und ihre Dimension so bescheidener wirken. Oder, in den Worten von Willi Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees:
5b. ZUSPIELUNG Daume
„Die Lösung ist trotz der gebotenen Größenordnung so, dass immer ein menschliches Maß gewahrt ist. … Ich möchte es mal ganz kühn sagen: Die Landschaft, so wie sie dort entsteht, entspricht fast der von Olympia. Es wird eine großartige Bereicherung nicht nur der Stadt München, nicht nur der deutschen Architektur sein, sondern alle Ausländer, die nach hier kommen, werden sich hier wohl fühlen, es ist eine ideale Stätte der Begegnung, auch mit der Münchner Bevölkerung – wir sind hochzufrieden.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit allerding beherrschte schon bald das geplante Olympiastadion, genauer: sein Dach. Eine Zeltdachkonstruktion, wie man sie noch nie gesehen hatte. Leicht und transparent, wie ein riesiges, freischwebendes Spinnennetz. Davon waren Politik und Öffentlichkeit fasziniert. Fritz Auer:
6. ZUSPIELUNG Auer FA1 20:21
„Weil diese Konstruktion, diese sogenannten leichten Flächentragwerke … sehr immateriell wirken, also eigentlich wie ne Wolke über einer statischen Landschaft - wenn man‘s in Musik ausdrücken würde, wär die Landschaft der Kontrabass und das Dach wär die Oberstimme dazu - und die Oberstimme ist was Leichtes. Die schwingt und tut und bindet alles zusammen.“
MUSIK
ERZÄHLER
Vorbild und Inspiration für das Zeltdach war der deutsche Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal 1967 – ein Werk des Architekten Frei Otto. Eine Weltneuheit, die Staunen erregte: Den Pavillon überwölbte ein Dach von rund 8.000 Quadratmetern, bestehend aus einem Seilnetz mit einer darunter gespannten weißen Folie. So leicht und luftig war bisher kein Gebäude überdacht worden.
ERZÄHLERIN
In München aber war die Fläche fast zehn Mal so groß. 75.000 Quadratmeter sollte das Zeltdach hier überspannen, in etwa die Fläche von acht Fußballfeldern. Denn die Schwimmhalle und die Sporthalle mussten überdacht werden, im Stadion mindestens die Hälfte der Zuschauerplätze, zudem die dazwischenliegenden Wege im Olympiapark. Niemals zuvor war so eine Konstruktion realisiert worden.
ERZÄHLER
Schon das Modell des Stadions war unkonventionell. Die Architekten hatten sich dafür einfacher Materialien bedient – Sägemehl zum Modellieren der Landschaft, Zahnstocher als Dachstützen und für das Zeltdach: Nylonstrümpfe von Fritz Auers Frau.
7. ZUSPIELUNG Auer 24:34
„Der Damenstrumpf hat Ähnlichkeit zum späteren Seilnetz in seiner Verformungsart. … und der Damenstrumpf von meiner Frau, der war so fleischfarben, fürchterlich sah das aus, das spätere Modell, … da haben wir dann Strumpfrohlinge von Firma Hözen, … die haben damals uns Rohlinge, also weiße, geliefert für das Wettbewerbsmodell, so sah’s dann besser aus später.“
ERZÄHLERIN
Die Pläne zeichneten die Architekten von Hand und mit einfachen Hilfsmitteln, erinnert sich Fritz Auer.
8. ZUSPIELUNG Auer FA1 18:40
„Es gab den Rechenschieber, es gab noch keinen Taschenrechner, also noch keinen elektronischen Rechner, … die Riesenanlagen, das musste alles gezeichnet werden - die Grundrisse, Schnitte, alles im Maßstab eins zu 200, das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Stadion - Umgriff ist dann immerhin also etwa einen halben Meter breit und ein Meter über die Länge gemessen. Das musste man alles mit Stangenzirkeln zeichnen, jede Sitzreihe - alles wurde per Hand noch gemacht.“
ERZÄHLER
Monatelang rangen Architekten und Ingenieure darum, ob und wie man diesen kühnen Entwurf der Zeltdach-Landschaft überhaupt umsetzen könnte. Das Dach würde sich ständig mit dem Wind bewegen, quasi atmen – wie konnte man trotzdem seine Standfestigkeit gewährleisten? Wie sollte das Dach den Schneemassen trotzen und seine Form behalten?
MUSIK
ERZÄHLERIN
Der Leichtbau-Experte Frei Otto hatte dann die Idee, das Stadiondach in mehrere Segmente zu unterteilen und so den Bau zu ermöglichen. Für die Stadionüberdachung kam erstmals ein Computer zum Einsatz. Zur Berechnung der Kräfteverhältnisse schrieb ein Informatiker extra ein Programm – Neuland auch hier. Stefan Behnisch:
9. ZUSPIELUNG SB 00:15
„Es war eine Gleichung - nach der Erzählung meines Vaters - mit über einer Million Unbekannten. Weil jeder Knoten ja vorberechnet sein musste… da wir hier über ein sphärisches Netz sprechen, nicht über ein glattes, elastisches Netz, sondern ein starres, sphärisches Netz, mussten die es genau so vorberechnen. Wenn das am Boden liegt, lag es ja wie ein Leintuch in Falten, und da mussten die aber jeden Knoten im Prinzip auf einen Millimeter genau richtig verankern und schrauben. Denn wenn das dann hochgezogen wird, durfte ja nicht eine Überbelastung an einer Stelle sein, das musste ja alles stimmen.“
ERZÄHLER
Die Berechnungen stimmten, das Seilnetz wurde erfolgreich aufgerichtet, die knapp 80 Meter hohen Pylonen im Boden verankert. Zunächst hoffte man, dass das Dach 15 Jahre halten würde. Doch es erweist sich als beständiger als vermutet – bis heute sind nur kleinere Reparaturen angefallen. Erst nach einem Vierteljahrhundert mussten die Dachplatten ausgetauscht werden, sie waren milchig geworden. Die scheinbare Leichtigkeit des Daches war allerdings schwer erkauft, erklärt der Architekt Fritz Auer.
10. ZUSPIELUNG FA2 34.20
„Diese sogenannte leichten Flächentragwerke sind gar nicht so leicht. Denn die Abspann-Kräfte müssen ja irgendwo hingehen, und die gehen in riesige Fundamente, das Randseil vom Stadion hat Fundamente von einer Größe von dreigeschossigen Häusern an beiden Enden. 4.000 Tonnen sind da drin an Vorspannung, und die mussten in die Erde, und man sollte das möglichst wenig sehen, damit diese leichte, luftige Wolke entsteht.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Ausgeklügelte Ingenieurskunst, eine Pionierleistung – und doch war es dem Olympia-Architekten Günther Behnisch ein Dorn im Auge, dass das Dach so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, wie er in einem Radio-Interview 1972 darlegte.
11. ZUSPIELUNG Günther Behnisch
„Es ist nicht das Wesentlichste unseres Entwurfes. Wir haben hier eine olympische Landschaft geschaffen, in dieser Landschaft treffen sich und verknoten sich die markantesten Punkte und Aktivitäten dieser Gegend – Fernsehturm, Wasser, Berg Hügel, Fußgängerwege – … und ein Teil dieser Anlage muss überdeckt werden.“
ERZÄHLER
Günther Behnischs Sohn Stefan ergänzt 50 Jahre später: Für seinen Vater sei das Dach notwendiges Übel gewesen, hatte lediglich dienende Funktion: Nämlich die Menschen zu schützen, die sich in der olympischen Landschaft aufhalten.
12. ZUSPIELUNG SB 17:37
„Er hätte sich ein Klima in Deutschland gewünscht, das erlaubt, Olympische Spiele ohne Dächer zu machen, aber es geht halt nicht… Er hätte gut ohne das Dach leben können. Aber wenn ein Dach, dann war das schon das richtige Dach, weil es sich in die Landschaft miteingefügt hat und die Landschaft vielleicht bis zum gewissen Grad ergänzt hat.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Für die Weltöffentlichkeit war das geschwungene, quasi schwebende Dach freilich eine Sensation und half, das neue Image Deutschlands in der Welt zu prägen – weltoffen, modern, bunt. Die Fernsehübertragung der Spiele fand in Farbe statt. Dies stellte zusätzliche Anforderungen an die Architektur – wie die Spiele vier Jahre zuvor in Mexiko gezeigt hatten. Fritz Auer:
13. ZUSPIELUNG Fritz Auer 21:33
„Da hatten die Farbfernsehleute große Probleme bei ihren Aufnahmen, weil in Mexiko das Stadion, das hatte ein schattenspendendes Dach für sich in so einem heißen Land gehört. Und das schattenspendende Dach hat natürlich auch große Schatten geworfen, auf das Spielfeld und auf die Laufbahn. Und dann haben die natürlich immer die Mühe gehabt, wenn die Spieler oder die Läufer in der Sonne sind, Blende zu, wenn es in Schatten sind, Blende auf. Das kann doch nicht wahr sein, das muss doch die junge deutsche Bundesrepublik und ihre technologischen Experten müssen doch in der Lage sein, ein lichtdurchlässiges Dach für München zu kreieren.“
ERZÄHLER
Gelungen ist das mit transparenten Acrylglasplatten, die in das Stahlseilgewebe eingefügt wurden. Sie wurden vorher mehreren Härtetests unterzogen, sie mussten sich unter Schneelast und im Falle eines Brandes bewähren. Das Dach durfte schließlich weder brennen, noch schmelzen und abtropfen. Außerdem mussten die Dachplatten für Reparaturarbeiten begehbar und leicht zu reinigen sein.
ERZÄHLERIN
Als man endlich ein Material gefunden hatte, das all diesen Anforderungen genügte, stellte sich das nächste Problem: Wie sollten die Platten in der Seilkonstruktion verankert werden? Zwar war das Netz relativ starr, gab aber doch im Wind nach und verschob sich an den Knotenpunkten des Netzes um mehrere Zentimeter.
13b. ZUSPIELUNG Fritz Auer 23.40
„Also musste man Lösungen finden, dass die Platten sich nicht berühren …und dann brechen. Also das musste vermieden werden. Und dadurch wurde das gelöst, dass wir Neopren-Fugen einfügten, die zugleich auch der Wasserleitungen einigermaßen dienen und vor allem auch gegen Schneerutsche hilfreich waren. Gegen diese schweren, befürchteten Lawinen, die da runterkommen könnten vom Dach und … die Platten mussten auf dem Seilnetz, auf diesen Knoten dieses Netzes mussten die schwimmend quasi verlegt werden. Deshalb war da als Verbindungselement Gummipuffer aus der Automobilindustrie eingesetzt.“
ERZÄHLER
Zusammen mit den Platten wurden diese speziell für das Olympiadach entwickelten Puffer schließlich montiert, mithilfe ebenfalls nur für diesen Einsatz hergestellter Geräte.
14. ZUSPIELUNG Collage von der Eröffnung der Spiele
ERZÄHLERIN
Für München, die Erbauer des Olympia-Ensembles und die beteiligten Politiker war es ein Triumph, als am 26. August 1972 die Nationen ins Stadion einzogen. Das Stadion war in frühlingshafte Pastelltöne getaucht– lindgrün, himmelblau, gelb, orange und weiß. Farben, die der für das Design der Spiele zuständige Grafiker Otl Aicher ausgesucht hatte. Nichts sollte an die Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold erinnern, alles sollte frisch, leicht und unbeschwert wirken. Deshalb trugen die Polizisten auch statt Uniformen hellblaue Anzüge und weiße Schiebermützen eines französischen Designers. Fritz Auer erinnert sich an die Eröffnung der Olympischen Spiele:
14b. ZUSPIELUNG Auer 38.44
„Also, es war ein Traum. Dieser Zirkus aus bunten Menschen, der Berg, die Kontur des Bergs bestand aus Menschen, weil da waren viele Bürger, die hatten keine Eintrittskarten oder kam einfach nicht mehr ins Stadion rein. Die haben sich auf den Berg gesetzt, und der Berg war voller bunter Menschen - so etwas Tolles!“
ERZÄHLER
Die Bilder des bis auf den letzten Platz gefüllten Stadions und des Olympiaberges gingen um die Welt.
15. ZUSPIELUNG Auer 39:54
„Wir hatten es geschafft, aber nicht wir allein. Da standen so viele dahinter, bis zu den Handwerkern, die auf dem Dach waren, die bergsteigerische Leistung vollbracht haben an den steilen Stellen. Das waren bergsteigerische Leistungen, die mussten sich anseilen - aber das war ein Geist durchweg. Da gab‘s nicht die so genannten Bedenkenträger, die alles klein geredet haben, das hätte nicht geklappt.“
ERZÄHLERIN
In der New York Times lobte man das Dach als
Zitator:
„das auffallende strukturelle Symbol der Spiele, das durch „kühne Kurven die aufregendsten Perspektiven des Olympiaparks biete“.
ERZÄHLERIN:
Und resümierte:
Zitator:
„Diese Spiele können die Wunden der Vergangenheit heilen.“
ERZÄHLERIN:
Der britische Observer schrieb:
Zitator:
„Keine Spur von Militarismus. Das haben die Bayern gut gemacht.“
ERZÄHLERIN:
Und der italienische „Corriere della Sera“ kommentierte:
ZITATOR
„Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass sich die Deutschen geändert haben, das Stadion in München hat ihn geliefert.“
MUSIK
ERZÄHLER
Die Spiele von 1972 waren ein Einschnitt. Sie ließen Deutschland in einem anderen Licht erscheinen. Zugleich legte sich mit dem Olympia-Attentat ein dunkler Schatten über die Spiele – er wird immer mit dem Olympiastadion verbunden sein: Die Geiselnahme von Sportlern der israelischen Nationalmannschaft durch eine palästinensische Terrorgruppe mit 17 Toten am Ende – 11 Sportlern, einem deutschen Polizisten und 5 Terroristen.
ERZÄHLERIN
Seit 1995 erinnert ein schwerer Granit-Quader direkt unter einem der Tragseile des Zeltdaches an das Attentat und deren Opfer. Täglich ziehen an dem Klagebalken Hunderte, Tausende Menschen vorbei, beim Joggen, beim Gassi-Gehen mit dem Hund, auf dem Weg zum Picknick auf dem Olympiaberg.
ERZÄHLER
Denn mittlerweile sind der Park und das Stadion zum lebendigen Teil der Stadt München geworden – so wie es seine Erbauer geplant und sich erhofft hatten. Aus dem olympischen Dorf der Männer wurde eine Wohnanlage, aus dem olympischen Dorf der Frauen eine Studentensiedlung. München profitiert davon, dass man beim Entwurf des Olympiageländes die Nachnutzung schon mitgeplant hatte, wie Franz Josef Strauß 1972 betont.
16. ZUSPIELUNG Strauß:
„Das ist nicht nur gedacht für eine einmalige Sportveranstaltung von 14 Tagen Dauer, das wird von nachhaltiger und dauernder Wirkung für das gesamte Bild der Stadt München sein.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Die olympische Landschaft, in die man 1972 Schilder gestellt hatte mit der Aufforderung: „Rasen betreten erwünscht!“, ist seitdem eine grüne Lunge der Stadt, Ort des Spiels und der Begegnung.
 View all episodes
View all episodes


 By ARD
By ARD




4.7
3535 ratings

Es gilt als ein statisches Wunder und als triumphales Bauwerk, selbst ein halbes Jahrhundert nach seiner Erbauung: visionär, radikal modern, offen - das Münchner Olympiastadion. Organisch eingefügt in eine künstlich geschaffene, natürlich anmutende Landschaft. Von Susanne Hofmann (BR 2022)
Credits
Autorin: Susanne Hofmann
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Thomas Birnstiel, Ruth Geiersberger, Peter Veit
Technik: Susanne Harasim
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview: Stefan Behnisch, Prof. Fritz Auer
Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2025
Besonderer Linktipp der Redaktion:
BR: Tatort Geschichte – True Crime meets History
Bei Tatort Geschichte verlassen Niklas Fischer und Hannes Liebrandt, zwei Historiker von der Ludwig-Maximilians-Universität in München, den Hörsaal und reisen zurück zu spannenden Verbrechen aus der Vergangenheit: eine mysteriöse Wasserleiche im Berliner Landwehrkanal, der junge Stalin als Anführer eines blutigen Raubüberfalls oder die Jagd nach einem Kriegsverbrecher um die halbe Welt. True Crime aus der Geschichte unterhaltsam besprochen. Im Fokus steht die Frage, was das eigentlich mit uns heute zu tun hat. "Tatort Geschichte" ist ein Podcast von Bayern 2 in Zusammenarbeit mit der Georg-von-Vollmar-Akademie. ZUM PODCAST
Linktipps
SWR (2024): Die Olympischen Spiele 1972 – Münchens Sommertragödie
München wollte 27 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs ein neues Deutschland präsentieren - heiter und offen. Doch die Terroranschläge machten aus dem Sportfest eine Tragödie. Von Michael Kuhlmann (SWR 2022) JETZT ANHÖREN
ARD alpha (2024): Das Münchener Olympiastadion
Nach dem Hofbräuhaus ist das Olympiastadion von 1972 Münchens berühmtestes Gebäude - und kunsthistorisch das wohl bedeutendste. Warum eigentlich? Was hat das spektakuläre Netz aus Stahl und Glas mit Seifenblasen zu tun? Was mit Demokratie? Und wie kam Architekt Frei Otto auf diese Verbindung von Baukunst und Ingenieurstechnik? Ein junger Kunsthistoriker geht diesen Fragen auf den Grund. Er entdeckt das Bauwerk für uns neu und zeigt so, was das Stadion zu einem Meilenstein gemacht hat. JETZT ANSEHEN
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
MUSIK
ERZÄHLERIN
Es ist Ende Oktober 1965 – aus dem Radio singen die Rolling Stones ihren Nummer Eins-Hit „I can’t get no satisfaction“, in Bonn ist Ludwig Erhard gerade zum zweiten Mal zum Bundeskanzler gewählt worden, und im Münchner Rathaus bekommt der Oberbürgermeister der Stadt München, Hans-Jochen Vogel, Besuch: Besuch von Willi Daume, einer Schlüsselfigur im Sport und Präsident des Nationalen Olympischen Komitees. Er stellt dem Oberbürgermeister eine große Frage:
1a. ZUSPIELUNG Fritz Auer 00.50
„Sitzen Sie fest auf ihrem Stuhl? Und Vogel hat ihn gefragt, ja, wie meinen Sie das – politisch oder komfortabelmäßig? Und hat gesagt, Herr Vogel, wie wär’s, wenn Sie sich bewerben würden für die Austragung der Olympischen Spiele in München 1972!? Puh - Vogel hat einmal durchgeschnauft, da sagt er, da brauch ich ein bisschen Zeit … Vier Tage nur hat er gebraucht … und dann hat er gesagt okay, wir bewerben uns.“
ERZÄHLER
So ging damals die Erzählung, erinnert sich der Architekt Fritz Auer. Die Zeit drängt, die Bewerbungsfrist läuft in nur zwei Monaten ab. Innerhalb weniger Tage bringt Hans-Jochen Vogel den Münchner Stadtrat hinter seine Entscheidung, München bewirbt sich offiziell für die Olympischen Spiele und – erhält den Zuschlag. Die Ausschreibung zum Bau des Olympiageländes mitsamt dem Stadion gewinnt ein Architekturbüro aus Stuttgart: Behnisch und Partner. Sie haben bis dahin eher überschaubare Projekte geleitet – Landratsämter, Schulen und Kindergärten gebaut. Mitbegründer des Büros ist der Architekt Fritz Auer.
MUSIK
ERZÄHLERIN
Was in den Jahren darauf folgt, ist die Realisierung eines kühnen architektonischen Entwurfs, ein gewaltiger gemeinsamer Kraftakt und längst prägender Teil der Geschichte der Stadt München und der jungen Bundesrepublik. In München sieht man dem Bau mit Selbstbewusstsein und Zuversicht entgegen. Oberbürgermeister Hans-Jochen Vogel:
1b. ZUSPIELUNG Vogel
„Es handelt sich sowohl der Funktion als auch dem Bauvolumen nach um eines der größten Bauvorhaben, das in unserer Stadt in diesem Jahrhundert abgewickelt wird. (…) Wenn wir es vernünftig machen, wenn wir uns von Übertreibungen freihalten, wenn wir, wie der Bundeskanzler es sagte, all unseren Gästen, die zu uns kommen, menschlich und freundlich begegnen, dann glaube ich in der Tat, dass die Bundesrepublik einen großen ideellen Nutzen davon haben kann.“
ERZÄHLER
Dabei ist die Ausgangslage auf den ersten Blick eher bescheiden. Zunächst einmal: München hat keine einzige olympiataugliche Sportstätte. Auch die Infrastruktur steckt noch in den Kinderschuhen - der Mittlere Ring, heute eine Hauptverkehrs-Ringstraße, ist noch lange nicht fertig, der Bau der ersten U-Bahn hat erst begonnen. Und als der Olympia-Architekt Fritz Auer, damals Mitte 30, sich ein Bild von München macht, ist er zunächst nicht besonders begeistert:
2. ZUSPIELUNG Fritz Auer
„Ich fand die Stadt schrecklich - gegenüber Stuttgart erst mal eben und grau, kein Baum, gar nichts. So war mein erster Eindruck.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Doch München ist eine aufstrebende, junge Stadt, regiert vom einst jüngsten Oberbürgermeister Europas, Hans-Jochen Vogel. Fast die Hälfte der Stadtbevölkerung ist unter 30 Jahre alt. Siemens hatte sich nach dem Krieg hier angesiedelt, genauso wie das Messe- und Verlagswesen und die Filmindustrie. Die Stadt wächst rasant und die Aussicht auf die Olympiade beflügelt den Aufschwung. Die Stimmung der Zeit ist geprägt von Fortschrittsglaube und Optimismus, der parteiübergreifend wirkt. Daran erinnert sich auch der Architekt Stefan Behnisch, der Sohn des Architekten Günther Behnisch, der den Olympia-Bau plante und leitete.
3. ZUSPIELUNG Stefan Behnisch SB 22.35
„Politisch gab es eine Allianz zwischen Vogel, Strauß und Brandt - die Figuren kann ich mir heute überhaupt nicht in einem Raum vorstellen. Ja, aber die haben das gemeinsam getragen. Und das hat dem Projekt den Rücken gestärkt. Auch die Stimmung damals, die Aufbruchsstimmung, mehr Demokratie wagen… und man war auf der Suche nach einer zukunftsfähigen Gesellschaft, die eben dieses Bittere überwinden konnte. Und die 50er und 60er-Jahre waren ja bitter. Teilweise ungeheuer spießig. Und ich glaube, diese Stimmung hat viel getragen, … In Rekordzeit hat München damals Ungeheures geleistet, ihre Stadt für die Zukunft fit gemacht. Und heute zehrt die Stadt noch davon.“
MUSIK
ERZÄHLER
Die Austragung der Spiele gab München und ganz Deutschland die Chance, sich der Welt nach dem verheerenden, von Deutschland angezettelten Weltkrieg neu zu präsentieren. Es galt, das preußisch-militärische Image Deutschlands zu überwinden. Das Olympiagelände mit seinen Sportstätten sollte für die junge Demokratie stehen, eine klare Abkehr von den Berliner Olympischen Spielen von 1936 mit ihrem auftrumpfenden Nationalismus und ihren Bauten, die Macht und Größe des Deutschen Reiches demonstrierten. Das neu zu errichtende Münchner Stadion sollte die Visitenkarte des gewandelten Deutschlands werden – ebenfalls ein Gegenentwurf zum monumentalen Berliner Stadion. Es herrschte, so der Olympia-Architekt Fritz Auer…
4. ZUSPIELUNG Fritz Auer FA2 30.25
„…einfach der absolute Wille der Politiker und des Olympischen Komitees: Wir wollen dieses Zeitdokument für eine junge Demokratie - fast egal, was es kostet.“
ERZÄHLERIN
Heiter sollten die Spiele und ihre Bauten sein, leicht, dynamisch, unpolitisch, unpathetisch und frei von Ideologie.
5. ZUSPIELUNG Auer 3:58
„Es gab Leitlinien für die sogenannte Ausschreibung des Wettbewerbs, also die Aufgabenstellung. Und da waren drei Begriffe genannt: Spiele der kurzen Wege, Spiele im Grünen also, sprich Landschaft und Verbindung von Sport und Kunst.“
ERZÄHLER
All das verkörperte der Entwurf der Architekten Behnisch und Partner aus Stuttgart. Er sah eine Art Voralpenlandschaft vor, hügelig mit einem See, künstlich geschaffen auf dem drei Quadratkilometer großen Areal Oberwiesenfeld, Brachfläche und früherer Flugplatz, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Und, durchaus symbolträchtig: Der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg sollte begrünt und zum Olympiaberg transformiert werden. Die Sportstätten sollten in das Gelände eingebettet werden und ihre Dimension so bescheidener wirken. Oder, in den Worten von Willi Daume, dem Präsidenten des Nationalen Olympischen Komitees:
5b. ZUSPIELUNG Daume
„Die Lösung ist trotz der gebotenen Größenordnung so, dass immer ein menschliches Maß gewahrt ist. … Ich möchte es mal ganz kühn sagen: Die Landschaft, so wie sie dort entsteht, entspricht fast der von Olympia. Es wird eine großartige Bereicherung nicht nur der Stadt München, nicht nur der deutschen Architektur sein, sondern alle Ausländer, die nach hier kommen, werden sich hier wohl fühlen, es ist eine ideale Stätte der Begegnung, auch mit der Münchner Bevölkerung – wir sind hochzufrieden.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit allerding beherrschte schon bald das geplante Olympiastadion, genauer: sein Dach. Eine Zeltdachkonstruktion, wie man sie noch nie gesehen hatte. Leicht und transparent, wie ein riesiges, freischwebendes Spinnennetz. Davon waren Politik und Öffentlichkeit fasziniert. Fritz Auer:
6. ZUSPIELUNG Auer FA1 20:21
„Weil diese Konstruktion, diese sogenannten leichten Flächentragwerke … sehr immateriell wirken, also eigentlich wie ne Wolke über einer statischen Landschaft - wenn man‘s in Musik ausdrücken würde, wär die Landschaft der Kontrabass und das Dach wär die Oberstimme dazu - und die Oberstimme ist was Leichtes. Die schwingt und tut und bindet alles zusammen.“
MUSIK
ERZÄHLER
Vorbild und Inspiration für das Zeltdach war der deutsche Pavillon auf der Weltausstellung in Montreal 1967 – ein Werk des Architekten Frei Otto. Eine Weltneuheit, die Staunen erregte: Den Pavillon überwölbte ein Dach von rund 8.000 Quadratmetern, bestehend aus einem Seilnetz mit einer darunter gespannten weißen Folie. So leicht und luftig war bisher kein Gebäude überdacht worden.
ERZÄHLERIN
In München aber war die Fläche fast zehn Mal so groß. 75.000 Quadratmeter sollte das Zeltdach hier überspannen, in etwa die Fläche von acht Fußballfeldern. Denn die Schwimmhalle und die Sporthalle mussten überdacht werden, im Stadion mindestens die Hälfte der Zuschauerplätze, zudem die dazwischenliegenden Wege im Olympiapark. Niemals zuvor war so eine Konstruktion realisiert worden.
ERZÄHLER
Schon das Modell des Stadions war unkonventionell. Die Architekten hatten sich dafür einfacher Materialien bedient – Sägemehl zum Modellieren der Landschaft, Zahnstocher als Dachstützen und für das Zeltdach: Nylonstrümpfe von Fritz Auers Frau.
7. ZUSPIELUNG Auer 24:34
„Der Damenstrumpf hat Ähnlichkeit zum späteren Seilnetz in seiner Verformungsart. … und der Damenstrumpf von meiner Frau, der war so fleischfarben, fürchterlich sah das aus, das spätere Modell, … da haben wir dann Strumpfrohlinge von Firma Hözen, … die haben damals uns Rohlinge, also weiße, geliefert für das Wettbewerbsmodell, so sah’s dann besser aus später.“
ERZÄHLERIN
Die Pläne zeichneten die Architekten von Hand und mit einfachen Hilfsmitteln, erinnert sich Fritz Auer.
8. ZUSPIELUNG Auer FA1 18:40
„Es gab den Rechenschieber, es gab noch keinen Taschenrechner, also noch keinen elektronischen Rechner, … die Riesenanlagen, das musste alles gezeichnet werden - die Grundrisse, Schnitte, alles im Maßstab eins zu 200, das muss man sich mal vorstellen. Da ist ein Stadion - Umgriff ist dann immerhin also etwa einen halben Meter breit und ein Meter über die Länge gemessen. Das musste man alles mit Stangenzirkeln zeichnen, jede Sitzreihe - alles wurde per Hand noch gemacht.“
ERZÄHLER
Monatelang rangen Architekten und Ingenieure darum, ob und wie man diesen kühnen Entwurf der Zeltdach-Landschaft überhaupt umsetzen könnte. Das Dach würde sich ständig mit dem Wind bewegen, quasi atmen – wie konnte man trotzdem seine Standfestigkeit gewährleisten? Wie sollte das Dach den Schneemassen trotzen und seine Form behalten?
MUSIK
ERZÄHLERIN
Der Leichtbau-Experte Frei Otto hatte dann die Idee, das Stadiondach in mehrere Segmente zu unterteilen und so den Bau zu ermöglichen. Für die Stadionüberdachung kam erstmals ein Computer zum Einsatz. Zur Berechnung der Kräfteverhältnisse schrieb ein Informatiker extra ein Programm – Neuland auch hier. Stefan Behnisch:
9. ZUSPIELUNG SB 00:15
„Es war eine Gleichung - nach der Erzählung meines Vaters - mit über einer Million Unbekannten. Weil jeder Knoten ja vorberechnet sein musste… da wir hier über ein sphärisches Netz sprechen, nicht über ein glattes, elastisches Netz, sondern ein starres, sphärisches Netz, mussten die es genau so vorberechnen. Wenn das am Boden liegt, lag es ja wie ein Leintuch in Falten, und da mussten die aber jeden Knoten im Prinzip auf einen Millimeter genau richtig verankern und schrauben. Denn wenn das dann hochgezogen wird, durfte ja nicht eine Überbelastung an einer Stelle sein, das musste ja alles stimmen.“
ERZÄHLER
Die Berechnungen stimmten, das Seilnetz wurde erfolgreich aufgerichtet, die knapp 80 Meter hohen Pylonen im Boden verankert. Zunächst hoffte man, dass das Dach 15 Jahre halten würde. Doch es erweist sich als beständiger als vermutet – bis heute sind nur kleinere Reparaturen angefallen. Erst nach einem Vierteljahrhundert mussten die Dachplatten ausgetauscht werden, sie waren milchig geworden. Die scheinbare Leichtigkeit des Daches war allerdings schwer erkauft, erklärt der Architekt Fritz Auer.
10. ZUSPIELUNG FA2 34.20
„Diese sogenannte leichten Flächentragwerke sind gar nicht so leicht. Denn die Abspann-Kräfte müssen ja irgendwo hingehen, und die gehen in riesige Fundamente, das Randseil vom Stadion hat Fundamente von einer Größe von dreigeschossigen Häusern an beiden Enden. 4.000 Tonnen sind da drin an Vorspannung, und die mussten in die Erde, und man sollte das möglichst wenig sehen, damit diese leichte, luftige Wolke entsteht.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Ausgeklügelte Ingenieurskunst, eine Pionierleistung – und doch war es dem Olympia-Architekten Günther Behnisch ein Dorn im Auge, dass das Dach so viel Aufmerksamkeit auf sich zog, wie er in einem Radio-Interview 1972 darlegte.
11. ZUSPIELUNG Günther Behnisch
„Es ist nicht das Wesentlichste unseres Entwurfes. Wir haben hier eine olympische Landschaft geschaffen, in dieser Landschaft treffen sich und verknoten sich die markantesten Punkte und Aktivitäten dieser Gegend – Fernsehturm, Wasser, Berg Hügel, Fußgängerwege – … und ein Teil dieser Anlage muss überdeckt werden.“
ERZÄHLER
Günther Behnischs Sohn Stefan ergänzt 50 Jahre später: Für seinen Vater sei das Dach notwendiges Übel gewesen, hatte lediglich dienende Funktion: Nämlich die Menschen zu schützen, die sich in der olympischen Landschaft aufhalten.
12. ZUSPIELUNG SB 17:37
„Er hätte sich ein Klima in Deutschland gewünscht, das erlaubt, Olympische Spiele ohne Dächer zu machen, aber es geht halt nicht… Er hätte gut ohne das Dach leben können. Aber wenn ein Dach, dann war das schon das richtige Dach, weil es sich in die Landschaft miteingefügt hat und die Landschaft vielleicht bis zum gewissen Grad ergänzt hat.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Für die Weltöffentlichkeit war das geschwungene, quasi schwebende Dach freilich eine Sensation und half, das neue Image Deutschlands in der Welt zu prägen – weltoffen, modern, bunt. Die Fernsehübertragung der Spiele fand in Farbe statt. Dies stellte zusätzliche Anforderungen an die Architektur – wie die Spiele vier Jahre zuvor in Mexiko gezeigt hatten. Fritz Auer:
13. ZUSPIELUNG Fritz Auer 21:33
„Da hatten die Farbfernsehleute große Probleme bei ihren Aufnahmen, weil in Mexiko das Stadion, das hatte ein schattenspendendes Dach für sich in so einem heißen Land gehört. Und das schattenspendende Dach hat natürlich auch große Schatten geworfen, auf das Spielfeld und auf die Laufbahn. Und dann haben die natürlich immer die Mühe gehabt, wenn die Spieler oder die Läufer in der Sonne sind, Blende zu, wenn es in Schatten sind, Blende auf. Das kann doch nicht wahr sein, das muss doch die junge deutsche Bundesrepublik und ihre technologischen Experten müssen doch in der Lage sein, ein lichtdurchlässiges Dach für München zu kreieren.“
ERZÄHLER
Gelungen ist das mit transparenten Acrylglasplatten, die in das Stahlseilgewebe eingefügt wurden. Sie wurden vorher mehreren Härtetests unterzogen, sie mussten sich unter Schneelast und im Falle eines Brandes bewähren. Das Dach durfte schließlich weder brennen, noch schmelzen und abtropfen. Außerdem mussten die Dachplatten für Reparaturarbeiten begehbar und leicht zu reinigen sein.
ERZÄHLERIN
Als man endlich ein Material gefunden hatte, das all diesen Anforderungen genügte, stellte sich das nächste Problem: Wie sollten die Platten in der Seilkonstruktion verankert werden? Zwar war das Netz relativ starr, gab aber doch im Wind nach und verschob sich an den Knotenpunkten des Netzes um mehrere Zentimeter.
13b. ZUSPIELUNG Fritz Auer 23.40
„Also musste man Lösungen finden, dass die Platten sich nicht berühren …und dann brechen. Also das musste vermieden werden. Und dadurch wurde das gelöst, dass wir Neopren-Fugen einfügten, die zugleich auch der Wasserleitungen einigermaßen dienen und vor allem auch gegen Schneerutsche hilfreich waren. Gegen diese schweren, befürchteten Lawinen, die da runterkommen könnten vom Dach und … die Platten mussten auf dem Seilnetz, auf diesen Knoten dieses Netzes mussten die schwimmend quasi verlegt werden. Deshalb war da als Verbindungselement Gummipuffer aus der Automobilindustrie eingesetzt.“
ERZÄHLER
Zusammen mit den Platten wurden diese speziell für das Olympiadach entwickelten Puffer schließlich montiert, mithilfe ebenfalls nur für diesen Einsatz hergestellter Geräte.
14. ZUSPIELUNG Collage von der Eröffnung der Spiele
ERZÄHLERIN
Für München, die Erbauer des Olympia-Ensembles und die beteiligten Politiker war es ein Triumph, als am 26. August 1972 die Nationen ins Stadion einzogen. Das Stadion war in frühlingshafte Pastelltöne getaucht– lindgrün, himmelblau, gelb, orange und weiß. Farben, die der für das Design der Spiele zuständige Grafiker Otl Aicher ausgesucht hatte. Nichts sollte an die Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold erinnern, alles sollte frisch, leicht und unbeschwert wirken. Deshalb trugen die Polizisten auch statt Uniformen hellblaue Anzüge und weiße Schiebermützen eines französischen Designers. Fritz Auer erinnert sich an die Eröffnung der Olympischen Spiele:
14b. ZUSPIELUNG Auer 38.44
„Also, es war ein Traum. Dieser Zirkus aus bunten Menschen, der Berg, die Kontur des Bergs bestand aus Menschen, weil da waren viele Bürger, die hatten keine Eintrittskarten oder kam einfach nicht mehr ins Stadion rein. Die haben sich auf den Berg gesetzt, und der Berg war voller bunter Menschen - so etwas Tolles!“
ERZÄHLER
Die Bilder des bis auf den letzten Platz gefüllten Stadions und des Olympiaberges gingen um die Welt.
15. ZUSPIELUNG Auer 39:54
„Wir hatten es geschafft, aber nicht wir allein. Da standen so viele dahinter, bis zu den Handwerkern, die auf dem Dach waren, die bergsteigerische Leistung vollbracht haben an den steilen Stellen. Das waren bergsteigerische Leistungen, die mussten sich anseilen - aber das war ein Geist durchweg. Da gab‘s nicht die so genannten Bedenkenträger, die alles klein geredet haben, das hätte nicht geklappt.“
ERZÄHLERIN
In der New York Times lobte man das Dach als
Zitator:
„das auffallende strukturelle Symbol der Spiele, das durch „kühne Kurven die aufregendsten Perspektiven des Olympiaparks biete“.
ERZÄHLERIN:
Und resümierte:
Zitator:
„Diese Spiele können die Wunden der Vergangenheit heilen.“
ERZÄHLERIN:
Der britische Observer schrieb:
Zitator:
„Keine Spur von Militarismus. Das haben die Bayern gut gemacht.“
ERZÄHLERIN:
Und der italienische „Corriere della Sera“ kommentierte:
ZITATOR
„Hätte es noch eines Beweises bedurft, dass sich die Deutschen geändert haben, das Stadion in München hat ihn geliefert.“
MUSIK
ERZÄHLER
Die Spiele von 1972 waren ein Einschnitt. Sie ließen Deutschland in einem anderen Licht erscheinen. Zugleich legte sich mit dem Olympia-Attentat ein dunkler Schatten über die Spiele – er wird immer mit dem Olympiastadion verbunden sein: Die Geiselnahme von Sportlern der israelischen Nationalmannschaft durch eine palästinensische Terrorgruppe mit 17 Toten am Ende – 11 Sportlern, einem deutschen Polizisten und 5 Terroristen.
ERZÄHLERIN
Seit 1995 erinnert ein schwerer Granit-Quader direkt unter einem der Tragseile des Zeltdaches an das Attentat und deren Opfer. Täglich ziehen an dem Klagebalken Hunderte, Tausende Menschen vorbei, beim Joggen, beim Gassi-Gehen mit dem Hund, auf dem Weg zum Picknick auf dem Olympiaberg.
ERZÄHLER
Denn mittlerweile sind der Park und das Stadion zum lebendigen Teil der Stadt München geworden – so wie es seine Erbauer geplant und sich erhofft hatten. Aus dem olympischen Dorf der Männer wurde eine Wohnanlage, aus dem olympischen Dorf der Frauen eine Studentensiedlung. München profitiert davon, dass man beim Entwurf des Olympiageländes die Nachnutzung schon mitgeplant hatte, wie Franz Josef Strauß 1972 betont.
16. ZUSPIELUNG Strauß:
„Das ist nicht nur gedacht für eine einmalige Sportveranstaltung von 14 Tagen Dauer, das wird von nachhaltiger und dauernder Wirkung für das gesamte Bild der Stadt München sein.“
MUSIK
ERZÄHLERIN
Die olympische Landschaft, in die man 1972 Schilder gestellt hatte mit der Aufforderung: „Rasen betreten erwünscht!“, ist seitdem eine grüne Lunge der Stadt, Ort des Spiels und der Begegnung.

7 Listeners

114 Listeners

11 Listeners

19 Listeners

77 Listeners
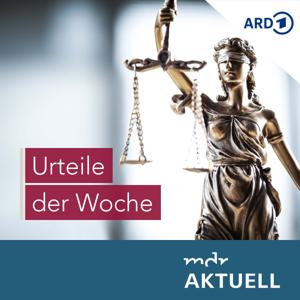
6 Listeners

118 Listeners

46 Listeners

5 Listeners

6 Listeners

189 Listeners

109 Listeners

18 Listeners

0 Listeners

44 Listeners

28 Listeners

0 Listeners

52 Listeners

14 Listeners

34 Listeners

3 Listeners

0 Listeners

35 Listeners

44 Listeners

9 Listeners

16 Listeners

0 Listeners
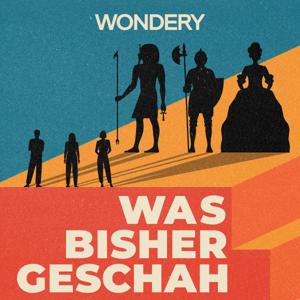
28 Listeners

11 Listeners

0 Listeners