
Sign up to save your podcasts
Or




In diesem Interview mit Dietrich Sturm, Leitender Oberarzt der Neurologischen Klinik im Bethesda Krankenhaus Wuppertal und Mitbegründer von Klinisch Relevant, geht es um das wichtige Thema Delir.
Dietrich beantwortet in seiner angenehmen norddeutschen Art Fragen wie
Was sind die patholophysiologischen Grundlagen eines Delirs?
Was sind die medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlung-Möglichkeiten?
Was sind Risikofaktoren für das Auftreten eines Delirs
Was sind die Besonderheiten eines Alkoholentzugsdelirs?
Was ist ein ZAS?
Zu welchem Arzt kann der Zyklop gehen, wenn er ein Augenproblem hat?
Hier einige wichtige Stichpunkte als Zusammenfassung für Dich:
ZAS = Zentrales anticholinerges Syndrom
Pathophysiologie: Neurotransmitter-Dysbalance mit daraus resultierendem cholinergem Defizit
Typische Narkose-Komplikation, viele Narkose-Medikamente sind Triggersubstanzen,
Inzidenz liegt bei ca. 5 %
Symptome: "Red as beet" (Vasodilation), "Dry as a bone", "hot as a hare" (gestörte Thermoregulation und Schweißsekretion), "blind as a bat" (Mydriasis und Akkomodations- Störung), "mad as a hatter" (Delir), "full as a flask" (Blasenentleerungsstörung)
Therapie: zentral-wirksamer Cholinesterasehemmer: Physiostigmin
Delir
Jeder 2. Intensiv-Patient ist gefährdet ein Delir zu entwickeln
Akute und globale Funktionsstörung des Gehirns
Risikofaktoren: "vorgeschädigtes Gehirn" (degenerative Prozess wie Demenz, strukturelle Veränderungen wie Ischämie, ICB, Tumor)
Auslöser: fieberhafte Infekte, Elektrolytstörungen, Blutdruckentgleisungen, Medikamente
Symptome: verminderte Aufmerksamkeitsspanne, kognitive Störungen, Orientierungsstörungen, wechselhafte Vigilanz, produktive Symptomatik wie wahnhafte Gedankeninhalte, Halluzinationen
Formen: hypermotorisches Delir, hypomotorisches Delir, (Alkohol-)Entzugsdelir
Pathophysiologie: Ungleichgewicht der Transmitter-Systeme: Cholinerges Defizit und
Therapie: Prävention!!, Wiederherstellung der basalen Orientierung des Patienten (Uhren/Kalender im Zimmer, ruhiges Umfeld mit geregeltem Tag-/Nacht-Rhythmus, Mobilisation, Kontakt zu den Angehörigen), Behandlung der auslösenden Faktoren
medikamentöse Therapie möglichst zurückhaltend, da rein symptomatisch und ohne Auswirkung auf das Outcome: Neuroleptika bei psychotischen Symptome so kurz und wenig wie möglich
Alkohol-Entzugsdelir: Benzodiazepine, alpha-2-Agonisten, Vitamin B1!
Zudem erzählt Dietrich auch von dem Buch, das er mit einer Reihe von Kollegen geschrieben hat:
Neurologische Pathophysiologie
Zum Schluß noch ein paar hilfreiche Links:
Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt: Delir im Krankenhaus
CAM-ICU Pocket-Card der Uniklinik-Schleswig-Holstein
Insgesamt also mehr als genug Gründe, sich das Interview anzuhören!
Viel Spaß!
Disclaimer:
Bei den Podcasts von Klinisch Relevant handelt es sich um Fortbildungsinhalte für Ärzte und medizinisches Personal und keinesfalls um individuelle Therapievorschläge. Sie ersetzen also keineswegs einen Arztkontakt, wenn es um die Behandlung von Erkrankungen geht.
P.S.:
Wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch bitte mit Deinen Kolleginnen und Kollegen! Es würde uns auch riesig freuen, wenn Du unseren Newsletter auf unserer Homepage abonnieren und unser Projekt bei Apple Podcasts bewerten würdest. Wenn Du Lust hast, dann findest Du Klinisch Relevant auch bei Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn.
 View all episodes
View all episodes


 By Dr. med. Kai Gruhn, Dr. med. Dietrich Sturm, Prof. Markus Wübbeler
By Dr. med. Kai Gruhn, Dr. med. Dietrich Sturm, Prof. Markus Wübbeler




5
22 ratings

In diesem Interview mit Dietrich Sturm, Leitender Oberarzt der Neurologischen Klinik im Bethesda Krankenhaus Wuppertal und Mitbegründer von Klinisch Relevant, geht es um das wichtige Thema Delir.
Dietrich beantwortet in seiner angenehmen norddeutschen Art Fragen wie
Was sind die patholophysiologischen Grundlagen eines Delirs?
Was sind die medikamentösen und nicht-medikamentösen Behandlung-Möglichkeiten?
Was sind Risikofaktoren für das Auftreten eines Delirs
Was sind die Besonderheiten eines Alkoholentzugsdelirs?
Was ist ein ZAS?
Zu welchem Arzt kann der Zyklop gehen, wenn er ein Augenproblem hat?
Hier einige wichtige Stichpunkte als Zusammenfassung für Dich:
ZAS = Zentrales anticholinerges Syndrom
Pathophysiologie: Neurotransmitter-Dysbalance mit daraus resultierendem cholinergem Defizit
Typische Narkose-Komplikation, viele Narkose-Medikamente sind Triggersubstanzen,
Inzidenz liegt bei ca. 5 %
Symptome: "Red as beet" (Vasodilation), "Dry as a bone", "hot as a hare" (gestörte Thermoregulation und Schweißsekretion), "blind as a bat" (Mydriasis und Akkomodations- Störung), "mad as a hatter" (Delir), "full as a flask" (Blasenentleerungsstörung)
Therapie: zentral-wirksamer Cholinesterasehemmer: Physiostigmin
Delir
Jeder 2. Intensiv-Patient ist gefährdet ein Delir zu entwickeln
Akute und globale Funktionsstörung des Gehirns
Risikofaktoren: "vorgeschädigtes Gehirn" (degenerative Prozess wie Demenz, strukturelle Veränderungen wie Ischämie, ICB, Tumor)
Auslöser: fieberhafte Infekte, Elektrolytstörungen, Blutdruckentgleisungen, Medikamente
Symptome: verminderte Aufmerksamkeitsspanne, kognitive Störungen, Orientierungsstörungen, wechselhafte Vigilanz, produktive Symptomatik wie wahnhafte Gedankeninhalte, Halluzinationen
Formen: hypermotorisches Delir, hypomotorisches Delir, (Alkohol-)Entzugsdelir
Pathophysiologie: Ungleichgewicht der Transmitter-Systeme: Cholinerges Defizit und
Therapie: Prävention!!, Wiederherstellung der basalen Orientierung des Patienten (Uhren/Kalender im Zimmer, ruhiges Umfeld mit geregeltem Tag-/Nacht-Rhythmus, Mobilisation, Kontakt zu den Angehörigen), Behandlung der auslösenden Faktoren
medikamentöse Therapie möglichst zurückhaltend, da rein symptomatisch und ohne Auswirkung auf das Outcome: Neuroleptika bei psychotischen Symptome so kurz und wenig wie möglich
Alkohol-Entzugsdelir: Benzodiazepine, alpha-2-Agonisten, Vitamin B1!
Zudem erzählt Dietrich auch von dem Buch, das er mit einer Reihe von Kollegen geschrieben hat:
Neurologische Pathophysiologie
Zum Schluß noch ein paar hilfreiche Links:
Artikel aus dem Deutschen Ärzteblatt: Delir im Krankenhaus
CAM-ICU Pocket-Card der Uniklinik-Schleswig-Holstein
Insgesamt also mehr als genug Gründe, sich das Interview anzuhören!
Viel Spaß!
Disclaimer:
Bei den Podcasts von Klinisch Relevant handelt es sich um Fortbildungsinhalte für Ärzte und medizinisches Personal und keinesfalls um individuelle Therapievorschläge. Sie ersetzen also keineswegs einen Arztkontakt, wenn es um die Behandlung von Erkrankungen geht.
P.S.:
Wenn Dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn doch bitte mit Deinen Kolleginnen und Kollegen! Es würde uns auch riesig freuen, wenn Du unseren Newsletter auf unserer Homepage abonnieren und unser Projekt bei Apple Podcasts bewerten würdest. Wenn Du Lust hast, dann findest Du Klinisch Relevant auch bei Facebook, Instagram, YouTube und LinkedIn.

55 Listeners
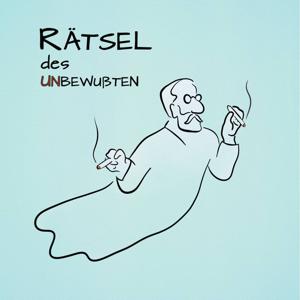
17 Listeners

5 Listeners

17 Listeners

4 Listeners

6 Listeners

16 Listeners

42 Listeners

5 Listeners

13 Listeners
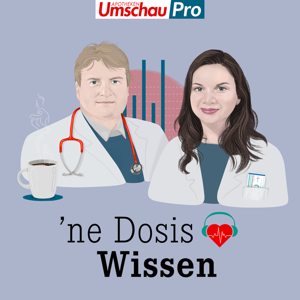
1 Listeners

34 Listeners

22 Listeners

1 Listeners

3 Listeners