
Sign up to save your podcasts
Or




Bei Planung und Bau neuer Krankenhäuser rückt der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Doch welche Umgebung brauchen Kranke, um sich wohlzufühlen und zu genesen? Wie wirken Räume, Gänge, Türen, Licht, Fenster, Wege und Außenbereiche auf deren Genesung? Von Werner Bader
Credits
Autor dieser Folge: Werner Bader
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprachen: Sebastian Fischer, Rahel Comtesse
Technik: Ursula Kirstein
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Birgit Dietz, Architektin, Schwerpunkte Krankenhausbau und unterstützende, demenzsensible Architektur. Lehrt an der TU München;
Professor Christine Nickl-Weller, Architektin; Nickl & Partner Architekten München;
Arndt Sänger, Architekt, Nickl & Partner Architekten München;
Nina Lutz, Referentin Öffentlichkeitsarbeit Klinikum Agatharied
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Und noch zwei besondere Empfehlungen der Redaktion:
Sherlock Holmes: Aus der Chronik des Dr. Watson
Der weltberühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes aus der Londoner Baker Street im Kampf auf Leben und Tod mit dem diabolischen Endgegner Professor Moriarty, der mit seiner mächtigen Verbrecherorganisation ganz Europa terrorisiert. Merkwürdige Todesfälle, eigenartige Rituale, ausländische Agenten, wahnsinnige Adelige und unheimliche Vorgänge. Spannende Fälle aus den 1960er-Jahren: "Aus der Chronik des Dr. Watson", für alle Fans des trockenen britischen Humors. HIER gehts zur Website
Ein Zimmer für uns allein
Ein Podcast-Tipp für alle, die gerne authentische Geschichten hören: „Ein Zimmer für uns allein“ – zwei Frauen, zwei Generationen und die Frage „Wie hast du das erlebt?“
Hier trifft Paula Lochte immer zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen offen und ehrlich über ein Thema, das sie verbindet. Was waren die Kämpfe damals, was sind sie heute? „Ein Zimmer für uns allein“ findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo’s Podcasts gibt. JETZT ENTDECKEN
Literatur:
Christine Nickl-Weller, Hans Nickl „Architecture für Gesundheit“ 2021, Braun Publishing
Viele Bilder und Materialien, Einblicke in die Planungswelten moderner Krankenhäuser
Dietz, B. (2023). Demenzsensible Architektur. Planen und Gestalten für alle Sinne. 2. Auflage. Fraunhofer IRB Verlag
Katalog zum Ausstellungsprojekt „Das Kranke(n)haus.Wie Architektur heilen hilft - Building to Heal.New Architecture for Hospitals“ - Lisa Luksch, Tanja C. Vollmer, Andreas Lepik, 15 Seiten, im Internet unter: Website Pinakothek der Moderne Bilder und Beispiele von beispielhaft realisierten Krankenhausbauten
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
SPRECHER:
Wer ein Krankenhaus betritt, sucht Heilung von Krankheit oder besucht einen Menschen auf dem Weg zur Genesung. Oder arbeitet dort. Taucht ein in die Atmosphäre eines speziellen Orts, mit seinen Geräuschen und Gerüchen, seinem Licht und seiner baulichen Gestaltung. Muss man an ein klassisches Krankenhaus denken, wenn man das Klinikum Agatharied bei Miesbach betritt? Nicht unbedingt, so Referentin Nina Lutz:
02 Zsp. Heilsame Architektur Nina Lutz
„Was Allererstes auffällt, dass wir einen sehr offenen Eingangsbereich haben, dass wir sehr viel Glas haben, das sehr viel Lichteinfall ermöglicht und dass man nicht das Gefühl hat, man wird eingeengt, sondern man hat ein Gefühl der Offenheit, ein Gefühl der Übersicht. Dass die Patienten sich zurechtfinden und auch die Besucher. Und was hier sehr besonders ist, das ist unser Wasserlauf hier, der eine schöne Geräuschkulisse bietet, der auch die Krankenhausgeräusche, die man so typisch wahrnimmt, auch ein bisschen abdämmt, und für eine schöne Atmosphäre sorgt.“
ATMO Wasserlauf und Park
Musik 1: Ein Toast – 1:05 Min
SPECHERIN:
Glas und Licht, Offenheit und Übersicht, Natur in Form eines Wasserlaufs. Kein Klackern, kein Türenknallen, keine Rollgeräusche von Betten, keine hektischen Aktionen. Den langen Gang, die Magistrale, die durch das Klinikum Agatharied führt, flankiert im Eingangsbereich eine hölzerne Rampe, die sich von links nach rechts, von rechts nach links den Weg ins obere Stockwerk bahnt. Von der Cafeteria im Gang mit der großen Glasfront blickt man auf einen Teich und Pflanzen.
SPRECHER:
Im Klinikum Agatharied wird das Draußen nach Drinnen geholt, man fühlt sich verbunden mit der natürlichen Umgebung des Krankenhauses, das sich mit seiner langen Hauptachse und den einzelnen Klinikbereichen, den Modulen wie Innere Medizin, Geriatrie oder Orthopädie mit nur wenigen Stockwerken an den Hang schmiegt und immer wieder den Blick auf die Voralpenlandschaft freigibt.
SPRECHERIN:
Das Klinikum Agatharied wurde von 1994 bis 1998 gebaut, geplant hat es das Münchner Architekturbüro Nickl-Weller. Es markiert eine neue Ära im Krankenhausbau des 20.Jahrhunderts. Der war zuletzt von technik-dominierten Großbauten geprägt, Hochhauskliniken wie etwa die Uniklinik in München Großhadern. Praktisch, steril, uni-form. Architektin Christine Nickl-Weller:
03 Zsp. Heilsame Architektur Nickl-Weller
„Warum war es uniform? Weil man gedacht hat, dass der Zenit der medizinischen Entwicklung erreicht ist. Davon gehe ich aus. Also, man hat genau für diesen Punkt gebaut. Für die Erkenntnisse des Jahres zwischen 1970, 80 bis 85 ungefähr. Und man hat nie gedacht, dass die Radiologie in den OP einzieht. Also da sind wir heute.“
SPRECHER:
Radiologie, Sonographie, MRT, digitale Medizin, Robotik – die technische Entwicklung in der Medizin ist nicht stehengeblieben, sie schritt und schreitet unaufhaltsam voran. Mit Folgen für das Krankenhaus und die Menschen, die darin arbeiten und die, die darin gesund werden sollen.
04 Zsp. Heilsame Architektur
„Wenn Sie heute in Großhadern gerade in die Radiologie kommen, die bordet über, so eng ist es da. Also, die braucht Luft. Und das ist in diesen Gebäuden nicht möglich. Die haben schon allein über die „Hochhaus-Scheibe“ ein klar begrenztes Baufeld, da geht nichts mehr. Wir hatten 3-Bett-Zimmer in dieser Zeit, wenn sie die auf die heute üblichen 2-Bett-Zimmer reduzieren, haben sie so wenige Betten für eine Pflegestation. Sie können nichts koppeln, Sie können nichts ändern. Sie haben genau eine Art von Funktion in einem Bereich. Und das funktioniert nicht mehr.“
Musik 2: Data stream – 1:04 Min
SPRECHERIN:
Fast jeder kennt Großkliniken wie das Klinikum Großhadern, oder war schon einmal Patient dort. Erbaut zwischen 1967 und 1977, Sichtbeton. Glatte Fronten, ein Riegel in der Landschaft, kühl, technokratisch. Damals eine der größten Unikliniken in Deutschland und Europa. Oder das Zentralklinikum Augsburg, heute Uniklinikum. Erbaut zwischen 1974 und 1982. Vier Flügel jeweils über 10 Stockwerke hoch, weithin sichtbar in der Landschaft. 23 Kliniken, 6 Institute, 7.400 Mitarbeitende, 1.140 Ärzte und Ärztinnen und 3.000 Pflegende. 1.741 Betten, höchste Versorgungsstufe.
SPRECHER:
Beeindruckende Zahlen, imposante Bauwerke: Groß, unübersehbar, technisch gesehen das Beste ihrer Zeit. Doch wo bleibt der Mensch? Wer hat sich nicht schon einmal verlaufen in den unendlichen Gängen und Stockwerken dieser Häuser? Wer fühlte sich nicht eingeschüchtert allein schon beim Anblick, beim Betreten dieser Großkliniken? Dieser Typ Krankenhaus ist wohl ein Auslaufmodell. Beide Unikliniken, Großhadern und Augsburg werden abgerissen und neu gebaut. Sie sind in die Jahre gekommen. Offenbar auch der reine „Technik-Optimismus“ ihrer Bauzeit.
Musik 3: Thema – 37 Sek
SPRECHERIN:
Schon in den 1960iger Jahren gab es einen Bewusstseinswandel im Krankenhausbau, sagt die Architektin Birgit Dietz. Stichwort: „Humanisierung“. Der Mensch sollte wieder in den Mittelpunkt der medizinischen Versorgung rücken, gerade in den großen Kliniken. Auf die Frage „Wie fühlen Sie sich im Krankenhaus?“ gab es schon damals in Allensbach-Umfragen Rückmeldungen von Patienten, die ähnlich den heutigen sind. Birgit Dietz:
05 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz
„Zum Beispiel, man hat Angst, man kann sich nicht wehren, es ist endloses Warten, die Architektur ist kalt und nüchtern eingerichtet. Also, Themen, die man damals schon hatte, sind bis in die 1970iger Jahre in diesen Allensbach-Umfragen immer wieder auch dokumentiert. Und, ja, das sind die Themen, die wir jetzt auch leider, immer wieder noch haben. Weil wenn sie kucken, Klinikum Großhadern oder sowas, die sind natürlich entsprechend alt, in die Jahre gekommen. Man baut heute Krankenhäuser tatsächlich anders.“
SPRECHER:
Birgit Dietz engagiert sich im Vorstand des Verbands für Krankenhausbau und Gesundheitswesen, forscht seit Langem zu menschenfreundlicher Architektur in den Kliniken. In der Ausstellung „Das kranke Haus“, 2023 in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, befragte sie mit ihren Studierenden die Besucher zu ihren Bedürfnissen in einem Krankenhaus. Viele der Antworten, die auf Poster geschrieben wurden, drücken auch Wünsche aus, für die Architekten erstmal nicht zuständig sind.
06 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz
„Wir wünschen uns mehr Personal, Personal hilft uns unglaublich beim Gesundwerden. Die Kommunikation muss sich ändern. Patienten muss man zuhören. Man muss sie ernst nehmen und sie ausreden lassen. Ein anderer schreibt ganz einfach „eine Aussicht in die Natur, in die Berge“. Was uns da aufgefallen ist, dass sehr viel Negatives über das Essen beschrieben worden ist. Und natürlich ist das auch ein Thema, wenn ich jetzt an einen Patienten mit einer Allergie denke. Denn das ist in Krankenhäusern allem Anschein nach noch immer schwierig, auf bestimmte Allergien zu achten.“
Musik 4: On the shores of lake Zurich – 39 Sek
SPRECHERIN:
Menschen auf dem Weg der Genesung wollen sich ernst genommen, geborgen und sicher fühlen. Dazu gehört auch eine gute Orientierung, sagt Birgit Dietz. Patienten müssten wissen, wo im Krankenhaus sie sich befinden. Brauchen ein Haus mit menschlichem Maßstab, mit Blickverbindungen. Und Schutz vor möglichen Stürzen und Verletzungen. Ein weiterer wichtiger Baustein fürs Wohlfühlen ist die Akustik. Lärm auf dem Flur, Türenschlagen, laute Klimaanlagen kosten Genesenden im Krankenhaus, aber auch den Mitarbeitenden, viele Nerven.
07 Zsp. Heilsame Architektur
„Es geht um schalldämmende Türen, Wände, Decken. Wir verbauen schallabsorbierende Materialien. Wie Akustik-Unterdecken oder Schallabsorber an der Wand, die als Bild getarnt, auch optisch angenehm wirken können. Und im Bad fliesen wir zum Beispiel nicht bis an die Decke, um die schallharten Materialien zu reduzieren.“
Musik 5: Ein Toast – siehe vorn – 34 Sek
SPRECHER:
Auch auf das Licht in den Zimmern, Fluren und Gängen müsse man beim Bau eines Krankenhauses achten. Wenn Architektur heilen helfen soll, so die Architektin, muss man fragen: Wie viel Kunstlicht ist nötig, wie viel natürliches Licht ist möglich? Natürliches Licht im Raum oder bei einem Spaziergang im Garten, unterstütze den Tag-Nacht-Rhythmus, sorge für Wohlbefinden.
SPRECHERIN:
Wegbereiter einer „Healing architecture“, also einer Architektur die heilen hilft, war eine Studie aus den USA in den 1980iger Jahren. Zwei Gruppen von Patienten wurden verglichen, die im Krankenhaus nach identischen Operationen durch ihre Zimmerfenster entweder auf einen Park mit Bäumen oder auf eine Betonmauer sehen konnten. Patienten, die auf den Park sehen konnten, benötigten deutlich weniger Schmerzmittel, litten seltener an Depressionen und konnten im Schnitt einen Tag früher nach Hause entlassen werden als die Patienten der Vergleichsgruppe, so das Ergebnis. In der Folge gab es eine Reihe von weiteren Studien zu dem Thema.
Musik 6: Data stream – siehe vorn – 35 Sek
SPRECHER:
Inzwischen stehen Krankenhäuser vor neuen Herausforderungen. So hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie baulich ungeeignet viele Krankenhäuser für die Bekämpfung einer Pandemie sind. Dazu brauche es separate Zugänge von außen, nicht wie sonst üblich einen zentralen Zugang für Alle, Personal, Besucher und Kranke. Mehr Einzelzimmer und die Möglichkeit, einzelne Bereiche nach Bedarf vom normalen Krankenhausbetrieb zu isolieren.
08 Zsp. Heilsame Architektur
„Da geht’s um Isolierstationen, so wie früher, als TBC noch ein Thema war. Dass da Schleusen sind, aber dass da auch ein Balkon vor den Zimmern ist, so dass man einfach raustreten könnte und ein bisschen Frischluft oder auch Sonne abkriegt. Das sind die Zugangssituationen, die man noch einmal anschauen müsste, Schleusen, Quarantänezonen und vor allem diese Einzelzimmer-Möglichkeit, die am schnellsten wohl durchschlagende Wirkung erzielen kann.“
SPRECHER:
Immer wichtiger beim Bau neuer Krankenhäuser sind auch die hygienischen Anforderungen, die Baumaterialien erfüllen sollten. Denn: Jahr für Jahr erkranken 500.000 Menschen an einer „Krankenhausinfektion“, zirka 10.000 Menschen jährlich sterben in Deutschland daran. Durch den jahrzehntelangen Einsatz von Antibiotika sind mittlerweile sehr viele Erreger resistent, etwa gegen Antibiotika bei einer Lungenentzündung.
SPRECHERIN:
Entsprechende Materialien könnten helfen, die Übertragungsketten zu stoppen, so Architektin Birgit Dietz. Oberflächen müssen über ihren gesamten Lebenszyklus leicht zu reinigen sein. Mechanischen Beanspruchungen standhalten, auch Chemikalien, Reinigungsmitteln. Neuere Forschungen zeigten: Bis zu einem Drittel aller Infektionen in Krankenhäusern könnten durch bessere Materialien verhindert werden.
Musik 7: Verlogene Traditionen – 55 Sek
SPRECHER:
Auch auf die Probleme und Krankheiten einer alternden Gesellschaft müssen moderne Krankenhäuser zunehmend reagieren. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Betroffenen voraussichtlich auf 2,8 Millionen steigen. Über die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern ist aktuell über 65 Jahre alt, fast 40 Prozent von ihnen leiden an kognitiven Störungen und Demenz. Dafür brauche es keine eigene Architektur, so Birgit Dietz. Doch die Krankenhäuser müssten mehr Orientierung bieten, farbliche Kontraste schaffen. Etwa in Bad und Toilette, wo die Sturzgefahr für demente Menschen besonders groß ist.
09 Zsp. Heilsame Architektur
„Wenn Sie sich so ein Bad „Weiß in Weiß“ vorstellen, es gibt da keinen Kontrast, es gibt zwar netterweise eine Aufstehhilfe oder Ähnliches, aber Sie finden diese weiße Stange auf der weißen Fliese nicht. Einfach nur, weil Sie es nicht sehen. Sie finden den Weg nach Draußen aus dem Bad nicht, weil die weiße Tür in der weißen Wand schlicht und einfach nicht zu erkennen ist. Sie können nicht spülen, weil der weiße Knopf auf der weißen Wand nicht zu finden ist. Das heißt: Da gibt es eine ganze Menge an Themen, wo ich mir denke, das schadet anderen Patienten auch nicht. Lasst uns das doch im ganzen Krankenhaus realisieren.“
Musik 8: Ein Toast – siehe vorn – 1:00 Min
SPRECHERIN:
Schauen wir noch einmal ins Klinikum Agatharied, fertiggestellt 1998. Die moderne Akutklinik wird erschlossen über eine zentrale Linie, die Magistrale. Von ihr weg führen die einzelnen Module, elf Fachabteilungen von Darmkrebszentrum, Schulter- und Ellenbogenklinik, Traumazentrum bis zu Geriatrie und Psychiatrie. Die Intensivmedizin ist im hinteren Teil an den Hang gelagert, weitere Module sind auf der anderen Seite der Magistrale. Nie höher als drei Stockwerke, stets mit Lichthöfen, die Patientenzimmer gehen nach außen.
ATMO Klinikum
SPRECHER:
Bei unserer Führung mit Architekt Arndt Sänger und Referentin Nina Lutz haben wir den hellen Eingangsbereich verlassen, sind vorbei an einer Cafeteria, haben den fast kreisrunden Andachtsraum betreten, der, mit viel Holz und Licht von oben, die nötige Wärme für Trost und erholsame Gedanken bietet. An einer Sitzgruppe, ein paar Schritte weiter, können Angehörige und Patienten ausruhen, sich treffen, miteinander reden.
SPRECHERIN:
In den Fluren gibt es viel Tageslicht, die großen Fenster gehen bis zum Boden, man blickt in grüne Innenhöfe mit Schilf, Sträuchern, einem Kirschbaum. Die Magistrale ist Verteiler und bietet Aufenthaltsbereiche, so Architekt Arndt Sänger. Sie geht weit über das Funktionale hinaus, eröffnet Kommunikation.
10 Zsp. Heilsame Architektur
„Mit der Kommunikation auch so ein bisschen aus dem Krankenhaus rauskommen, in die normale Umwelt, so dass man Kontakt mit Nachbarn pflegen kann. Hier mit Zimmer-Nachbarn im öffentlichen Aufenthaltsbereich. Das werden wir gleich sehen, dass auch in diesen einzelnen Kuben mit viel Glas und offenen Materialien gearbeitet wird, damit man keine Isolation verspürt, dass man das Personal sehen kann, dass man Besucher sehen kann, dass man Leben auf den Gängen wahrnimmt, und dass man nicht total isoliert auf seiner Station oder auf seinem Zimmer liegt.“
SPRECHER:
Die „Kuben“, die einzelnen Stationen in den Modulen haben je einen zentralen Lichthof, um den sich die Zimmer und der Stützpunkt des Personals gruppieren. Um den Lichthof kann man herumlaufen oder sich dort aufhalten. Wer aus dem Zimmer tritt, hat Blickkontakt mit Patienten und Personal, man sei nie allein und fühle sich behütet, so der Architekt. Die Patientenzimmer sind Zweier-Zimmer und bieten dennoch Privatheit.
11 Zsp. Heilsame Architektur
„Also die Betten stehen nicht wie sonst im Krankenhaus nebeneinander, sondern eines steht hier, und das andere steht gegenüber, auf der anderen Seite. Und durch die Raumkonfiguration hat jeder für sich einen eigenen Bereich. Die können miteinander kommunizieren durch das schräg gegenüberstellen von den Betten, und jeder hat den Blick nach Draußen. Der Wintergarten, durch den sie schauen, also die Hälfte der Fassade wird durch den Wintergarten definiert, verglast von oben nach unten, und die zweite Hälfte durch ein Fenster direkt nach Draußen. Das heißt, sie haben frische Luft zum einen oder vor-temperierte Luft durch den Wintergarten. Das vermittelt so etwas wie Zuhause im weitesten Sinne, dass man in einem Wohnbereich sich befindet und nicht in einem Krankenhaus. Und das ist dieser heilungsunterstützende Aspekt, der hier im Vordergrund stand bei der Konzeption dieses Krankenhauses.“
Musik 9: On the Shores of Lake Zurich – siehe vorn – 1:30 Min
SPRECHERIN:
Architektur, die heilen hilft? Vieles davon ist im Klinikum Agatharied bereits realisiert. Doch die Entwicklung im Krankenhausbau geht weiter, entsprechend dem medizinisch-technischen Fortschritt. Pandemien und neuen Krankheiten. Personalmangel und Kostendruck. Auch müssen viele Kliniken fit gemacht werden für den Klimawandel, Hitze, extremes Wetter.
SPRECHER:
Ein Krankenhaus sei eben keine Maschine, sagt Architektin Christine Nickl-Weller. Über 15 Jahre hatte sie die Professur für Gesundheitsbauten an der TU Berlin inne, hat den Begriff „healing architecture“, also, „Architektur, die heilen hilft“, maßgeblich geprägt. Im Mittelpunkt jedes Krankenhauses, ob Alt- oder Neubau, sollte der Mensch sein, der krank ist und dort Heilung, Genesung sucht, so Christine Nickl-Weller.
SPRECHERIN:
Kranke und Genesende wollen ihre Autonomie behalten können, Orientierung und Selbstständigkeit erleben. Und nicht Entmündigung. Gute Krankenhaus-Architektur kann dafür sorgen. Auch Rückzugsorte schaffen, das Innen und Außen zusammenbringen, Privatheit ermöglichen. Dafür braucht es mehr Einzelzimmer. Und dazu abgetrennte Bereiche und eine Erschließung, die das Ausbreiten von Infektionen verhindert. Die Architektin spricht von künftigen Krankenhäusern als „Exzellenz-Zentren“.
12 Zsp. Heilsame Architektur Christine Nickl-Weller
„Die Exzellenz-Zentren müssen die anderen mitbedienen. Da muss der Chirurg, Spezialist auf seinem Gebiet, nicht nur in dem einen Haus, sondern im anderen mit-operieren, um diese Exzellenz wirklich überall hinzutragen, Dann kann ich dieses hohe Niveau der Gesundheitsversorgung bei uns halten. Und ich muss dann in den Quartieren natürlich kleine Anlaufpunkte, MVZ’s und dergleichen haben. Die aber auch über ein bestimmtes Niveau verfügen müssen.“
Musik 10: At a glance – 1:29 Min
SPRECHERIN:
Im Schnitt zehn Jahre dauert es vom Entwurf über die Genehmigung und Bau bis zum fertigen Krankenhaus, an die 60 Jahre kann es die zeitgemäßen Anforderungen erfüllen. Derzeit entstehen in Bayern, in Deutschland, in ganz Europa viele neue Krankenhäuser, es kommt eine neue Generation. Mit einer „Architektur, die heilen hilft“ und für künftige Herausforderungen gewappnet ist. Etwa in Memmingen, dort soll der rund 500 Millionen Euro teure Neubau des Klinikums 2029 in Betrieb gehen.
SPRECHER:
Laut Plan sollen in dem Neubau medizinische Bereiche, die interdisziplinär zusammenarbeiten, auch räumlich nah beieinander liegen. Auf den knapp 35.000 Quadratmetern Nutzfläche mit 480 stationären Betten in Ein- und Zweibettzimmern soll eine "Wohlfühlatmosphäre für Patienten und Mitarbeiter" entstehen. Es gibt eine Pandemiestation mit 28 Betten, mit separatem Zugang und eigenem Aufzug. Und Pufferflächen für den Fall, dass Operationssäle und Funktionsräume erweitert werden müssen.
SPRECHERIN:
Auch das Kantonsspital in Baden bei Zürich gehört bereits zu einer neuen Generation von Krankenhäusern – Anfang 2025 wurde es eröffnet. 360 Betten, die komplette Versorgung. Im Fokus des zentralen Baus, geplant ab 2015: die „Lebenswelt und die Arbeitswelt Krankenhaus“.
13 Zsp. Heilsame Architektur
„Wir haben alle Betten nach außen, also demokratisch nach außen. Und die Erschließungen sind von innen und in diesen inneren Bereichen gibt’s dann eben die Arbeitswelten, die Welt der Ärzte und die Versorgungswelt. Das hat also erstmalig nicht mehr nur gerade Flure, hat innen eine Vielzahl von Höfen. Die aber immer mit einer Biegung versehen sind. In den Bettenhäusern sind sechs unterschiedliche Hof-Typen, auch unterschiedlich bepflanzt, die Licht bis in die Untergeschosse bringen, unten enger, nach oben sich weiten.“
SPRECHER:
Viel Licht, viel Grün. Gänge und Höfe, die Orientierung schaffen, zum Verweilen einladen und Kommunikation ermöglichen. Die eine Perspektive in die Welt da draußen bieten, wohin sich jede und jeder Genesende sehnt. Ferner brauche es mehr Privatsphäre und Schutz vor Ansteckungen durch Einzelzimmer für die Patienten. Auch das Personal soll sich wohlfühlen, gerne „sein“ Krankenhaus betreten.
SPRECHERIN:
Dazu eine exzellente medizinische Versorgung, räumlich gut angeordnet mit kurzen Wegen, Verbindungen und Trennmöglichkeiten. Variabel für aktuelle und neue Herausforderungen, die – Stichwort Pandemie – mit Sicherheit kommen werden.
Musik 11: On the Shores of Lake Zurich – siehe vorn – 1.15 Min
SPRECHER:
„Festigkeit, Nützlichkeit, Schönheit“ – diese drei Kriterien guter Architektur hat bereits vor 2.000 Jahren der römische Architekt und Ingenieur Vitruv postuliert. Ein Bauwerk habe gut gebaut und stabil zu sein, es solle den Nutzern dienen und auch schön sein.
Dass gute Architektur im Fall eines Krankenhauses auch die Heilung unterstützen kann, hat bislang noch keiner ernsthaft verlangt. Die beiden Architektinnen Birgit Dietz und Christine Nickl-Weller formulieren es so:
14 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz und Christine Nickl-Weller
Alles, was man handfest tun kann, kann ich tatsächlich zusagen, dass wir das auf dem Schirm haben. Dass wir es versuchen, dass wir das bestmöglich machen. Ich hoffe einfach, dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren dann sagen können, „schaut her, so haben wir es erreicht, so haben wir es gemacht“ und wir haben Krankenhäuser, die vielleicht nicht heilen, aber die unterstützende Architektur für die Heilung anbieten, gebaut.
Also per se kann Architektur überhaupt nicht heilen, das ist ja völlig klar. Aber es kann helfen, gesund zu werden. Das ist etwas ganz was anderes.“
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8282 ratings

Bei Planung und Bau neuer Krankenhäuser rückt der Mensch wieder in den Mittelpunkt. Doch welche Umgebung brauchen Kranke, um sich wohlzufühlen und zu genesen? Wie wirken Räume, Gänge, Türen, Licht, Fenster, Wege und Außenbereiche auf deren Genesung? Von Werner Bader
Credits
Autor dieser Folge: Werner Bader
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprachen: Sebastian Fischer, Rahel Comtesse
Technik: Ursula Kirstein
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Birgit Dietz, Architektin, Schwerpunkte Krankenhausbau und unterstützende, demenzsensible Architektur. Lehrt an der TU München;
Professor Christine Nickl-Weller, Architektin; Nickl & Partner Architekten München;
Arndt Sänger, Architekt, Nickl & Partner Architekten München;
Nina Lutz, Referentin Öffentlichkeitsarbeit Klinikum Agatharied
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Und noch zwei besondere Empfehlungen der Redaktion:
Sherlock Holmes: Aus der Chronik des Dr. Watson
Der weltberühmte Meisterdetektiv Sherlock Holmes aus der Londoner Baker Street im Kampf auf Leben und Tod mit dem diabolischen Endgegner Professor Moriarty, der mit seiner mächtigen Verbrecherorganisation ganz Europa terrorisiert. Merkwürdige Todesfälle, eigenartige Rituale, ausländische Agenten, wahnsinnige Adelige und unheimliche Vorgänge. Spannende Fälle aus den 1960er-Jahren: "Aus der Chronik des Dr. Watson", für alle Fans des trockenen britischen Humors. HIER gehts zur Website
Ein Zimmer für uns allein
Ein Podcast-Tipp für alle, die gerne authentische Geschichten hören: „Ein Zimmer für uns allein“ – zwei Frauen, zwei Generationen und die Frage „Wie hast du das erlebt?“
Hier trifft Paula Lochte immer zwei Frauen aus verschiedenen Generationen und sie sprechen offen und ehrlich über ein Thema, das sie verbindet. Was waren die Kämpfe damals, was sind sie heute? „Ein Zimmer für uns allein“ findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo’s Podcasts gibt. JETZT ENTDECKEN
Literatur:
Christine Nickl-Weller, Hans Nickl „Architecture für Gesundheit“ 2021, Braun Publishing
Viele Bilder und Materialien, Einblicke in die Planungswelten moderner Krankenhäuser
Dietz, B. (2023). Demenzsensible Architektur. Planen und Gestalten für alle Sinne. 2. Auflage. Fraunhofer IRB Verlag
Katalog zum Ausstellungsprojekt „Das Kranke(n)haus.Wie Architektur heilen hilft - Building to Heal.New Architecture for Hospitals“ - Lisa Luksch, Tanja C. Vollmer, Andreas Lepik, 15 Seiten, im Internet unter: Website Pinakothek der Moderne Bilder und Beispiele von beispielhaft realisierten Krankenhausbauten
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
SPRECHER:
Wer ein Krankenhaus betritt, sucht Heilung von Krankheit oder besucht einen Menschen auf dem Weg zur Genesung. Oder arbeitet dort. Taucht ein in die Atmosphäre eines speziellen Orts, mit seinen Geräuschen und Gerüchen, seinem Licht und seiner baulichen Gestaltung. Muss man an ein klassisches Krankenhaus denken, wenn man das Klinikum Agatharied bei Miesbach betritt? Nicht unbedingt, so Referentin Nina Lutz:
02 Zsp. Heilsame Architektur Nina Lutz
„Was Allererstes auffällt, dass wir einen sehr offenen Eingangsbereich haben, dass wir sehr viel Glas haben, das sehr viel Lichteinfall ermöglicht und dass man nicht das Gefühl hat, man wird eingeengt, sondern man hat ein Gefühl der Offenheit, ein Gefühl der Übersicht. Dass die Patienten sich zurechtfinden und auch die Besucher. Und was hier sehr besonders ist, das ist unser Wasserlauf hier, der eine schöne Geräuschkulisse bietet, der auch die Krankenhausgeräusche, die man so typisch wahrnimmt, auch ein bisschen abdämmt, und für eine schöne Atmosphäre sorgt.“
ATMO Wasserlauf und Park
Musik 1: Ein Toast – 1:05 Min
SPECHERIN:
Glas und Licht, Offenheit und Übersicht, Natur in Form eines Wasserlaufs. Kein Klackern, kein Türenknallen, keine Rollgeräusche von Betten, keine hektischen Aktionen. Den langen Gang, die Magistrale, die durch das Klinikum Agatharied führt, flankiert im Eingangsbereich eine hölzerne Rampe, die sich von links nach rechts, von rechts nach links den Weg ins obere Stockwerk bahnt. Von der Cafeteria im Gang mit der großen Glasfront blickt man auf einen Teich und Pflanzen.
SPRECHER:
Im Klinikum Agatharied wird das Draußen nach Drinnen geholt, man fühlt sich verbunden mit der natürlichen Umgebung des Krankenhauses, das sich mit seiner langen Hauptachse und den einzelnen Klinikbereichen, den Modulen wie Innere Medizin, Geriatrie oder Orthopädie mit nur wenigen Stockwerken an den Hang schmiegt und immer wieder den Blick auf die Voralpenlandschaft freigibt.
SPRECHERIN:
Das Klinikum Agatharied wurde von 1994 bis 1998 gebaut, geplant hat es das Münchner Architekturbüro Nickl-Weller. Es markiert eine neue Ära im Krankenhausbau des 20.Jahrhunderts. Der war zuletzt von technik-dominierten Großbauten geprägt, Hochhauskliniken wie etwa die Uniklinik in München Großhadern. Praktisch, steril, uni-form. Architektin Christine Nickl-Weller:
03 Zsp. Heilsame Architektur Nickl-Weller
„Warum war es uniform? Weil man gedacht hat, dass der Zenit der medizinischen Entwicklung erreicht ist. Davon gehe ich aus. Also, man hat genau für diesen Punkt gebaut. Für die Erkenntnisse des Jahres zwischen 1970, 80 bis 85 ungefähr. Und man hat nie gedacht, dass die Radiologie in den OP einzieht. Also da sind wir heute.“
SPRECHER:
Radiologie, Sonographie, MRT, digitale Medizin, Robotik – die technische Entwicklung in der Medizin ist nicht stehengeblieben, sie schritt und schreitet unaufhaltsam voran. Mit Folgen für das Krankenhaus und die Menschen, die darin arbeiten und die, die darin gesund werden sollen.
04 Zsp. Heilsame Architektur
„Wenn Sie heute in Großhadern gerade in die Radiologie kommen, die bordet über, so eng ist es da. Also, die braucht Luft. Und das ist in diesen Gebäuden nicht möglich. Die haben schon allein über die „Hochhaus-Scheibe“ ein klar begrenztes Baufeld, da geht nichts mehr. Wir hatten 3-Bett-Zimmer in dieser Zeit, wenn sie die auf die heute üblichen 2-Bett-Zimmer reduzieren, haben sie so wenige Betten für eine Pflegestation. Sie können nichts koppeln, Sie können nichts ändern. Sie haben genau eine Art von Funktion in einem Bereich. Und das funktioniert nicht mehr.“
Musik 2: Data stream – 1:04 Min
SPRECHERIN:
Fast jeder kennt Großkliniken wie das Klinikum Großhadern, oder war schon einmal Patient dort. Erbaut zwischen 1967 und 1977, Sichtbeton. Glatte Fronten, ein Riegel in der Landschaft, kühl, technokratisch. Damals eine der größten Unikliniken in Deutschland und Europa. Oder das Zentralklinikum Augsburg, heute Uniklinikum. Erbaut zwischen 1974 und 1982. Vier Flügel jeweils über 10 Stockwerke hoch, weithin sichtbar in der Landschaft. 23 Kliniken, 6 Institute, 7.400 Mitarbeitende, 1.140 Ärzte und Ärztinnen und 3.000 Pflegende. 1.741 Betten, höchste Versorgungsstufe.
SPRECHER:
Beeindruckende Zahlen, imposante Bauwerke: Groß, unübersehbar, technisch gesehen das Beste ihrer Zeit. Doch wo bleibt der Mensch? Wer hat sich nicht schon einmal verlaufen in den unendlichen Gängen und Stockwerken dieser Häuser? Wer fühlte sich nicht eingeschüchtert allein schon beim Anblick, beim Betreten dieser Großkliniken? Dieser Typ Krankenhaus ist wohl ein Auslaufmodell. Beide Unikliniken, Großhadern und Augsburg werden abgerissen und neu gebaut. Sie sind in die Jahre gekommen. Offenbar auch der reine „Technik-Optimismus“ ihrer Bauzeit.
Musik 3: Thema – 37 Sek
SPRECHERIN:
Schon in den 1960iger Jahren gab es einen Bewusstseinswandel im Krankenhausbau, sagt die Architektin Birgit Dietz. Stichwort: „Humanisierung“. Der Mensch sollte wieder in den Mittelpunkt der medizinischen Versorgung rücken, gerade in den großen Kliniken. Auf die Frage „Wie fühlen Sie sich im Krankenhaus?“ gab es schon damals in Allensbach-Umfragen Rückmeldungen von Patienten, die ähnlich den heutigen sind. Birgit Dietz:
05 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz
„Zum Beispiel, man hat Angst, man kann sich nicht wehren, es ist endloses Warten, die Architektur ist kalt und nüchtern eingerichtet. Also, Themen, die man damals schon hatte, sind bis in die 1970iger Jahre in diesen Allensbach-Umfragen immer wieder auch dokumentiert. Und, ja, das sind die Themen, die wir jetzt auch leider, immer wieder noch haben. Weil wenn sie kucken, Klinikum Großhadern oder sowas, die sind natürlich entsprechend alt, in die Jahre gekommen. Man baut heute Krankenhäuser tatsächlich anders.“
SPRECHER:
Birgit Dietz engagiert sich im Vorstand des Verbands für Krankenhausbau und Gesundheitswesen, forscht seit Langem zu menschenfreundlicher Architektur in den Kliniken. In der Ausstellung „Das kranke Haus“, 2023 in der Münchner Pinakothek der Moderne zu sehen, befragte sie mit ihren Studierenden die Besucher zu ihren Bedürfnissen in einem Krankenhaus. Viele der Antworten, die auf Poster geschrieben wurden, drücken auch Wünsche aus, für die Architekten erstmal nicht zuständig sind.
06 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz
„Wir wünschen uns mehr Personal, Personal hilft uns unglaublich beim Gesundwerden. Die Kommunikation muss sich ändern. Patienten muss man zuhören. Man muss sie ernst nehmen und sie ausreden lassen. Ein anderer schreibt ganz einfach „eine Aussicht in die Natur, in die Berge“. Was uns da aufgefallen ist, dass sehr viel Negatives über das Essen beschrieben worden ist. Und natürlich ist das auch ein Thema, wenn ich jetzt an einen Patienten mit einer Allergie denke. Denn das ist in Krankenhäusern allem Anschein nach noch immer schwierig, auf bestimmte Allergien zu achten.“
Musik 4: On the shores of lake Zurich – 39 Sek
SPRECHERIN:
Menschen auf dem Weg der Genesung wollen sich ernst genommen, geborgen und sicher fühlen. Dazu gehört auch eine gute Orientierung, sagt Birgit Dietz. Patienten müssten wissen, wo im Krankenhaus sie sich befinden. Brauchen ein Haus mit menschlichem Maßstab, mit Blickverbindungen. Und Schutz vor möglichen Stürzen und Verletzungen. Ein weiterer wichtiger Baustein fürs Wohlfühlen ist die Akustik. Lärm auf dem Flur, Türenschlagen, laute Klimaanlagen kosten Genesenden im Krankenhaus, aber auch den Mitarbeitenden, viele Nerven.
07 Zsp. Heilsame Architektur
„Es geht um schalldämmende Türen, Wände, Decken. Wir verbauen schallabsorbierende Materialien. Wie Akustik-Unterdecken oder Schallabsorber an der Wand, die als Bild getarnt, auch optisch angenehm wirken können. Und im Bad fliesen wir zum Beispiel nicht bis an die Decke, um die schallharten Materialien zu reduzieren.“
Musik 5: Ein Toast – siehe vorn – 34 Sek
SPRECHER:
Auch auf das Licht in den Zimmern, Fluren und Gängen müsse man beim Bau eines Krankenhauses achten. Wenn Architektur heilen helfen soll, so die Architektin, muss man fragen: Wie viel Kunstlicht ist nötig, wie viel natürliches Licht ist möglich? Natürliches Licht im Raum oder bei einem Spaziergang im Garten, unterstütze den Tag-Nacht-Rhythmus, sorge für Wohlbefinden.
SPRECHERIN:
Wegbereiter einer „Healing architecture“, also einer Architektur die heilen hilft, war eine Studie aus den USA in den 1980iger Jahren. Zwei Gruppen von Patienten wurden verglichen, die im Krankenhaus nach identischen Operationen durch ihre Zimmerfenster entweder auf einen Park mit Bäumen oder auf eine Betonmauer sehen konnten. Patienten, die auf den Park sehen konnten, benötigten deutlich weniger Schmerzmittel, litten seltener an Depressionen und konnten im Schnitt einen Tag früher nach Hause entlassen werden als die Patienten der Vergleichsgruppe, so das Ergebnis. In der Folge gab es eine Reihe von weiteren Studien zu dem Thema.
Musik 6: Data stream – siehe vorn – 35 Sek
SPRECHER:
Inzwischen stehen Krankenhäuser vor neuen Herausforderungen. So hat die Corona-Pandemie gezeigt, wie baulich ungeeignet viele Krankenhäuser für die Bekämpfung einer Pandemie sind. Dazu brauche es separate Zugänge von außen, nicht wie sonst üblich einen zentralen Zugang für Alle, Personal, Besucher und Kranke. Mehr Einzelzimmer und die Möglichkeit, einzelne Bereiche nach Bedarf vom normalen Krankenhausbetrieb zu isolieren.
08 Zsp. Heilsame Architektur
„Da geht’s um Isolierstationen, so wie früher, als TBC noch ein Thema war. Dass da Schleusen sind, aber dass da auch ein Balkon vor den Zimmern ist, so dass man einfach raustreten könnte und ein bisschen Frischluft oder auch Sonne abkriegt. Das sind die Zugangssituationen, die man noch einmal anschauen müsste, Schleusen, Quarantänezonen und vor allem diese Einzelzimmer-Möglichkeit, die am schnellsten wohl durchschlagende Wirkung erzielen kann.“
SPRECHER:
Immer wichtiger beim Bau neuer Krankenhäuser sind auch die hygienischen Anforderungen, die Baumaterialien erfüllen sollten. Denn: Jahr für Jahr erkranken 500.000 Menschen an einer „Krankenhausinfektion“, zirka 10.000 Menschen jährlich sterben in Deutschland daran. Durch den jahrzehntelangen Einsatz von Antibiotika sind mittlerweile sehr viele Erreger resistent, etwa gegen Antibiotika bei einer Lungenentzündung.
SPRECHERIN:
Entsprechende Materialien könnten helfen, die Übertragungsketten zu stoppen, so Architektin Birgit Dietz. Oberflächen müssen über ihren gesamten Lebenszyklus leicht zu reinigen sein. Mechanischen Beanspruchungen standhalten, auch Chemikalien, Reinigungsmitteln. Neuere Forschungen zeigten: Bis zu einem Drittel aller Infektionen in Krankenhäusern könnten durch bessere Materialien verhindert werden.
Musik 7: Verlogene Traditionen – 55 Sek
SPRECHER:
Auch auf die Probleme und Krankheiten einer alternden Gesellschaft müssen moderne Krankenhäuser zunehmend reagieren. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums leben in Deutschland rund 1,8 Millionen Menschen mit einer Demenz. Bis zum Jahr 2050 wird die Zahl der Betroffenen voraussichtlich auf 2,8 Millionen steigen. Über die Hälfte der Menschen in Krankenhäusern ist aktuell über 65 Jahre alt, fast 40 Prozent von ihnen leiden an kognitiven Störungen und Demenz. Dafür brauche es keine eigene Architektur, so Birgit Dietz. Doch die Krankenhäuser müssten mehr Orientierung bieten, farbliche Kontraste schaffen. Etwa in Bad und Toilette, wo die Sturzgefahr für demente Menschen besonders groß ist.
09 Zsp. Heilsame Architektur
„Wenn Sie sich so ein Bad „Weiß in Weiß“ vorstellen, es gibt da keinen Kontrast, es gibt zwar netterweise eine Aufstehhilfe oder Ähnliches, aber Sie finden diese weiße Stange auf der weißen Fliese nicht. Einfach nur, weil Sie es nicht sehen. Sie finden den Weg nach Draußen aus dem Bad nicht, weil die weiße Tür in der weißen Wand schlicht und einfach nicht zu erkennen ist. Sie können nicht spülen, weil der weiße Knopf auf der weißen Wand nicht zu finden ist. Das heißt: Da gibt es eine ganze Menge an Themen, wo ich mir denke, das schadet anderen Patienten auch nicht. Lasst uns das doch im ganzen Krankenhaus realisieren.“
Musik 8: Ein Toast – siehe vorn – 1:00 Min
SPRECHERIN:
Schauen wir noch einmal ins Klinikum Agatharied, fertiggestellt 1998. Die moderne Akutklinik wird erschlossen über eine zentrale Linie, die Magistrale. Von ihr weg führen die einzelnen Module, elf Fachabteilungen von Darmkrebszentrum, Schulter- und Ellenbogenklinik, Traumazentrum bis zu Geriatrie und Psychiatrie. Die Intensivmedizin ist im hinteren Teil an den Hang gelagert, weitere Module sind auf der anderen Seite der Magistrale. Nie höher als drei Stockwerke, stets mit Lichthöfen, die Patientenzimmer gehen nach außen.
ATMO Klinikum
SPRECHER:
Bei unserer Führung mit Architekt Arndt Sänger und Referentin Nina Lutz haben wir den hellen Eingangsbereich verlassen, sind vorbei an einer Cafeteria, haben den fast kreisrunden Andachtsraum betreten, der, mit viel Holz und Licht von oben, die nötige Wärme für Trost und erholsame Gedanken bietet. An einer Sitzgruppe, ein paar Schritte weiter, können Angehörige und Patienten ausruhen, sich treffen, miteinander reden.
SPRECHERIN:
In den Fluren gibt es viel Tageslicht, die großen Fenster gehen bis zum Boden, man blickt in grüne Innenhöfe mit Schilf, Sträuchern, einem Kirschbaum. Die Magistrale ist Verteiler und bietet Aufenthaltsbereiche, so Architekt Arndt Sänger. Sie geht weit über das Funktionale hinaus, eröffnet Kommunikation.
10 Zsp. Heilsame Architektur
„Mit der Kommunikation auch so ein bisschen aus dem Krankenhaus rauskommen, in die normale Umwelt, so dass man Kontakt mit Nachbarn pflegen kann. Hier mit Zimmer-Nachbarn im öffentlichen Aufenthaltsbereich. Das werden wir gleich sehen, dass auch in diesen einzelnen Kuben mit viel Glas und offenen Materialien gearbeitet wird, damit man keine Isolation verspürt, dass man das Personal sehen kann, dass man Besucher sehen kann, dass man Leben auf den Gängen wahrnimmt, und dass man nicht total isoliert auf seiner Station oder auf seinem Zimmer liegt.“
SPRECHER:
Die „Kuben“, die einzelnen Stationen in den Modulen haben je einen zentralen Lichthof, um den sich die Zimmer und der Stützpunkt des Personals gruppieren. Um den Lichthof kann man herumlaufen oder sich dort aufhalten. Wer aus dem Zimmer tritt, hat Blickkontakt mit Patienten und Personal, man sei nie allein und fühle sich behütet, so der Architekt. Die Patientenzimmer sind Zweier-Zimmer und bieten dennoch Privatheit.
11 Zsp. Heilsame Architektur
„Also die Betten stehen nicht wie sonst im Krankenhaus nebeneinander, sondern eines steht hier, und das andere steht gegenüber, auf der anderen Seite. Und durch die Raumkonfiguration hat jeder für sich einen eigenen Bereich. Die können miteinander kommunizieren durch das schräg gegenüberstellen von den Betten, und jeder hat den Blick nach Draußen. Der Wintergarten, durch den sie schauen, also die Hälfte der Fassade wird durch den Wintergarten definiert, verglast von oben nach unten, und die zweite Hälfte durch ein Fenster direkt nach Draußen. Das heißt, sie haben frische Luft zum einen oder vor-temperierte Luft durch den Wintergarten. Das vermittelt so etwas wie Zuhause im weitesten Sinne, dass man in einem Wohnbereich sich befindet und nicht in einem Krankenhaus. Und das ist dieser heilungsunterstützende Aspekt, der hier im Vordergrund stand bei der Konzeption dieses Krankenhauses.“
Musik 9: On the Shores of Lake Zurich – siehe vorn – 1:30 Min
SPRECHERIN:
Architektur, die heilen hilft? Vieles davon ist im Klinikum Agatharied bereits realisiert. Doch die Entwicklung im Krankenhausbau geht weiter, entsprechend dem medizinisch-technischen Fortschritt. Pandemien und neuen Krankheiten. Personalmangel und Kostendruck. Auch müssen viele Kliniken fit gemacht werden für den Klimawandel, Hitze, extremes Wetter.
SPRECHER:
Ein Krankenhaus sei eben keine Maschine, sagt Architektin Christine Nickl-Weller. Über 15 Jahre hatte sie die Professur für Gesundheitsbauten an der TU Berlin inne, hat den Begriff „healing architecture“, also, „Architektur, die heilen hilft“, maßgeblich geprägt. Im Mittelpunkt jedes Krankenhauses, ob Alt- oder Neubau, sollte der Mensch sein, der krank ist und dort Heilung, Genesung sucht, so Christine Nickl-Weller.
SPRECHERIN:
Kranke und Genesende wollen ihre Autonomie behalten können, Orientierung und Selbstständigkeit erleben. Und nicht Entmündigung. Gute Krankenhaus-Architektur kann dafür sorgen. Auch Rückzugsorte schaffen, das Innen und Außen zusammenbringen, Privatheit ermöglichen. Dafür braucht es mehr Einzelzimmer. Und dazu abgetrennte Bereiche und eine Erschließung, die das Ausbreiten von Infektionen verhindert. Die Architektin spricht von künftigen Krankenhäusern als „Exzellenz-Zentren“.
12 Zsp. Heilsame Architektur Christine Nickl-Weller
„Die Exzellenz-Zentren müssen die anderen mitbedienen. Da muss der Chirurg, Spezialist auf seinem Gebiet, nicht nur in dem einen Haus, sondern im anderen mit-operieren, um diese Exzellenz wirklich überall hinzutragen, Dann kann ich dieses hohe Niveau der Gesundheitsversorgung bei uns halten. Und ich muss dann in den Quartieren natürlich kleine Anlaufpunkte, MVZ’s und dergleichen haben. Die aber auch über ein bestimmtes Niveau verfügen müssen.“
Musik 10: At a glance – 1:29 Min
SPRECHERIN:
Im Schnitt zehn Jahre dauert es vom Entwurf über die Genehmigung und Bau bis zum fertigen Krankenhaus, an die 60 Jahre kann es die zeitgemäßen Anforderungen erfüllen. Derzeit entstehen in Bayern, in Deutschland, in ganz Europa viele neue Krankenhäuser, es kommt eine neue Generation. Mit einer „Architektur, die heilen hilft“ und für künftige Herausforderungen gewappnet ist. Etwa in Memmingen, dort soll der rund 500 Millionen Euro teure Neubau des Klinikums 2029 in Betrieb gehen.
SPRECHER:
Laut Plan sollen in dem Neubau medizinische Bereiche, die interdisziplinär zusammenarbeiten, auch räumlich nah beieinander liegen. Auf den knapp 35.000 Quadratmetern Nutzfläche mit 480 stationären Betten in Ein- und Zweibettzimmern soll eine "Wohlfühlatmosphäre für Patienten und Mitarbeiter" entstehen. Es gibt eine Pandemiestation mit 28 Betten, mit separatem Zugang und eigenem Aufzug. Und Pufferflächen für den Fall, dass Operationssäle und Funktionsräume erweitert werden müssen.
SPRECHERIN:
Auch das Kantonsspital in Baden bei Zürich gehört bereits zu einer neuen Generation von Krankenhäusern – Anfang 2025 wurde es eröffnet. 360 Betten, die komplette Versorgung. Im Fokus des zentralen Baus, geplant ab 2015: die „Lebenswelt und die Arbeitswelt Krankenhaus“.
13 Zsp. Heilsame Architektur
„Wir haben alle Betten nach außen, also demokratisch nach außen. Und die Erschließungen sind von innen und in diesen inneren Bereichen gibt’s dann eben die Arbeitswelten, die Welt der Ärzte und die Versorgungswelt. Das hat also erstmalig nicht mehr nur gerade Flure, hat innen eine Vielzahl von Höfen. Die aber immer mit einer Biegung versehen sind. In den Bettenhäusern sind sechs unterschiedliche Hof-Typen, auch unterschiedlich bepflanzt, die Licht bis in die Untergeschosse bringen, unten enger, nach oben sich weiten.“
SPRECHER:
Viel Licht, viel Grün. Gänge und Höfe, die Orientierung schaffen, zum Verweilen einladen und Kommunikation ermöglichen. Die eine Perspektive in die Welt da draußen bieten, wohin sich jede und jeder Genesende sehnt. Ferner brauche es mehr Privatsphäre und Schutz vor Ansteckungen durch Einzelzimmer für die Patienten. Auch das Personal soll sich wohlfühlen, gerne „sein“ Krankenhaus betreten.
SPRECHERIN:
Dazu eine exzellente medizinische Versorgung, räumlich gut angeordnet mit kurzen Wegen, Verbindungen und Trennmöglichkeiten. Variabel für aktuelle und neue Herausforderungen, die – Stichwort Pandemie – mit Sicherheit kommen werden.
Musik 11: On the Shores of Lake Zurich – siehe vorn – 1.15 Min
SPRECHER:
„Festigkeit, Nützlichkeit, Schönheit“ – diese drei Kriterien guter Architektur hat bereits vor 2.000 Jahren der römische Architekt und Ingenieur Vitruv postuliert. Ein Bauwerk habe gut gebaut und stabil zu sein, es solle den Nutzern dienen und auch schön sein.
Dass gute Architektur im Fall eines Krankenhauses auch die Heilung unterstützen kann, hat bislang noch keiner ernsthaft verlangt. Die beiden Architektinnen Birgit Dietz und Christine Nickl-Weller formulieren es so:
14 Zsp. Heilsame Architektur Birgit Dietz und Christine Nickl-Weller
Alles, was man handfest tun kann, kann ich tatsächlich zusagen, dass wir das auf dem Schirm haben. Dass wir es versuchen, dass wir das bestmöglich machen. Ich hoffe einfach, dass wir in fünf Jahren, in zehn Jahren dann sagen können, „schaut her, so haben wir es erreicht, so haben wir es gemacht“ und wir haben Krankenhäuser, die vielleicht nicht heilen, aber die unterstützende Architektur für die Heilung anbieten, gebaut.
Also per se kann Architektur überhaupt nicht heilen, das ist ja völlig klar. Aber es kann helfen, gesund zu werden. Das ist etwas ganz was anderes.“

66 Listeners

18 Listeners
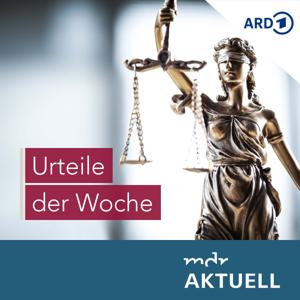
4 Listeners

44 Listeners

11 Listeners

6 Listeners

8 Listeners

5 Listeners

19 Listeners

112 Listeners

106 Listeners

48 Listeners

7 Listeners

10 Listeners

18 Listeners

0 Listeners

20 Listeners

0 Listeners

35 Listeners

10 Listeners

35 Listeners

70 Listeners

4 Listeners

1 Listeners

32 Listeners

46 Listeners

19 Listeners
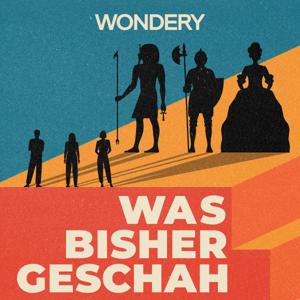
45 Listeners

1 Listeners

0 Listeners