
Sign up to save your podcasts
Or




Muskelerkrankungen sind und bleiben für jeden Kliniker, der sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzt, eine Herausforderung. Zu viele Erkrankungsbilder mit unterschiedlichen Phänotypen kommen prinzipiell in Frage.
Die heutigen diagnostischen Möglichkeiten – nicht zuletzt durch die Gendiagnostik- haben das Feld noch unübersichtlicher gemacht.
Therapeutisch hingegen bleibt bei vielen Myopathien weiterhin nur die symptomatische Therapie.
Der Morbus Pompe, eine metabolische Myopathien mit einem angeborenen Mangel an alpha-Glucosidase, stellt da eine Ausnahme dar, weil sie prinzipiell behandelbar ist. Auch wenn die Erkrankung selten ist, sollte sie daher differentialdiagnostisch erwogen werden.
Robert Rehmann, Facharzt für Neurologie und aktuell tätig in der Neurologie des Klinikum Dortmund, forscht im Muskelzentrum Bochum insbesondere im Bereich der MRT-Bildgebung bei Muskelerkrankungen und kennt sich dementsprechend gut aus.
Wir sprechen in dem heutigen Interview über den diagnostischen Algorithmus beim Morbus Pompe, die aktuellen therapeutische Möglichkeit der Enzymersatztherapie und der Therapien, die sich in der Zukunft abzeichnen.
Zu diesem Interview empfiehlt Robert die Lektüre des Artikels in der Zeitschrift DGNeurologie, Ausgabe 6/2019
Und wenn das nicht schon genug wäre: Robert hat für Euch sogar eine schriftliche Zusammenfassung aller wichtigen Fakten aus dem Interview zum Thema M.Pompe zusammengestellt:
1. Was ist ein M. Pompe?
Der M. Pompe ist eine erbliche Stoffwechselerkrankung, die sich überwiegend an der Skelett- und Atemmuskulatur manifestiert. Er zählt zu den Glykogenspeichererkrankungen und somit zu den metabolischen Muskelerkrankungen.
2. Wie sieht die typische klinische Präsentation aus? Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Typische Klinik
Sonderformen:
Laborparameter:
3. Bei welchen Patienten sollte man an dieses Krankheitsbild denken?
4. Welche diagnostischen Schritte helfen bei der Diagnosestellung? Kannst du insbesondere etwas zum Thema Genetik und Bildgebung sagen?
Muskel-MRT:
Typischerweise fettige Degeneration und Muskelödeme in der Glutealmuskulatur, den Adduktorenmuskeln (M. adductor longus + magnus) und der dorsalen Oberschenkelmuskulatur (M. semimembranosus, M. semitendinosus, M. biceps femoris) mehr und früher als in der vorderen Oberschenkelmuskulatur
Genetik:
Typischerweise autosomal rezessiver Erbgang mit Mutationen im GAA-Gen („Acid-Alpha-Glucosidase Gene“) auf distalen Ende des Chromosom 17q23. Unterschiedliche Mutationen (Insertion und Deletionen) führen zu Missense- und Nonsense-Mutationen im GAA-Gen.
Diagnostik:
In Trockenblutkartentest muss eine Misssense-, Spleiß- oder Nonsensemutation im GAA Gen nachgewiesen werden.
6. Welche Differenzialdiagnosen gibt es?
Differenzialdiagnosen sind alle anderen langsam progredienten proximal betonten Myopathien mit Beginn im (frühen) Erwachsenenalter oder Adoleszenz.
7. Wie sieht die Therapie aus?
Therapie erfolgt nach Diagnosestellung mit i.v. Enzymersatztherapie – Alglucosidase-Alpha. 20mg/kg Körpergewicht alle 2 Wochen. Infusion erfolgt vor allem in Kliniken oder großen Praxen mit Erfahrung in Infusionstherapie (endokrinologisch, hämatologisch) wegen der notwendigen Überwachung aufgrund allergischer Reaktionen.
Definition Therapiebeginn
Therapieende:
Ausblick auf kommende therapeutische Möglichkeiten im Podcast
Literatur:
Carlier, P. G. et al. Skeletal muscle quantitative nuclear magnetic resonance imaging follow-up of adult Pompe patients. J Inherit Metab Dis 38, 565–572 (2015).
Chan, J. et al. The emerging phenotype of late-onset Pompe disease: A systematic literature review. Mol. Genet. Metab. 120, 163–172 (2017).
Harlaar, L. et al. Large variation in effects during 10 years of enzyme therapy in adults with Pompe disease. Neurology 93, e1756–e1767 (2019).
Ripolone, M. et al. Effects of short-to-long term enzyme replacement therapy (ERT) on skeletal muscle tissue in late onset Pompe disease (LOPD). Neuropathol. Appl. Neurobiol. (2017) doi:10.1111/nan.12414.
Schoser, B. et al. Survival and long-term outcomes in late-onset Pompe disease following alglucosidase alfa treatment: a systematic review and meta-analysis. J. Neurol. 264, 621–630 (2017).
Schrank, B., Schoser B., Morbus Pompe mit spätem Beginn, DGNeurologie, 06/2019, S. 481 – 484
Schüller, A., Wenninger, S., Strigl-Pill, N. & Schoser, B. Toward deconstructing the phenotype of late-onset Pompe disease. Am J Med Genet C Semin Med Genet 160C, 80–88 (2012).
van Kooten, H. A. et al. Discontinuation of enzyme replacement therapy in adults with Pompe disease: Evaluating the European POmpe Consortium stop criteria. Neuromuscul. Disord. (2019) doi:10.1016/j.nmd.2019.11.007.
Zum Schluss wie immer:
**Bitte erzählt Euren Kolleginnen und Kollegen von uns, teilt die Podcasts und bewertet uns gerne bei Apple Podcasts! **Schaut doch auch gerne mal auf unseren Kanälen auf Facebook, Instagram und YouTube vorbei!!
Disclaimer:
Dieser Podcast stellt keine ärztliche Beratung dar und ersetzt keinen Arztbesuch. Er dient lediglich der Informationsvermittlung. Der Podcast ersetzt keinesfalls eine fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder Therapie von Krankheiten verwendet werden. Wir übernehmen für mögliche Nachteile oder Schäden, die aus den im Podcast gegebenen Hinweisen resultieren, keinerlei Haftung. Bei gesundheitlichen Beschwerden muss immer ein Arzt konsultiert werden!
 View all episodes
View all episodes


 By Dr. med. Kai Gruhn, Dr. med. Dietrich Sturm, Prof. Markus Wübbeler
By Dr. med. Kai Gruhn, Dr. med. Dietrich Sturm, Prof. Markus Wübbeler




5
22 ratings

Muskelerkrankungen sind und bleiben für jeden Kliniker, der sich nicht regelmäßig damit auseinandersetzt, eine Herausforderung. Zu viele Erkrankungsbilder mit unterschiedlichen Phänotypen kommen prinzipiell in Frage.
Die heutigen diagnostischen Möglichkeiten – nicht zuletzt durch die Gendiagnostik- haben das Feld noch unübersichtlicher gemacht.
Therapeutisch hingegen bleibt bei vielen Myopathien weiterhin nur die symptomatische Therapie.
Der Morbus Pompe, eine metabolische Myopathien mit einem angeborenen Mangel an alpha-Glucosidase, stellt da eine Ausnahme dar, weil sie prinzipiell behandelbar ist. Auch wenn die Erkrankung selten ist, sollte sie daher differentialdiagnostisch erwogen werden.
Robert Rehmann, Facharzt für Neurologie und aktuell tätig in der Neurologie des Klinikum Dortmund, forscht im Muskelzentrum Bochum insbesondere im Bereich der MRT-Bildgebung bei Muskelerkrankungen und kennt sich dementsprechend gut aus.
Wir sprechen in dem heutigen Interview über den diagnostischen Algorithmus beim Morbus Pompe, die aktuellen therapeutische Möglichkeit der Enzymersatztherapie und der Therapien, die sich in der Zukunft abzeichnen.
Zu diesem Interview empfiehlt Robert die Lektüre des Artikels in der Zeitschrift DGNeurologie, Ausgabe 6/2019
Und wenn das nicht schon genug wäre: Robert hat für Euch sogar eine schriftliche Zusammenfassung aller wichtigen Fakten aus dem Interview zum Thema M.Pompe zusammengestellt:
1. Was ist ein M. Pompe?
Der M. Pompe ist eine erbliche Stoffwechselerkrankung, die sich überwiegend an der Skelett- und Atemmuskulatur manifestiert. Er zählt zu den Glykogenspeichererkrankungen und somit zu den metabolischen Muskelerkrankungen.
2. Wie sieht die typische klinische Präsentation aus? Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Typische Klinik
Sonderformen:
Laborparameter:
3. Bei welchen Patienten sollte man an dieses Krankheitsbild denken?
4. Welche diagnostischen Schritte helfen bei der Diagnosestellung? Kannst du insbesondere etwas zum Thema Genetik und Bildgebung sagen?
Muskel-MRT:
Typischerweise fettige Degeneration und Muskelödeme in der Glutealmuskulatur, den Adduktorenmuskeln (M. adductor longus + magnus) und der dorsalen Oberschenkelmuskulatur (M. semimembranosus, M. semitendinosus, M. biceps femoris) mehr und früher als in der vorderen Oberschenkelmuskulatur
Genetik:
Typischerweise autosomal rezessiver Erbgang mit Mutationen im GAA-Gen („Acid-Alpha-Glucosidase Gene“) auf distalen Ende des Chromosom 17q23. Unterschiedliche Mutationen (Insertion und Deletionen) führen zu Missense- und Nonsense-Mutationen im GAA-Gen.
Diagnostik:
In Trockenblutkartentest muss eine Misssense-, Spleiß- oder Nonsensemutation im GAA Gen nachgewiesen werden.
6. Welche Differenzialdiagnosen gibt es?
Differenzialdiagnosen sind alle anderen langsam progredienten proximal betonten Myopathien mit Beginn im (frühen) Erwachsenenalter oder Adoleszenz.
7. Wie sieht die Therapie aus?
Therapie erfolgt nach Diagnosestellung mit i.v. Enzymersatztherapie – Alglucosidase-Alpha. 20mg/kg Körpergewicht alle 2 Wochen. Infusion erfolgt vor allem in Kliniken oder großen Praxen mit Erfahrung in Infusionstherapie (endokrinologisch, hämatologisch) wegen der notwendigen Überwachung aufgrund allergischer Reaktionen.
Definition Therapiebeginn
Therapieende:
Ausblick auf kommende therapeutische Möglichkeiten im Podcast
Literatur:
Carlier, P. G. et al. Skeletal muscle quantitative nuclear magnetic resonance imaging follow-up of adult Pompe patients. J Inherit Metab Dis 38, 565–572 (2015).
Chan, J. et al. The emerging phenotype of late-onset Pompe disease: A systematic literature review. Mol. Genet. Metab. 120, 163–172 (2017).
Harlaar, L. et al. Large variation in effects during 10 years of enzyme therapy in adults with Pompe disease. Neurology 93, e1756–e1767 (2019).
Ripolone, M. et al. Effects of short-to-long term enzyme replacement therapy (ERT) on skeletal muscle tissue in late onset Pompe disease (LOPD). Neuropathol. Appl. Neurobiol. (2017) doi:10.1111/nan.12414.
Schoser, B. et al. Survival and long-term outcomes in late-onset Pompe disease following alglucosidase alfa treatment: a systematic review and meta-analysis. J. Neurol. 264, 621–630 (2017).
Schrank, B., Schoser B., Morbus Pompe mit spätem Beginn, DGNeurologie, 06/2019, S. 481 – 484
Schüller, A., Wenninger, S., Strigl-Pill, N. & Schoser, B. Toward deconstructing the phenotype of late-onset Pompe disease. Am J Med Genet C Semin Med Genet 160C, 80–88 (2012).
van Kooten, H. A. et al. Discontinuation of enzyme replacement therapy in adults with Pompe disease: Evaluating the European POmpe Consortium stop criteria. Neuromuscul. Disord. (2019) doi:10.1016/j.nmd.2019.11.007.
Zum Schluss wie immer:
**Bitte erzählt Euren Kolleginnen und Kollegen von uns, teilt die Podcasts und bewertet uns gerne bei Apple Podcasts! **Schaut doch auch gerne mal auf unseren Kanälen auf Facebook, Instagram und YouTube vorbei!!
Disclaimer:
Dieser Podcast stellt keine ärztliche Beratung dar und ersetzt keinen Arztbesuch. Er dient lediglich der Informationsvermittlung. Der Podcast ersetzt keinesfalls eine fachliche Beratung durch einen Arzt oder Apotheker und er darf nicht als Grundlage zur eigenständigen Diagnose oder Therapie von Krankheiten verwendet werden. Wir übernehmen für mögliche Nachteile oder Schäden, die aus den im Podcast gegebenen Hinweisen resultieren, keinerlei Haftung. Bei gesundheitlichen Beschwerden muss immer ein Arzt konsultiert werden!

46 Listeners
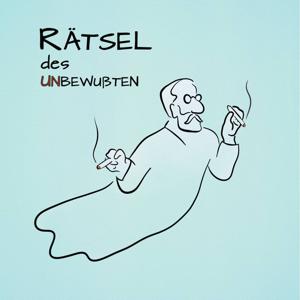
17 Listeners

6 Listeners

18 Listeners

4 Listeners

6 Listeners

14 Listeners

46 Listeners

6 Listeners

13 Listeners
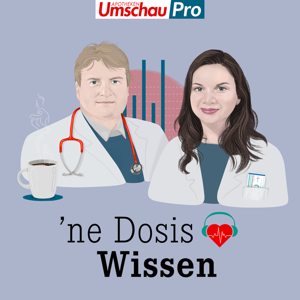
1 Listeners

28 Listeners

22 Listeners

1 Listeners

2 Listeners