
Sign up to save your podcasts
Or




Utopisch denken bedeutet zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Der Philosoph Ernst Bloch bezeichnet Utopien als "Inseln im Meer des Möglichen". Aber die sind im derzeitigen Dauerkrisenmodus Mangelware. Haben wir keine Lust mehr zu träumen? Von Claudia Heissenberg
Credits
Autorin dieser Folge: Claudia Heissenberg
Regie: Martin Trauner
Es sprachen: Hemma Michel, Friedrich Schloffer, Karin Schumacher
Technik: Andreas Lucke
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Francesca Vidal, Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und Professorin für Rhetorik an der Rheinland-pfälzischen technischen Universität Kaiserslautern-Landau;
Lina Berthold, Philosophin und Mitbegründerin der Jungen Deutschen Gesellschaft für Philosophie
Gregor Schäfer, Lehrbeauftragter für die Geschichte der Philosophie an der Universität Basel und Fellow am Londoner Ernst Bloch Centre for German Thought
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Linktipps:
Möglichkeiten der Utopie heute – Ein Radiogepräch zwischen Theodor W. Adorno und Ernst Bloch im Südwestfunk, 1964. HIER zu finden
Literatur:
Thomas MORUS (Sir Thomas More), Utopia. Für alle, die keine Angst vor alten Texten haben (geschrieben wurde das Büchlein 1515) und immer schon mal wissen wollten, wie das Leben in Utopia aussieht. Diverse Ausgaben sind antiquarisch erhältlich, kostenlos ist das Buch zu lesen auf den Webseiten: www.gutenberg.org und www.zeno.org.
Francis BACON, Neu-Atlantis. Visionäre und unterhaltsame Utopie einer Wissensgesellschaft von 1624 . Verschiedene Ausgaben antiquarisch erhältlich.
Ernst BLOCH, Das Prinzip Hoffnung. Der Philosoph ist der Meinung: Die Utopie ist kein Hirngespinst sondern eine Insel im Meer der Möglichkeiten. Denn die Hoffnung auf Veränderung besteht jederzeit.
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:50)
Ich hab' geträumt, der Winter wär' vorbei, Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien...
Zitatorin:
Es könnte alles so schön sein...
Zitator: (skeptisch)
Ach wirklich?
MUSIK 1: Ton Steine Scherben, Der Traum ist aus.
Es gab keine Angst und nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren, das war das Paradies.
Zitatorin:
Stell dir vor: Eine Welt ohne Ungleichheit, ohne Ungerechtigkeit und ohne Unterdrückung...
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
Zitator: (ungläubig)
Das ist doch utopisch!
Zitatorin:
Eine Gesellschaft, in der die Menschen mehr Wert auf Zeitwohlstand als auf finanziellen Reichtum legen.
Zitator:
Träum weiter! Das ist doch alles total utopisch.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:20)
Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Zitator: (staatstragend, aufrüttelnd, überzeugend)
Die Lage ist ernst, meine Damen und Herren! Wir leben in aufgewühlten, unruhigen Zeiten. Krisen, Kriege, Katastrophen – die Welt befindet sich in einer Art kollektiver Überlastung und Erschöpfung. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und die Zukunft neu zu denken. Wir müssen neu definieren, was Fortschritt sein soll. Wir brauchen neue Utopien.
01 Zsp. Utopien: (Francesca Vidal)
Utopie ist also etwas, was es noch nicht gibt, was ich mir aber vorstelle, wie es anders sein könnte, ... unheimlich schwierig gerade im Moment, weil wir natürlich in einer Welt leben, in der wir im Grunde die Apokalypse in Gang setzen könnten, wenn wir so weitermachen.
ERZÄHLERIN:
Francesca Vidal ist Rhetorik-Professorin an der Rheinland-pfälzischen technischen Universität Kaiserslautern-Landau und außerdem seit vielen Jahren Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft. Ernst Bloch gehörte zu den wichtigsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er schrieb unter anderem über den Geist der Utopie und das Prinzip Hoffnung. Aber gerade im derzeitigen Dauerkrisenmodus sind Visionen Mangelware.
02 Zsp. Utopien: (Lina Bertholt)
Ja, wir sind gerade nicht in der besten Zeit für Utopien, da würde ich total zustimmen. Nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe der Zeit. Und ich glaube, das war tatsächlich der Grund, warum ich Philosophie studiert habe, weil mich diese Frage fasziniert hat schon im Unterrichtsfach Philosophie, wie kann das gesellschaftliche Leben organisiert sein, damit es allen gut geht, was ist das gute Leben?
ERZÄHLERIN:
Um das herauszufinden hat Lina Berthold im Oktober 2024 die ‚Junge deutsche Gesellschaft für Philosophie‘ mitbegründet. Für die 35-jährige Philosophin sind Utopien in der aktuellen Philosophie eine Leerstelle. Was ihr fehlt, sind Visionen, die sich auf die heutige Lebenswirklichkeit beziehen. Visionen, die dringliche Fragen stellen und innovative Lösungen vorschlagen.
04 Zsp. Utopien:
Es ist eine Aufgabe, optimistisch zu bleiben und es ist eine Aufgabe an der Utopie weiter zu arbeiten und ich würde immer dazu appellieren, macht's Euch nicht so einfach.... Aber ja, die Zeit ist gerade nicht, dass sie uns dazu einlädt, es ist ja auch sehr schwierig, Menschen zum Träumen zu bewegen, wir haben kein positives Bild von Träumern oder Träumerinnen.
05 Zsp. Utopien: (Gregor Schäfer)
Es gibt irgendwie auch einen Widerstand dagegen, eine Gesellschaft und der Utopiebegriff hat ja wesentlich auch einen Bezug zum gesellschaftlichen Leben, eine Gesellschaft zu denken, die anders wäre zu dem, was nun einmal ist.
ERZÄHLERIN:
… sagt Gregor Schäfer, Lehrbeauftragter für die Geschichte der Philosophie an der Universität Basel.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:55)
ERZÄHLERIN:
Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet utopisch: realitätsfremd, illusorisch, unmöglich und zu schön, um wahr zu sein. Aber wie sagte schon der französische Schriftsteller Victor Hugo:
Zitator:
Nichts trägt im gleichen Maße wie ein Traum dazu bei, die Zukunft zu gestalten. Heute Utopia, morgen Fleisch und Blut.
ERZÄHLERIN:
Wer in diesen Tagen die Zeitung aufschlägt, Nachrichten im Radio hört oder Fernsehen schaut, wer die politischen Debatten in Deutschland verfolgt oder die Lage egal wo auf der Welt, kann schnell das Gefühl bekommen, wir stünden wenige Schritte vor dem Abgrund. Die Zukunft scheint düster. Es gibt nichts worauf, man sich freut. Aber haben wir wirklich keine Lust mehr zu träumen? Wie könnten neue Utopien aussehen? Wo ist ist überhaupt noch Platz für Utopien? Und warum ist es notwendig, utopisch zu denken?
09 Zsp. Utopien: (Vidal)
Weil jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch etwas anderes als das Bestehende zu denken, und wenn er etwas Neues erreichen will, wenn er seine Verantwortung übernehmen will, dann ist es notwendig utopisch zu denken, sich immer wieder zu überlegen, es muss nicht so sein, wie es ist.
10 Zsp. Utopien: (Berthold)
Es ist Grundvoraussetzung jedes guten menschlichen Lebens, dass man weiß, wo möchte man eigentlich hin....Aber wenn wir uns irgendwas nicht vorstellen können theoretisch, dann könne wir auch nicht dahin arbeiten, also wir müssen, glaube ich, schon einen Traum haben, um uns daran ausrichten zu können und irgendwann werden Sachen möglich, die man früher nicht für möglich gehalten hat und das beweist ja auch einfach die Vergangenheit, man hat ja nie für möglich gehalten z.B. wie unsere Realität heute ist und wir werden auch uns nicht vorstellen können, wie das Leben in 100 oder 200 Jahren ist, insofern brauchen wir auch Utopien, damit wir einen Kompass haben und wissen, in welche Richtung wir laufen wollen. ...Wo wollen wir eigentlich hin und dafür ist eine Utopie eigentlich die Grundvoraussetzung.
11 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Utopien oder auch Ideale oder auch der Begriff der Idee, was natürlich nicht alles dasselbe ist, was aber doch irgendwie zusammenhängt, haben natürlich doch auch eine sehr wichtige Stellung bei Kant, bei Fichte bei Hegel, also in der ganzen klassischen deutschen Philosophie.
ERZÄHLERIN:
Gregor Schäfer arbeitet gerade an einer Anthologie über die Utopie im deutschen Idealismus und ihre Bedeutung in der Gegenwart. Grundlage für den Sammelband ist ein Kongress, der 2024 am Londoner Ernst-Bloch-Centre for german thought stattgefunden hat.
12 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Darüber hinaus ist Utopie aber auch wirklich ein generelles Thema der Philosophie und man kann eigentlich da schon beim Anfang, in der griechischen Antike bei Platon anfangen, wo der Begriff der Utopie zwar nicht namentlich explizit vorkommt, wo er aber doch eine wichtige Funktion erfüllt in einem politischen sozial-philosophischen Zusammenhang.
ERZÄHLERIN:
In der „Politeia“ entwirft Platon schon um 370 vor Christus eine gerechte Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat und seine spezifische Aufgabe erfüllt. Privateigentum gibt es nicht, alle Güter gehören allen. Wo und wie lässt sich dieser ideale Staat verwirklichen?
13 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Platons Antwort geht da in diese Richtung, dass das eben ein Nirgendwo ist, irgendwo, irgendwie, also etwas, das eben keinen bestimmten raumzeitlichen Ort, keine Verortung zulässt. Sondern etwas, das sich dem entzieht, was man eben nur im Denken sozusagen umkreisen oder sich ihm annähern kann.
ERZÄHLERIN:
Etymologisch ist der Begriff „Utopie“ eine Zusammensetzung aus der griechischen Vorsilbe „u“, die „nicht“ bedeutet, und „topos“ - dem Ort, übersetzt also ein Nicht-Ort oder ein Nirgend-Land. Die Wortschöpfung geht zurück auf den englischen Humanisten und Staatsmann Thomas Morus. „Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia“ lautet der Titel seines gattungsprägenden Romans, der 1516 erscheint. In dem fiktiven Reisebericht beschreibt Morus das Leben auf der Insel »Utopia«, wo es keine Habgier gibt, weil niemand Wert auf persönlichen Besitz legt. Alle Kinder erhalten Schulbildung, es gibt gemeinschaftliche Mahlzeiten und gearbeitet wird nicht länger als sechs Stunden pro Tag.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
Zitator:
Drei Stunden Vormittags, worauf sie zur Mittagsmahlzeit gehen; nach dem Essen zwei Stunden Ruhezeit, dann wieder drei der Arbeit gewidmete, worauf sie mit dem Abendmahl Feierabend machen. Nach dem Abendessen verbringen sie eine Stunde mit Spielen, im Sommer in den Gärten, im Winter in den gemeinschaftlichen Speisesälen. Dort treiben sie entweder Musik, oder ergötzen sich im Gespräche. Die Muße-Zwischenzeiten verwenden die Meisten für die Wissenschaften. Denn es ist ein sehr schöner Brauch, täglich öffentlichen Unterricht zu halten.
14 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es ist bei Thomas Morus als eine geografische Utopie, im wörtlichen Sinne als eine Insel, gedacht eben doch als ein Ort, den es gibt. Es ist ein Ort, der vorhanden ist, aber der sehr weit weg und insofern uns entrückt ist oder entzogen ist, aber es ist doch so gedacht, dass es diesen Ort gibt als eine Insel.
ERZÄHLERIN
Im 18. und 19. Jahrhundert, als auch die entlegensten Ecken der Welt entdeckt sind, verlegen Utopisten ihre Visionen von einer besseren Gesellschaft vom Raum in die Zeit. Und zwar in eine nicht genau bestimmte Zukunft, wo all das möglich ist, was heute noch illusorisch erscheint. Dabei ist Vieles von dem, was früher utopisch erschien, längst Wirklichkeit oder zumindest auf dem Weg dahin. Anders als zu Morus Zeiten haben Kinder in den meisten Ländern der Welt die Möglichkeit eine Schule zu besuchen. Es gibt neue Wohnformen, wie Mehrgenerationenhäuser, Wohn- und Siedlungsgemeinschaften, die 4-Tage-Woche und andere flexible Teilzeit-Modelle werden erprobt.
16 Zsp. Utopien: (Vidal)
Wenn ich mir Gedanken mache, dass etwas anderes, etwas Neues möglich ist, dann glaube ich, ist es auch zu realisieren, da gibt es doch immer wieder Versuche von Veränderung, aber da ist etwas noch nicht geworden. Nehmen Sie die Französische Revolution, die eine Vorstellung von Gleichheit, Freiheit, Solidarität, sagen wir heute, hat, die Ideen sind doch da, die Vorstellung, ...die Vorstellung, dass die Geschlechter gleichberechtigt sein können, die ist doch da, daran können wir anknüpfen und uns überlegen, wie können wir das verwirklichen?
MUSIK: „Airlock“ – (0:35)
ERZÄHLERIN:
Wer hätte vor 300 Jahren gedacht, dass eines Tages Leibeigenschaft und Sklaverei abgeschafft und als unmenschlich verurteilt werden? Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass die Menschen zum Mond fliegen werden? Wer hätte vor 60 Jahren gedacht, dass Herztransplantationen möglich sind? Utopisch denken bedeutet zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, sagt Francesca Vidal. Kommen wir nun von der Vergangenheit zu einer Umfrage, die Lina Bertholt gerade unter den Mitgliedern der jungen deutschen Gesellschaft für Philosophie gemacht hat. Gefragt wurde: Wie stellst Du Dir eine utopische Zukunft vor?
17 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Manche jungen Philosoph:inne haben die Antwort gegeben, dass sie sich einfach Rawls Schleier des Nichtwissens wünschen als Utopie.
Zitator:
Der sogenannte ‚Schleier des Nichtwissens‘ ist ein Bestandteil der Gerechtigkeitstheorie des US-amerikanischen Philosophen John Rawls. Für ihn ist die Voraussetzung für Entscheidungen, die für alle gleichermaßen gerecht sind, dass man nicht weiß, wie sich die Entscheidung auf einen selber auswirken wird. Wer reich ist, ist befangen, wenn es um die Reichensteuer geht. Wer arm ist, urteilt anders über das Bürgergeld. Nur wenn die Menschen gar nicht wissen, ob sie wohlhabend oder mittellos sind, können sie die Frage nach sozialer Gerechtigkeit fair entscheiden. Das gilt auch für alle anderen Aspekte des Lebens.
18 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Also sie werden nicht wissen, welche Rolle sie in der zukünftigen Gesellschaft einnehmen werden, sie werden nicht wissen, sind sie eine Frau, haben sie mit einer Behinderung zu kämpfen, in welchem Teil der Welt werden sie geboren, solche Sachen sind alle nicht festgelegt, und dann würde man sozusagen unter diesem Schleier überlegen, wie müsste man die Gesellschaft aufbauen,… die gerechtes Leben für alle ermöglichen soll.
ERZÄHLERIN:
Die jungen Philosophinnen und Philosophen haben auch noch andere utopische Wunschvorstellungen.
19 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Nämlich ein geeintes Europa, in der Unterschiede eher gefeiert werden, ... oder eine Welt ohne Grenzen genannt oder Gendergerechtigkeit, viele Klimaziele oder Nachhaltigkeitsthemen, vor allem auch ein harmonisches Zusammenleben von der Spezies Mensch.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:30)
Ich hab' geträumt, der Krieg wär vorbei, Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege mehr, das war das Paradies
ERZÄHLERIN:
Keine Kriege, keine Waffen, kein Hass und kein Hunger, keine Missgunst, keine Angst und keine Armut – egal, ob auf einer fernen Insel oder in der fernen Zukunft, das Paradies sieht immer ähnlich aus.
20 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es gibt in allen Utopien eigentlich aller Zeiten, so lange es diese Gattung oder diese Form gibt, bestimmte Konstanten, bestimmte Formmerkmale, die sich immer wieder wiederholen. Bezogen jetzt auf die gesellschaftlichen Utopien sind das Motive, wie etwa die, dass in einem utopischen Staat das Allgemeinwohl über die bloßen Privatinteressen den Vorrang haben sollte, dass es da bestimmte Laster oder moralische Verwerfungen nicht mehr geben sollte, also Dinge, auf die man sich irgendwie in allen Fragen als so einen moralischen Grundkonsens wohl auch leicht einigen kann.
ERZÄHLERIN:
Dabei haben alle Utopien aber auch immer einen Bezug zu der Zeit, in der sie entstanden sind. Denn sie sind auch eine Reaktion auf herrschende Missstände und ein Gegenentwurf zum Ist-Zustand. Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern will, braucht eine Idee, wie sie anders sein könnten. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob Utopien immer schön und positiv sein müssen. Denkt ein Despot wie Putin nicht auch utopisch? Hat ein Donald Trump mit seinem „Make America great again“ nicht auch eine Vision von einer besseren Welt?
21 Zsp. Utopien: (Vidal)
Nee, der hat keinen utopischen Ansatz, mit Utopie hat das doch gar nichts zu tun, das ist ein bloßes wishful thinking, ein Wunschdenken. Oder Sie können sagen, es ist eine Dystopie, wenn Trump und Putin bald die Welt beherrschen, das wäre die größte Dystopie, die ich mir vorstellen kann im Moment aktuell.
Zitator:
Die Dystopie beschreibt im Gegensatz zur Utopie keine bessere sondern eine düstere Welt, in der es keine Hoffnung mehr gibt. Die altgriechische Vorsilbe dys- bedeutet schlecht.
Erzählerin:
Was aber den Menschen für die Zukunft wünschenswert erscheint, was sie als gut oder schlecht empfinden, ist auch eine Frage der Perspektive. In Trumps Vorstellung erblüht sein Land in neuem Glanz, sobald die illegalen Migranten verschwunden sind, internationale Verpflichtungen eingeschränkt oder ausgesetzt werden und amerikanische Interessen an erster Stelle stehen. Für ihn und seine Anhänger ist das eine positive Zukunftsvision. Auch Gregor Schäfer sieht diese Ambivalenz der Utopie.
22 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es gibt ja ganz offiziell und explizit diese Gattung der Dystopie, eine Horrorvision, eine Welt, in der alle technischen Möglichkeiten erfüllt werden. Und diese Form der Dystopie, die hat insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Aber Sie meinen noch einen anderen spannenden Punkt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass ja auch noch in Dingen, die man wohl als schlecht, als negativ bezeichnen kann, die aber doch eine Wirksamkeit entfalten können, vielleicht auch irgendwie etwas stecken muss, damit das für Leute überhaupt attraktiv wird.
ERZÄHLERIN:
Attraktiv und verlockend scheint derzeit nicht Immanuel Kants Idee vom Weltbürgertum sondern vielmehr Abschottung. Anstatt wie Kant jedem Menschen das Recht einzuräumen, in fremde Länder zu reisen, sich dort aufzuhalten und zu arbeiten, möchten einige die Grenzen für bestimmte Menschen schließen und lieber in einem Land ganz ohne Migranten leben.
23 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Aber auch in diesem steckt ja irgendwie noch eine Vorstellung einer Gemeinschaft oder eines kollektiven Lebens, das vielleicht in der Gegenwart auch zu wenig erfüllt wird. So dass die Menschen auch ein bestimmtes Bedürfnis haben solchen Schein-Utopien oder solchen schlechten Utopien zu folgen.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
ERZÄHLERIN:
Katastrophen, Kriege, Kriminalität – Nicht Visionen von einem besseren Morgen stehen derzeit im Mittelpunkt sondern immer dunklere dystopische Warnungen. 70 Prozent der Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Kinder es schlechter haben werden. Sogar der Blick in die Vergangenheit ist getrübt. Die glorreichen Eroberungen, Fortschritt und Reichtum sind ohne die Begriffe „Ausbeutung“ und „Unterdrückung“ inzwischen kaum noch denkbar. Schon 1967 verkündete übrigens der Philosoph und Politologe Herbert Marcuse das Ende der Utopie. Leben wir tatsächlich in postutopischen Zeiten? Irgendwie schon, findet Gregor Schäfer.
24 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Der allgemeine intellektuelle Konsens geht ja schon seit einigen Jahrzehnten in diese Richtung, dass wir uns von Utopien verabschieden müssten, insofern als alles, was man sich irgendwie als utopisch ausgemalt hat, heute ohne weiteres realisierbar wäre. Also wir könnten leichter denn je in der Geschichte uns eine Welt einrichten, in der es keinen Hunger und in der es keine Armut mehr gebe, das wäre keine Utopie mehr heute sondern es wäre eine reale Möglichkeit, die eigentlich letztlich auch durchaus in einem technischen oder technokratischen Sinne umsetzbar wäre.
ERZÄHLERIN:
Die Philosophinnen Francesca Vidal und Lina Berthold sehen das anders.
25 Zsp. Utopien: (Vidal)
Nein, die Zeit der Utopien ist selbstverständlich nicht vorbei, sondern alle, die das erklären, ...die stellen sich eine gesellschaftliche Zukunft vor, in der es wirklich nur dann noch um eine Verwaltung von Beständen geht, ... und dagegen wird es immer Widerstand geben.
26 Zsp. Utopien: (Berthold)
In welcher Welt lebe ich denn dann, wenn ich meinen Optimismus aufgebe? ...Dann verliere ich ja auch die Kraft für andere zu kämpfen, wenn ich sage, das ist es eh nicht wert. Deswegen: Nein! Wir müssen weiterkämpfen.
MUSIK: Ton Steine Scherben (oder Cover-Version, z.B. Universum 25 (Heavy Metal, Punk) oder Jan Plewska und Marco Smedje (Liedermacher-Style)
Der Traum ist 'n Traum, zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange, mach' dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer uns'rer Angst, es ist uns're Zukunft, unser Land, gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand.
ERZÄHLERIN:
Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern will, braucht eine Idee, wie es anders sein könnte. Wer Angst hat vor dem, was kommt, plant anders, als jemand, der zuversichtlich ist. Wer Angst hat, dem fehlt die Energie zum Aufbruch, die Lust, etwas Neues zu schaffen oder auch nur zu bedenken. Aber zu allen Zeiten gab und gibt es Visionäre und Utopistinnen, die an eine bessere Zukunft glauben und Projekte entwickeln, die Mut machen. Miteinander statt gegeneinander, Kooperation statt Konfrontation, gemeinsam statt einsam und allein.
27 Zsp. Utopien: (Berthold)
Es gibt ja Versuche, das zu leben. Ich kenne auch viele kleine oder größere Zusammenschlüsse von Menschen, die sich einen Bauernhof kaufen und versuchen da nach nachhaltigen Maßstäben in Frieden mit sich und der Natur und den Tieren, mit denen sie da sind zu leben. Das gibt es schon, ich glaube, die Utopie ist eher schwieriger, wenn sie auf globaler Ebene versucht zu greifen. Im Kleinen ist glaube ich utopisches Leben, gerade für uns in Deutschland sehr machbar.
ERZÄHLERIN:
Wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist das nicht nur nutzlose Träumerei. Die Vorstellung von Morgen bestimmt unser Handeln von heute. Neue Ideen bewirken einen Wandel in den Köpfen. Aber wenn die Visionen fehlen, bleibt nur ein großes schwarzes Loch. Natürlich gibt es die unerschütterlichen Optimisten, die daran glauben, dass sich immer alles zum Guten wendet. Oder die zumindest der Überzeugung sind, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird. Aber auch die verlieren düsteren Zeiten manchmal die Zuversicht.
28 Zsp. Utopien: (Vidal)
Das verstehe ich sehr gut und was machen Sie? Sie machen Interviews zum Thema Utopie. Ist das nicht eine Form zu sagen, okay, ich übernehme meine Verantwortung, es ist wichtig, dass man etwas dagegen macht, gegen dieses ich kann nichts mehr tun?
ERZÄHLERIN:
Schon vor ein paar Jahren hat die Unesco ein Konzept entwickelt, das Menschen befähigen soll, sich aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Es heißt „Future Literacy and Foresight“, was soviel bedeutet wie „Alphabetisierung für die Zukunft und Weitsicht“. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Menschen, die ihre Vorstellungskraft und ihr utopisches Denken trainieren, weniger fatalistisch und offener für Neues sind. Ein anderes Denken und ein erweiterter Blickwinkel sind auch nach Auffassung von Gregor Schäfer notwendige Voraussetzungen für neue Utopien.
29 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Utopie wäre irgendwie auch doch eine Veränderung des Koordinatensystems, in dem wir leben, eine Änderung nicht bloß einzelner Inhalte oder einzelner Dinge in der Welt sondern sondern sozusagen das Koordinatensystem, in dem wir die Welt überhaupt denken. Also sozusagen auch ein Perspektivenwechsel, ein neuer Horizont. Und das ist vielleicht die Arbeit, an die man sich machen muss, also diesen Perspektivenwechsel denkbar zu machen, wenn man in einem stringenten Sinne, in einem verbindlichen Sinne heute über Utopien nachdenken möchte.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:30)
30 Zsp. Utopien: (Berthold)
Ich glaube eine Utopie entspringt einem tiefen inneren Wunsch, ja einem Gefühl, einer Vorstellung, dass es ganz anders sein könnte. Und insofern ist jetzt glaube ich eine sehr gute Zeit, um anzufangen, sich zu fragen, wenn wir das alles, so wie es jetzt ist, nicht wollen, was wollen wir denn dann?
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8282 ratings

Utopisch denken bedeutet zuversichtlich in die Zukunft zu blicken. Der Philosoph Ernst Bloch bezeichnet Utopien als "Inseln im Meer des Möglichen". Aber die sind im derzeitigen Dauerkrisenmodus Mangelware. Haben wir keine Lust mehr zu träumen? Von Claudia Heissenberg
Credits
Autorin dieser Folge: Claudia Heissenberg
Regie: Martin Trauner
Es sprachen: Hemma Michel, Friedrich Schloffer, Karin Schumacher
Technik: Andreas Lucke
Redaktion: Bernhard Kastner
Im Interview:
Francesca Vidal, Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft und Professorin für Rhetorik an der Rheinland-pfälzischen technischen Universität Kaiserslautern-Landau;
Lina Berthold, Philosophin und Mitbegründerin der Jungen Deutschen Gesellschaft für Philosophie
Gregor Schäfer, Lehrbeauftragter für die Geschichte der Philosophie an der Universität Basel und Fellow am Londoner Ernst Bloch Centre for German Thought
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Linktipps:
Möglichkeiten der Utopie heute – Ein Radiogepräch zwischen Theodor W. Adorno und Ernst Bloch im Südwestfunk, 1964. HIER zu finden
Literatur:
Thomas MORUS (Sir Thomas More), Utopia. Für alle, die keine Angst vor alten Texten haben (geschrieben wurde das Büchlein 1515) und immer schon mal wissen wollten, wie das Leben in Utopia aussieht. Diverse Ausgaben sind antiquarisch erhältlich, kostenlos ist das Buch zu lesen auf den Webseiten: www.gutenberg.org und www.zeno.org.
Francis BACON, Neu-Atlantis. Visionäre und unterhaltsame Utopie einer Wissensgesellschaft von 1624 . Verschiedene Ausgaben antiquarisch erhältlich.
Ernst BLOCH, Das Prinzip Hoffnung. Der Philosoph ist der Meinung: Die Utopie ist kein Hirngespinst sondern eine Insel im Meer der Möglichkeiten. Denn die Hoffnung auf Veränderung besteht jederzeit.
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:50)
Ich hab' geträumt, der Winter wär' vorbei, Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien...
Zitatorin:
Es könnte alles so schön sein...
Zitator: (skeptisch)
Ach wirklich?
MUSIK 1: Ton Steine Scherben, Der Traum ist aus.
Es gab keine Angst und nichts zu verlieren, es war Friede bei den Menschen und unter den Tieren, das war das Paradies.
Zitatorin:
Stell dir vor: Eine Welt ohne Ungleichheit, ohne Ungerechtigkeit und ohne Unterdrückung...
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
Zitator: (ungläubig)
Das ist doch utopisch!
Zitatorin:
Eine Gesellschaft, in der die Menschen mehr Wert auf Zeitwohlstand als auf finanziellen Reichtum legen.
Zitator:
Träum weiter! Das ist doch alles total utopisch.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:20)
Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird.
Zitator: (staatstragend, aufrüttelnd, überzeugend)
Die Lage ist ernst, meine Damen und Herren! Wir leben in aufgewühlten, unruhigen Zeiten. Krisen, Kriege, Katastrophen – die Welt befindet sich in einer Art kollektiver Überlastung und Erschöpfung. Es ist an der Zeit, aufzuwachen und die Zukunft neu zu denken. Wir müssen neu definieren, was Fortschritt sein soll. Wir brauchen neue Utopien.
01 Zsp. Utopien: (Francesca Vidal)
Utopie ist also etwas, was es noch nicht gibt, was ich mir aber vorstelle, wie es anders sein könnte, ... unheimlich schwierig gerade im Moment, weil wir natürlich in einer Welt leben, in der wir im Grunde die Apokalypse in Gang setzen könnten, wenn wir so weitermachen.
ERZÄHLERIN:
Francesca Vidal ist Rhetorik-Professorin an der Rheinland-pfälzischen technischen Universität Kaiserslautern-Landau und außerdem seit vielen Jahren Präsidentin der Ernst-Bloch-Gesellschaft. Ernst Bloch gehörte zu den wichtigsten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts. Er schrieb unter anderem über den Geist der Utopie und das Prinzip Hoffnung. Aber gerade im derzeitigen Dauerkrisenmodus sind Visionen Mangelware.
02 Zsp. Utopien: (Lina Bertholt)
Ja, wir sind gerade nicht in der besten Zeit für Utopien, da würde ich total zustimmen. Nichtsdestotrotz ist es die Aufgabe der Zeit. Und ich glaube, das war tatsächlich der Grund, warum ich Philosophie studiert habe, weil mich diese Frage fasziniert hat schon im Unterrichtsfach Philosophie, wie kann das gesellschaftliche Leben organisiert sein, damit es allen gut geht, was ist das gute Leben?
ERZÄHLERIN:
Um das herauszufinden hat Lina Berthold im Oktober 2024 die ‚Junge deutsche Gesellschaft für Philosophie‘ mitbegründet. Für die 35-jährige Philosophin sind Utopien in der aktuellen Philosophie eine Leerstelle. Was ihr fehlt, sind Visionen, die sich auf die heutige Lebenswirklichkeit beziehen. Visionen, die dringliche Fragen stellen und innovative Lösungen vorschlagen.
04 Zsp. Utopien:
Es ist eine Aufgabe, optimistisch zu bleiben und es ist eine Aufgabe an der Utopie weiter zu arbeiten und ich würde immer dazu appellieren, macht's Euch nicht so einfach.... Aber ja, die Zeit ist gerade nicht, dass sie uns dazu einlädt, es ist ja auch sehr schwierig, Menschen zum Träumen zu bewegen, wir haben kein positives Bild von Träumern oder Träumerinnen.
05 Zsp. Utopien: (Gregor Schäfer)
Es gibt irgendwie auch einen Widerstand dagegen, eine Gesellschaft und der Utopiebegriff hat ja wesentlich auch einen Bezug zum gesellschaftlichen Leben, eine Gesellschaft zu denken, die anders wäre zu dem, was nun einmal ist.
ERZÄHLERIN:
… sagt Gregor Schäfer, Lehrbeauftragter für die Geschichte der Philosophie an der Universität Basel.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:55)
ERZÄHLERIN:
Im allgemeinen Sprachgebrauch bedeutet utopisch: realitätsfremd, illusorisch, unmöglich und zu schön, um wahr zu sein. Aber wie sagte schon der französische Schriftsteller Victor Hugo:
Zitator:
Nichts trägt im gleichen Maße wie ein Traum dazu bei, die Zukunft zu gestalten. Heute Utopia, morgen Fleisch und Blut.
ERZÄHLERIN:
Wer in diesen Tagen die Zeitung aufschlägt, Nachrichten im Radio hört oder Fernsehen schaut, wer die politischen Debatten in Deutschland verfolgt oder die Lage egal wo auf der Welt, kann schnell das Gefühl bekommen, wir stünden wenige Schritte vor dem Abgrund. Die Zukunft scheint düster. Es gibt nichts worauf, man sich freut. Aber haben wir wirklich keine Lust mehr zu träumen? Wie könnten neue Utopien aussehen? Wo ist ist überhaupt noch Platz für Utopien? Und warum ist es notwendig, utopisch zu denken?
09 Zsp. Utopien: (Vidal)
Weil jeder Mensch die Möglichkeit hat, auch etwas anderes als das Bestehende zu denken, und wenn er etwas Neues erreichen will, wenn er seine Verantwortung übernehmen will, dann ist es notwendig utopisch zu denken, sich immer wieder zu überlegen, es muss nicht so sein, wie es ist.
10 Zsp. Utopien: (Berthold)
Es ist Grundvoraussetzung jedes guten menschlichen Lebens, dass man weiß, wo möchte man eigentlich hin....Aber wenn wir uns irgendwas nicht vorstellen können theoretisch, dann könne wir auch nicht dahin arbeiten, also wir müssen, glaube ich, schon einen Traum haben, um uns daran ausrichten zu können und irgendwann werden Sachen möglich, die man früher nicht für möglich gehalten hat und das beweist ja auch einfach die Vergangenheit, man hat ja nie für möglich gehalten z.B. wie unsere Realität heute ist und wir werden auch uns nicht vorstellen können, wie das Leben in 100 oder 200 Jahren ist, insofern brauchen wir auch Utopien, damit wir einen Kompass haben und wissen, in welche Richtung wir laufen wollen. ...Wo wollen wir eigentlich hin und dafür ist eine Utopie eigentlich die Grundvoraussetzung.
11 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Utopien oder auch Ideale oder auch der Begriff der Idee, was natürlich nicht alles dasselbe ist, was aber doch irgendwie zusammenhängt, haben natürlich doch auch eine sehr wichtige Stellung bei Kant, bei Fichte bei Hegel, also in der ganzen klassischen deutschen Philosophie.
ERZÄHLERIN:
Gregor Schäfer arbeitet gerade an einer Anthologie über die Utopie im deutschen Idealismus und ihre Bedeutung in der Gegenwart. Grundlage für den Sammelband ist ein Kongress, der 2024 am Londoner Ernst-Bloch-Centre for german thought stattgefunden hat.
12 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Darüber hinaus ist Utopie aber auch wirklich ein generelles Thema der Philosophie und man kann eigentlich da schon beim Anfang, in der griechischen Antike bei Platon anfangen, wo der Begriff der Utopie zwar nicht namentlich explizit vorkommt, wo er aber doch eine wichtige Funktion erfüllt in einem politischen sozial-philosophischen Zusammenhang.
ERZÄHLERIN:
In der „Politeia“ entwirft Platon schon um 370 vor Christus eine gerechte Gesellschaft, in der jeder seinen Platz hat und seine spezifische Aufgabe erfüllt. Privateigentum gibt es nicht, alle Güter gehören allen. Wo und wie lässt sich dieser ideale Staat verwirklichen?
13 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Platons Antwort geht da in diese Richtung, dass das eben ein Nirgendwo ist, irgendwo, irgendwie, also etwas, das eben keinen bestimmten raumzeitlichen Ort, keine Verortung zulässt. Sondern etwas, das sich dem entzieht, was man eben nur im Denken sozusagen umkreisen oder sich ihm annähern kann.
ERZÄHLERIN:
Etymologisch ist der Begriff „Utopie“ eine Zusammensetzung aus der griechischen Vorsilbe „u“, die „nicht“ bedeutet, und „topos“ - dem Ort, übersetzt also ein Nicht-Ort oder ein Nirgend-Land. Die Wortschöpfung geht zurück auf den englischen Humanisten und Staatsmann Thomas Morus. „Von der besten Verfassung des Staates und von der neuen Insel Utopia“ lautet der Titel seines gattungsprägenden Romans, der 1516 erscheint. In dem fiktiven Reisebericht beschreibt Morus das Leben auf der Insel »Utopia«, wo es keine Habgier gibt, weil niemand Wert auf persönlichen Besitz legt. Alle Kinder erhalten Schulbildung, es gibt gemeinschaftliche Mahlzeiten und gearbeitet wird nicht länger als sechs Stunden pro Tag.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
Zitator:
Drei Stunden Vormittags, worauf sie zur Mittagsmahlzeit gehen; nach dem Essen zwei Stunden Ruhezeit, dann wieder drei der Arbeit gewidmete, worauf sie mit dem Abendmahl Feierabend machen. Nach dem Abendessen verbringen sie eine Stunde mit Spielen, im Sommer in den Gärten, im Winter in den gemeinschaftlichen Speisesälen. Dort treiben sie entweder Musik, oder ergötzen sich im Gespräche. Die Muße-Zwischenzeiten verwenden die Meisten für die Wissenschaften. Denn es ist ein sehr schöner Brauch, täglich öffentlichen Unterricht zu halten.
14 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es ist bei Thomas Morus als eine geografische Utopie, im wörtlichen Sinne als eine Insel, gedacht eben doch als ein Ort, den es gibt. Es ist ein Ort, der vorhanden ist, aber der sehr weit weg und insofern uns entrückt ist oder entzogen ist, aber es ist doch so gedacht, dass es diesen Ort gibt als eine Insel.
ERZÄHLERIN
Im 18. und 19. Jahrhundert, als auch die entlegensten Ecken der Welt entdeckt sind, verlegen Utopisten ihre Visionen von einer besseren Gesellschaft vom Raum in die Zeit. Und zwar in eine nicht genau bestimmte Zukunft, wo all das möglich ist, was heute noch illusorisch erscheint. Dabei ist Vieles von dem, was früher utopisch erschien, längst Wirklichkeit oder zumindest auf dem Weg dahin. Anders als zu Morus Zeiten haben Kinder in den meisten Ländern der Welt die Möglichkeit eine Schule zu besuchen. Es gibt neue Wohnformen, wie Mehrgenerationenhäuser, Wohn- und Siedlungsgemeinschaften, die 4-Tage-Woche und andere flexible Teilzeit-Modelle werden erprobt.
16 Zsp. Utopien: (Vidal)
Wenn ich mir Gedanken mache, dass etwas anderes, etwas Neues möglich ist, dann glaube ich, ist es auch zu realisieren, da gibt es doch immer wieder Versuche von Veränderung, aber da ist etwas noch nicht geworden. Nehmen Sie die Französische Revolution, die eine Vorstellung von Gleichheit, Freiheit, Solidarität, sagen wir heute, hat, die Ideen sind doch da, die Vorstellung, ...die Vorstellung, dass die Geschlechter gleichberechtigt sein können, die ist doch da, daran können wir anknüpfen und uns überlegen, wie können wir das verwirklichen?
MUSIK: „Airlock“ – (0:35)
ERZÄHLERIN:
Wer hätte vor 300 Jahren gedacht, dass eines Tages Leibeigenschaft und Sklaverei abgeschafft und als unmenschlich verurteilt werden? Wer hätte vor 100 Jahren gedacht, dass die Menschen zum Mond fliegen werden? Wer hätte vor 60 Jahren gedacht, dass Herztransplantationen möglich sind? Utopisch denken bedeutet zuversichtlich in die Zukunft zu blicken, sagt Francesca Vidal. Kommen wir nun von der Vergangenheit zu einer Umfrage, die Lina Bertholt gerade unter den Mitgliedern der jungen deutschen Gesellschaft für Philosophie gemacht hat. Gefragt wurde: Wie stellst Du Dir eine utopische Zukunft vor?
17 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Manche jungen Philosoph:inne haben die Antwort gegeben, dass sie sich einfach Rawls Schleier des Nichtwissens wünschen als Utopie.
Zitator:
Der sogenannte ‚Schleier des Nichtwissens‘ ist ein Bestandteil der Gerechtigkeitstheorie des US-amerikanischen Philosophen John Rawls. Für ihn ist die Voraussetzung für Entscheidungen, die für alle gleichermaßen gerecht sind, dass man nicht weiß, wie sich die Entscheidung auf einen selber auswirken wird. Wer reich ist, ist befangen, wenn es um die Reichensteuer geht. Wer arm ist, urteilt anders über das Bürgergeld. Nur wenn die Menschen gar nicht wissen, ob sie wohlhabend oder mittellos sind, können sie die Frage nach sozialer Gerechtigkeit fair entscheiden. Das gilt auch für alle anderen Aspekte des Lebens.
18 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Also sie werden nicht wissen, welche Rolle sie in der zukünftigen Gesellschaft einnehmen werden, sie werden nicht wissen, sind sie eine Frau, haben sie mit einer Behinderung zu kämpfen, in welchem Teil der Welt werden sie geboren, solche Sachen sind alle nicht festgelegt, und dann würde man sozusagen unter diesem Schleier überlegen, wie müsste man die Gesellschaft aufbauen,… die gerechtes Leben für alle ermöglichen soll.
ERZÄHLERIN:
Die jungen Philosophinnen und Philosophen haben auch noch andere utopische Wunschvorstellungen.
19 Zsp. Utopien: (Bertholt)
Nämlich ein geeintes Europa, in der Unterschiede eher gefeiert werden, ... oder eine Welt ohne Grenzen genannt oder Gendergerechtigkeit, viele Klimaziele oder Nachhaltigkeitsthemen, vor allem auch ein harmonisches Zusammenleben von der Spezies Mensch.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:30)
Ich hab' geträumt, der Krieg wär vorbei, Du warst hier und wir waren frei und die Morgensonne schien. Alle Türen waren offen, die Gefängnisse leer, es gab keine Waffen und keine Kriege mehr, das war das Paradies
ERZÄHLERIN:
Keine Kriege, keine Waffen, kein Hass und kein Hunger, keine Missgunst, keine Angst und keine Armut – egal, ob auf einer fernen Insel oder in der fernen Zukunft, das Paradies sieht immer ähnlich aus.
20 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es gibt in allen Utopien eigentlich aller Zeiten, so lange es diese Gattung oder diese Form gibt, bestimmte Konstanten, bestimmte Formmerkmale, die sich immer wieder wiederholen. Bezogen jetzt auf die gesellschaftlichen Utopien sind das Motive, wie etwa die, dass in einem utopischen Staat das Allgemeinwohl über die bloßen Privatinteressen den Vorrang haben sollte, dass es da bestimmte Laster oder moralische Verwerfungen nicht mehr geben sollte, also Dinge, auf die man sich irgendwie in allen Fragen als so einen moralischen Grundkonsens wohl auch leicht einigen kann.
ERZÄHLERIN:
Dabei haben alle Utopien aber auch immer einen Bezug zu der Zeit, in der sie entstanden sind. Denn sie sind auch eine Reaktion auf herrschende Missstände und ein Gegenentwurf zum Ist-Zustand. Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern will, braucht eine Idee, wie sie anders sein könnten. Dabei stellt sich natürlich die Frage, ob Utopien immer schön und positiv sein müssen. Denkt ein Despot wie Putin nicht auch utopisch? Hat ein Donald Trump mit seinem „Make America great again“ nicht auch eine Vision von einer besseren Welt?
21 Zsp. Utopien: (Vidal)
Nee, der hat keinen utopischen Ansatz, mit Utopie hat das doch gar nichts zu tun, das ist ein bloßes wishful thinking, ein Wunschdenken. Oder Sie können sagen, es ist eine Dystopie, wenn Trump und Putin bald die Welt beherrschen, das wäre die größte Dystopie, die ich mir vorstellen kann im Moment aktuell.
Zitator:
Die Dystopie beschreibt im Gegensatz zur Utopie keine bessere sondern eine düstere Welt, in der es keine Hoffnung mehr gibt. Die altgriechische Vorsilbe dys- bedeutet schlecht.
Erzählerin:
Was aber den Menschen für die Zukunft wünschenswert erscheint, was sie als gut oder schlecht empfinden, ist auch eine Frage der Perspektive. In Trumps Vorstellung erblüht sein Land in neuem Glanz, sobald die illegalen Migranten verschwunden sind, internationale Verpflichtungen eingeschränkt oder ausgesetzt werden und amerikanische Interessen an erster Stelle stehen. Für ihn und seine Anhänger ist das eine positive Zukunftsvision. Auch Gregor Schäfer sieht diese Ambivalenz der Utopie.
22 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Es gibt ja ganz offiziell und explizit diese Gattung der Dystopie, eine Horrorvision, eine Welt, in der alle technischen Möglichkeiten erfüllt werden. Und diese Form der Dystopie, die hat insbesondere in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle. Aber Sie meinen noch einen anderen spannenden Punkt, wenn ich Sie richtig verstehe, dass ja auch noch in Dingen, die man wohl als schlecht, als negativ bezeichnen kann, die aber doch eine Wirksamkeit entfalten können, vielleicht auch irgendwie etwas stecken muss, damit das für Leute überhaupt attraktiv wird.
ERZÄHLERIN:
Attraktiv und verlockend scheint derzeit nicht Immanuel Kants Idee vom Weltbürgertum sondern vielmehr Abschottung. Anstatt wie Kant jedem Menschen das Recht einzuräumen, in fremde Länder zu reisen, sich dort aufzuhalten und zu arbeiten, möchten einige die Grenzen für bestimmte Menschen schließen und lieber in einem Land ganz ohne Migranten leben.
23 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Aber auch in diesem steckt ja irgendwie noch eine Vorstellung einer Gemeinschaft oder eines kollektiven Lebens, das vielleicht in der Gegenwart auch zu wenig erfüllt wird. So dass die Menschen auch ein bestimmtes Bedürfnis haben solchen Schein-Utopien oder solchen schlechten Utopien zu folgen.
MUSIK: „Above the earth“ – (0:35)
ERZÄHLERIN:
Katastrophen, Kriege, Kriminalität – Nicht Visionen von einem besseren Morgen stehen derzeit im Mittelpunkt sondern immer dunklere dystopische Warnungen. 70 Prozent der Eltern sind davon überzeugt, dass ihre Kinder es schlechter haben werden. Sogar der Blick in die Vergangenheit ist getrübt. Die glorreichen Eroberungen, Fortschritt und Reichtum sind ohne die Begriffe „Ausbeutung“ und „Unterdrückung“ inzwischen kaum noch denkbar. Schon 1967 verkündete übrigens der Philosoph und Politologe Herbert Marcuse das Ende der Utopie. Leben wir tatsächlich in postutopischen Zeiten? Irgendwie schon, findet Gregor Schäfer.
24 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Der allgemeine intellektuelle Konsens geht ja schon seit einigen Jahrzehnten in diese Richtung, dass wir uns von Utopien verabschieden müssten, insofern als alles, was man sich irgendwie als utopisch ausgemalt hat, heute ohne weiteres realisierbar wäre. Also wir könnten leichter denn je in der Geschichte uns eine Welt einrichten, in der es keinen Hunger und in der es keine Armut mehr gebe, das wäre keine Utopie mehr heute sondern es wäre eine reale Möglichkeit, die eigentlich letztlich auch durchaus in einem technischen oder technokratischen Sinne umsetzbar wäre.
ERZÄHLERIN:
Die Philosophinnen Francesca Vidal und Lina Berthold sehen das anders.
25 Zsp. Utopien: (Vidal)
Nein, die Zeit der Utopien ist selbstverständlich nicht vorbei, sondern alle, die das erklären, ...die stellen sich eine gesellschaftliche Zukunft vor, in der es wirklich nur dann noch um eine Verwaltung von Beständen geht, ... und dagegen wird es immer Widerstand geben.
26 Zsp. Utopien: (Berthold)
In welcher Welt lebe ich denn dann, wenn ich meinen Optimismus aufgebe? ...Dann verliere ich ja auch die Kraft für andere zu kämpfen, wenn ich sage, das ist es eh nicht wert. Deswegen: Nein! Wir müssen weiterkämpfen.
MUSIK: Ton Steine Scherben (oder Cover-Version, z.B. Universum 25 (Heavy Metal, Punk) oder Jan Plewska und Marco Smedje (Liedermacher-Style)
Der Traum ist 'n Traum, zu dieser Zeit, doch nicht mehr lange, mach' dich bereit für den Kampf ums Paradies. Wir haben nichts zu verlieren, außer uns'rer Angst, es ist uns're Zukunft, unser Land, gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand.
ERZÄHLERIN:
Wer die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern will, braucht eine Idee, wie es anders sein könnte. Wer Angst hat vor dem, was kommt, plant anders, als jemand, der zuversichtlich ist. Wer Angst hat, dem fehlt die Energie zum Aufbruch, die Lust, etwas Neues zu schaffen oder auch nur zu bedenken. Aber zu allen Zeiten gab und gibt es Visionäre und Utopistinnen, die an eine bessere Zukunft glauben und Projekte entwickeln, die Mut machen. Miteinander statt gegeneinander, Kooperation statt Konfrontation, gemeinsam statt einsam und allein.
27 Zsp. Utopien: (Berthold)
Es gibt ja Versuche, das zu leben. Ich kenne auch viele kleine oder größere Zusammenschlüsse von Menschen, die sich einen Bauernhof kaufen und versuchen da nach nachhaltigen Maßstäben in Frieden mit sich und der Natur und den Tieren, mit denen sie da sind zu leben. Das gibt es schon, ich glaube, die Utopie ist eher schwieriger, wenn sie auf globaler Ebene versucht zu greifen. Im Kleinen ist glaube ich utopisches Leben, gerade für uns in Deutschland sehr machbar.
ERZÄHLERIN:
Wenn wir über die Zukunft nachdenken, ist das nicht nur nutzlose Träumerei. Die Vorstellung von Morgen bestimmt unser Handeln von heute. Neue Ideen bewirken einen Wandel in den Köpfen. Aber wenn die Visionen fehlen, bleibt nur ein großes schwarzes Loch. Natürlich gibt es die unerschütterlichen Optimisten, die daran glauben, dass sich immer alles zum Guten wendet. Oder die zumindest der Überzeugung sind, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht wird. Aber auch die verlieren düsteren Zeiten manchmal die Zuversicht.
28 Zsp. Utopien: (Vidal)
Das verstehe ich sehr gut und was machen Sie? Sie machen Interviews zum Thema Utopie. Ist das nicht eine Form zu sagen, okay, ich übernehme meine Verantwortung, es ist wichtig, dass man etwas dagegen macht, gegen dieses ich kann nichts mehr tun?
ERZÄHLERIN:
Schon vor ein paar Jahren hat die Unesco ein Konzept entwickelt, das Menschen befähigen soll, sich aktiv mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Es heißt „Future Literacy and Foresight“, was soviel bedeutet wie „Alphabetisierung für die Zukunft und Weitsicht“. Dahinter steckt die Erkenntnis, dass Menschen, die ihre Vorstellungskraft und ihr utopisches Denken trainieren, weniger fatalistisch und offener für Neues sind. Ein anderes Denken und ein erweiterter Blickwinkel sind auch nach Auffassung von Gregor Schäfer notwendige Voraussetzungen für neue Utopien.
29 Zsp. Utopien: (Schäfer)
Utopie wäre irgendwie auch doch eine Veränderung des Koordinatensystems, in dem wir leben, eine Änderung nicht bloß einzelner Inhalte oder einzelner Dinge in der Welt sondern sondern sozusagen das Koordinatensystem, in dem wir die Welt überhaupt denken. Also sozusagen auch ein Perspektivenwechsel, ein neuer Horizont. Und das ist vielleicht die Arbeit, an die man sich machen muss, also diesen Perspektivenwechsel denkbar zu machen, wenn man in einem stringenten Sinne, in einem verbindlichen Sinne heute über Utopien nachdenken möchte.
MUSIK: “Der Traum ist aus“ – (0:30)
30 Zsp. Utopien: (Berthold)
Ich glaube eine Utopie entspringt einem tiefen inneren Wunsch, ja einem Gefühl, einer Vorstellung, dass es ganz anders sein könnte. Und insofern ist jetzt glaube ich eine sehr gute Zeit, um anzufangen, sich zu fragen, wenn wir das alles, so wie es jetzt ist, nicht wollen, was wollen wir denn dann?

69 Listeners

18 Listeners
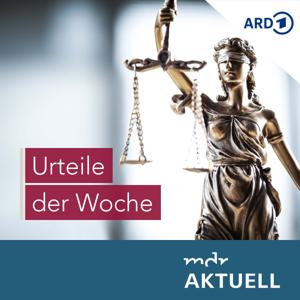
4 Listeners

46 Listeners

9 Listeners

6 Listeners

7 Listeners

5 Listeners

18 Listeners

114 Listeners

106 Listeners

48 Listeners

7 Listeners

9 Listeners

18 Listeners

0 Listeners

22 Listeners

0 Listeners

34 Listeners

10 Listeners

35 Listeners

64 Listeners

4 Listeners

1 Listeners

33 Listeners

45 Listeners

18 Listeners
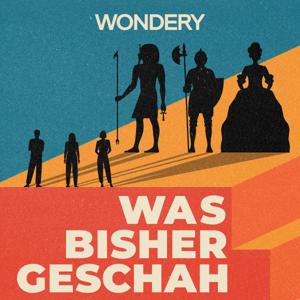
44 Listeners

1 Listeners

1 Listeners