
Sign up to save your podcasts
Or




Notruf 112 wählen, maximal 15 Minuten warten - dann ist sie da: die Feuerwehr. Das war nicht immer so: dass wir schnelle und effektive Hilfe in der Not bekommen, ist das Ergebnis einer ereignisreichen Entwicklungsgeschichte. (BR 2022)
Credits:
Autor/in dieser Folge: Christiane Neukirch
Regie: Christiane Klenz
Es sprachen: Anne-Isabelle Zils und Stefan Wilkening
Technik: Roland Böhm
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview:
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Feuerwehrmuseum Bayern e.V. in Waldkraiburg
Das Museum – im oberbayerischen Waldkraiburg gelegen, ist ein Juwel, das einen Besuch mehr als lohnt: als größtes Feuerwehrmuseum Deutschlands – und ausschließlich von ehrenamtlichen Betreibern geführt – bietet es eine einzigartige und hervorragend kommentierte Sammlung an Fahrzeugen, Geräten, Uniformen, Feuermeldern, Modellen u.v.m. vom Beginn des deutschen Feuerwehrwesens bis heute: Mehr Infos unter:
EXTERNER LINK | https://www.feuerwehrmuseum-bayern.de/
Literaturtipps:
Prager, Hans-Georg: Florian 14: Achter Alarm! Das Buch der Feuerwehr. Verlag Mittler & Sohn, Herford 1980 (3. Auflage):
Dieses Buch gibt bis heute den umfassendsten und zugleich nahbarsten Einblick in die Welt der Feuerwehr. Der Journalist Hans-Georg Prager arbeitete ein halbes Jahr lang als vollwertiges Mitglied der Hamburger Feuerwehr mit.
Lottmann, Eckart: Berliner Feuerwehr. Auf der Drehleiter der Geschichte. Be.bra Verlag, Berlin, 1996
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ERZÄHLERIN:
Ein Löschzug der Feuerwehr unterwegs zum Einsatz. Jemand hat den Notruf 112 gewählt. Von jetzt kann man damit rechnen: in spätestens 12 Minuten ist Hilfe da. Das ist die Frist, in der die Feuerwehr hierzulande vor Ort sein muss. Damit das geschehen kann, stehen allein in Deutschland mehr als eine Million Feuerwehrleute bereit, Tag und Nacht.
Sprecher
Dabei ist der Name „Feuerwehr“ ein bisschen irreführend: denn sie leistet Hilfe nicht nur bei Bränden. Löschen ist nur ein Teil der vier Tätigkeiten, die das Motto des Deutschen Feuerwehrverbandes bilden. Das sind:
Retten – Löschen – Bergen und Schützen.
ERZÄHLERIN:
Dazu gehört die Notfallrettung ebenso wie die technische Hilfeleistung. Doch das Feuer hat unsere Geschichte besonders stark geprägt – und damit auch die Notwendigkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Daher soll es in dieser Sendung hauptsächlich darum gehen.
ATMO: Feuer knistert
SPRECHER:
Feuer war lange Zeit zunächst eines: eine Naturgewalt, entfacht durch Blitz oder Funkenflug. Dass der Mensch das Element gezähmt und für seine Zwecke nutzbar gemacht hat, dürfte die Entwicklung unserer Spezies maßgeblich beeinflusst haben. Feuer half als Schutz vor wilden Tieren, machte Nahrung durch Erhitzen leichter verdaulich und ermöglichte schließlich auch die Herstellung diversester Gebrauchsgegenstände.
MUSIK 2 (Imogen Heap: The Fire)
ERZÄHLERIN:
Doch es gab auch die Kehrseite: Feuer geriet leicht außer Kontrolle und konnte Zerstörung und Tod bedeuten.
MUSIK 3 (Gothic Voices: O Ignis Spiritus)
SPRECHER:
Jahrtausende lang betrachtete man Brände als eine Strafe Gottes – und nahm sie als Schicksal hin. Im Mittelalter wurde von der Kanzel herunter oft sogar verboten, Feuer zu bekämpfen: denn das hieß ja, Gottes Strafe zurückzuweisen.
MUSIK 4 (Conrad Steinmann: Nomos M)
ERZÄHLERIN:
In der Antike begannen vor allem die Griechen und die Römer, die Brandbekämpfung pragmatisch zu betrachten. Speziell im alten Rom war die Lage oft brenzlig: in der dicht bebauten Hauptstadt des Römischen Reiches herrschte durch den regen Zuzug Wohnungsnot. So wurden in Eile windige Mietskasernen aus Lehm und Stroh hochgezogen, deren Statik eine Katastrophe war. So oft gingen Gebäude in Flammen auf, dass der Senat beschloss, etwas dagegen zu unternehmen.
Markus Zawadke, Kurator des Feuerwehrmuseums Bayern in Waldkraiburg, hat die Geschichte der Feuerwehr von Anbeginn im Blick.
ZUSPIELER 1 (O Ton Zawadke)
Griechen und die Römer waren uns ja schon um Tausende von Jahren voraus. Haben tatsächlich die Pumpe erfunden, haben tatsächlich den Schlauch erfunden und haben tatsächlich auch schon die Feuerwehr erfunden. Das gab es alles im römischen und im griechischen Reich und ist auch teilweise bis zur Perfektion schon entwickelt worden. Wir wissen alle, das Römischen Reich ist untergegangen, die Griechen damit übrigens auch. Und dann ist das alles in Vergessenheit geraten. Gerade in Deutschland, und in Deutschland herrschte einfach noch tiefstes Mittelalter, und da hat halt schlicht und einfach der Landmann wie der Bauer wie das Gesindel einfach nur den Eimer gekannt und die Eimerkette.
ERZÄHLERIN:
Und so sahen sich die im Mittelalter wieder wachsenden Siedlungen der Gefahr hilflos gegenüber. Die Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert gilt als Epoche der großen Stadtbrände. Unzählige Städte wurden durch Feuer komplett zerstört – manche davon nicht nur einmal. In den – eng an eng stehenden – Holzhäusern gab es keine Kamine: geheizt und gekocht wurde mit einem offenen Feuer; der Rauchabzug war ein Loch im Strohdach. Ein ungünstiger Funkenflug, und alles stand in Flammen. Selbst jene Hausbesitzer, die brav ihren Ledereimer mit Wasser bereithielten, konnten nur dann noch Schlimmeres verhindern, wenn sie schnell reagierten, gegen größere Brände konnte man selbst mit vereinten Eimern und Kräften kaum noch etwas ausrichten.
ATMO: Sturmglocken, Feuer
MUSIK 5 (Ennio Morricone: Overture)
ERZÄHLERIN:
Während immer noch viele Menschen die Katastrophen als gottgegeben hinnahmen, regte sich doch auch immer mehr der Wille zur Gegenwehr.
Nach dem großen Brand von London im Jahr 1189 gab die Stadt eine Feuerschutzordnung heraus: jeder Hausbesitzer hatte von nun an ein Fass mit Wasser bereitzuhalten. Nachts patrouillierten Wächter durch die Straßen. Andere Städte zogen nach. In Hamburg hatten Türmer von oben ein Auge auf Brandherde.
Doch trotz alledem wurde es in den folgenden Jahrhunderten nicht viel besser.
ZUSPIELER 2 (O Zawadke)
Das Problem war: eigentlich die Städte, wie sie sich entwickelt haben. Man hat Handel betrieben, die Städte sind reich geworden, teilweise natürlich durch den Handel, haben das durch eine entsprechende Bebauung auch gezeigt. Also Wohnungsnot, die gibt es nicht nur heute, sondern die war damals auch schon um 1500,1600,1700 in den Städten durchaus vorhanden. Das heißt, die wurden enger gebaut. Es wurden auf die ersten Stockwerke zweite Stockwerke, dritte Stockwerke gesetzt, die teilweise auch sehr chaotisch gebaut worden sind. Man denkt also nur mal an London, wo das erste Stockwerk dann schon in die Straße reingeragt hat und das zweite und dritte Stockwerk noch weiter, weil man dafür eben keine Steuern bezahlen musste. Man hat eben nur unten einmal die unten die Grundsteuer bezahlt und obenhin dann nicht mehr. Und dadurch sind die Straßen auch eng geworden, Und hier sind natürlich auch verheerende Brände passiert in allen Städten, es gibt keine in Anführungszeichen Großstadt der Welt, wo nicht verheerend schon mal irgendwas abgebrannt worden ist…
ERZÄHLERIN:
Und so versuchte man, diesem Problem mit Bauordnungen zu Leibe zu rücken. Darin wurde zum Beispiel geregelt, dass Dächer mit Schindeln statt mit Stroh zu decken waren, oder es wurden Mindestabstände zwischen Gebäuden vorgeschrieben. Durchaus mit Erfolg: Viele Dinge, die um 1500 festgelegt wurden, gelten auch heute noch, etwa in der Bayerischen Bauordnung.
MUSIK 6 (Ennio Morricone: Overture)
ERZÄHLERIN:
Paradoxerweise brannten gerade die beiden europäischen Metropolen, die die fortschrittlichsten Brandschutzvorkehrungen besaßen, noch einmal nieder: London im Jahr 1666 und Hamburg knapp zwei Jahrhunderte später, 1842. Allzu sehr hatte man sich durch die Errungenschaften in Sicherheit gewiegt.
SPRECHER:
Traurig, aber wahr ist oft: dass erst nach großen Katastrophen ein Umdenken passiert. So war ein zentraler Wendepunkt für die Feuerwehrtechnik um den Großen Brand von London zu verzeichnen.
MUSIK 7 (Ennio Morricone: L’inferno bianco)
ATMO: Schmiedewerkstatt
ERZÄHLERIN:
Schon kurz zuvor, im Jahr 1650, gelang dem Nürnberger Zirkelschmied Hans Hautsch ein großer Wurf: er konstruierte eine Feuerspritze, die so massiv war, dass sie von drei Pferden gezogen werden musste. Achtundzwanzig Mann waren nötig, um sie mit vereinter Muskelkraft zu bedienen. Aber was sie vermochte, lohnte den Aufwand: Durch ein ausgeklügeltes technisches System konnte sie einen ununterbrochenen Löschwasserstrahl bis zu zwanzig Meter weit in die Flammen schleudern.
ATMO: Wasserstrahl ins Feuer
ERZÄHLERIN:
Das war revolutionär. Die Menschen horchten auf. Waren Brände vielleicht doch etwas, das man bezwingen konnte?
Ähnliches Aufsehen erregte schon bald darauf eine andere Erfindung; sie kam aus Holland von einem Vater und Sohn namens van der Heyde. Die beiden analysierten die Katastrophe von London und gingen der Frage nach, wie man einen Brand künftig frühzeitig in den Griff bekommen könnte. Ein zentrales Problem, folgerten sie, waren Brände in Räumen, auf Türmen und allgemein an Stellen, wo man mit den Feuerspritzen nicht hinkam. Und sie kamen auf eine geniale Lösung: sogenannte „Schlangenspritzen“ aus Leder, sprich: Feuerwehrschläuche. Mit deren Hilfe konnte man nun bis in die Häuser vordringen. Und dank zusätzlicher Verstärkerpumpen in den Kirchtürmen ließ sich das Wasser sogar bis zum Turmhelm hinauf befördern.
MUSIK 8 (Ennio Morricone: Overture)
SPRECHER:
Dann, 1842, kam die Brandkatastrophe von Hamburg. Ein weiterer Wendepunkt der Feuerwehrgeschichte. Die Entwicklung der Löschgeräte schritt nun schon lange stetig voran; aber die Ohnmacht der Hamburger Brandabwehr zeigte, dass auch die Organisation stark verbesserungswürdig war.
ERZÄHLERIN:
Bis dahin hatte es in Deutschland nur Pflichtfeuerwehren gegeben: das heißt, Angehörige bestimmter Berufsgruppen wurden verpflichtet, Hilfe zu leisten, wenn es brannte. Doch das hieß nicht, dass es auch so war: manche kamen nicht rechtzeitig hin, andere nahmen lieber ein Bußgeld in Kauf, als sich aus dem Haus und in Gefahr zu begeben.
Eine zündende Idee kam von einem Mann, der in vielfacher Weise die Geschichte der Feuerwehr prägen sollte: Carl Metz. Er plädierte für das Konzept einer Freiwilligenmannschaft – rekrutiert aus den damals aufkommenden Turnvereinen. Die Männer dort waren jung, kräftig und voller Tatendrang. So wurde in Durlach bei Karlsruhe im Jahr 1846 ein freiwilliges „Pompierkorps“ gegründet, bestehend aus 50 Mann. Für diese Truppe schuf Carl Metz dann auch erstmals die Bezeichnung „Feuerwehr“.
MUSIK 9 (Keller Steff: Feierwehr )
SPRECHER
Das Konzept der freiwilligen Helfer machte Schule. Auch in anderen Städten wurden ab jetzt Freiwillige Feuerwehren gegründet.
[In München – heute Stadt mit einer der bestbestückten Feuerwehren Deutschlands – brauchte es dafür allerdings mehrere Anläufe, wie Markus Zawadke weiß:
ZUSPIELER 3 (O Zawadke)
München hatte drei Ansätze gemacht zur Feuerwehrgründung bis eine Freiwillige Feuerwehr endlich sich gründen konnte. Weil die die ersten zwei haben sie gleich einmal verboten. Der berühmteste existiert heute noch, der TSV 1860. Der hat tatsächlich 1860 als Turnermannschaft versucht, die erste Feuerwehr zu gründen. Also man kann eigentlich sogar tatsächlich sagen die Sechziger wären die erste Feuerwehr gewesen, wenn sie nicht gleich verboten worden wären. Wegen politischer Umtriebe.]
ERZÄHLERIN:
Der Große Brand von Hamburg brachte auch den Berliner Magistrat zum Nachdenken. Die Stadt, so befand er, braucht Feuerwachen mit Personal, das rund um die Uhr einsatzbereit ist. So wurde dort im Jahr 1851 die erste Berufsfeuerwehr gegründet. Das heißt: die Feuerwehrleute waren rund um die Uhr in Schichten eingeteilt; sie waren von der Stadt angestellt und bekamen ein festes Gehalt.
SPRECHER:
So ruht das Konzept der Nothilfe in etlichen europäischen Ländern seither auf zwei Säulen: den freiwilligen und den Berufsfeuerwehren – das sind die Länder Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen. In Deutschland gibt es heute die Vorschrift, dass jede größere Stadt – meist ab 100.000 Einwohnern – eine Berufsfeuerwehr haben muss. Dennoch stellen die freiwilligen bei weitem den größten Teil der Helferinnen und Helfer: auf 35.000 Berufsfeuerwehrleute kommen gut eine Million Ehrenamtliche.
Damit die Feuerwehr ausrücken kann, muss sie natürlich erst einmal erfahren, dass und wo es brennt.
ATMO: Reiter galoppiert
ERZÄHLERIN:
Die Städte bezahlten nun auch Feuerboten. Teilweise bis in die 1930er Jahre gab es solche Boten, die zu Pferde oder später auch per Fahrrad zur Feuerwache eilten und Bescheid gaben. Das dauerte natürlich oft viel zu lange. Wieder einmal war Berlin Vorreiter mit einer Neuerung: zusammen mit der Gründung der Berufsfeuerwehr konnte dort auch gleich eine neue Meldetechnik an den Start gehen: Feuermelder, die per Telegrafie funktionierten, anfangs noch per Morsealphabet. In der gesamten Stadt baute man ein Netz aus automatischen Meldern auf. Jeder, der ein Feuer bemerkte, konnte nun per Knopfdruck die Feuerwehr alarmieren – eine segensreiche Erfindung, die sich lange hielt:
ZUSPIELER 5 (O Zawadke)
Grad um von 1860, 70 bis weit, also sogar in den 1950er 60er 70er-Jahren noch waren also diese Feuermelder an allen Ecken und Enden gestanden, Druckknopfmelder, wo man so reindrücken konnte und dann die Feuerwehr alarmieren konnte. Es gab da eben Lochstreifen und dann hat man anhand der Lochstreifen genau feststellen können: Ah, das ist der Feuermelder sowieso in der Straße sowieso. Und dann ist da die Feuerwehr hingeschickt worden.
ATMO: Sirene
SPRECHER:
Viele kennen die allgegenwärtigen Kästchen mit dem Druckknopf noch gut. Inzwischen hat das Handy die fest installierten Melder weitgehend überflüssig gemacht.
ERZÄHLERIN:
Um ein Feuer löschen zu können, muss man natürlich erstmal so schnell wie möglich zur Brandstelle gelangen. Schon zu Zeiten der Pferdefuhrwerke gab es dafür eine ausgeklügelte Strategie. Die Münchner Hauptfeuerwache, erbaut 1902, wurde noch für die Fuhrwerke konstruiert. Der Pressesprecher der Münchner Feuerwehr, Florian Hörhammer, erzählt:
ZUSPIELER 6 (Hörhammer)
Hier waren Ställe und dementsprechend auch dort genau dort, wo jetzt die hochmodernen Fahrzeuge stehen, standen zu dieser Zeit Kutschen. Bei einem Alarm haben sich also die Boxentüren automatisch geöffnet, Pferdeboxen-Türen, die Pferde waren annähernd zirkusreif, also sie haben sich dann vor der richtigen Kutsche eingefunden, und an der Decke hingen dann dementsprechend die sogenannten Klapp-Geschirre, die dann halt von einer Mannschaft geschlossen wurde(n), weil es musste erst eingespannt werden.
ATMO: Fuhrwerk rückt aus, Glocken
ERZÄHLERIN:
Das ging alles schon sehr schnell – so schnell, dass es heute im Durchschnitt nur eine Minute länger dauert, bis die Fahrzeuge die Wache verlassen haben.
Auf dem Land dagegen sah das schon anders aus. Da standen die Pferde nicht parat. Sie wurden von den Bauern oder Fuhrunternehmern gestellt. Und die hatten nicht unbedingt Interesse, ihre Arbeit von jetzt auf gleich liegen zu lassen, um die Pferde zum Einsatz zu schicken. Markus Zawadke vom Feuerwehrmuseum Bayern:
ZUSPIELER 7 (O-Ton Zawadke)
Das war natürlich das größte Problem in Zeiten, wo es noch mit der Pferdekutsche war; jetzt hatte man sich da verschiedene Systeme ausgedacht, dass die Bauern in der Regel oder die Fuhrunternehmer, dass die möglichst schnell ans Gerätehaus kommen und dann anspannen. Und jetzt hat man natürlich nicht sagen können: der erste kriegt das Geld, weil dann weiß der eine oder andere: hm, wenn i der zwoate bin, kriag i nix. Also in der Regel war es so: der erste hat Geld bekommen, der zweite hat noch ein Geld bekommen und auch vielleicht der dritte hat noch ein Geld bekommen. Aber halt immer in Abstufungen weniger, sodass die halt nicht leer ausgegangen sind, wenn sie halt nicht anspannen konnten, weil man halt damit verhindern wollte, dass der eine oder andere sagt: woaßt was, i bin so weit weg. Das hat kein Zopf, ich fahre da nicht hin. Also man hat ja schon auch bisschen einen gesunden Wettbewerb damit gefördert, dass es möglichst schnell geht.
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8282 ratings

Notruf 112 wählen, maximal 15 Minuten warten - dann ist sie da: die Feuerwehr. Das war nicht immer so: dass wir schnelle und effektive Hilfe in der Not bekommen, ist das Ergebnis einer ereignisreichen Entwicklungsgeschichte. (BR 2022)
Credits:
Autor/in dieser Folge: Christiane Neukirch
Regie: Christiane Klenz
Es sprachen: Anne-Isabelle Zils und Stefan Wilkening
Technik: Roland Böhm
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview:
Diese hörenswerten Folgen von Radiowissen könnten Sie auch interessieren:
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Feuerwehrmuseum Bayern e.V. in Waldkraiburg
Das Museum – im oberbayerischen Waldkraiburg gelegen, ist ein Juwel, das einen Besuch mehr als lohnt: als größtes Feuerwehrmuseum Deutschlands – und ausschließlich von ehrenamtlichen Betreibern geführt – bietet es eine einzigartige und hervorragend kommentierte Sammlung an Fahrzeugen, Geräten, Uniformen, Feuermeldern, Modellen u.v.m. vom Beginn des deutschen Feuerwehrwesens bis heute: Mehr Infos unter:
EXTERNER LINK | https://www.feuerwehrmuseum-bayern.de/
Literaturtipps:
Prager, Hans-Georg: Florian 14: Achter Alarm! Das Buch der Feuerwehr. Verlag Mittler & Sohn, Herford 1980 (3. Auflage):
Dieses Buch gibt bis heute den umfassendsten und zugleich nahbarsten Einblick in die Welt der Feuerwehr. Der Journalist Hans-Georg Prager arbeitete ein halbes Jahr lang als vollwertiges Mitglied der Hamburger Feuerwehr mit.
Lottmann, Eckart: Berliner Feuerwehr. Auf der Drehleiter der Geschichte. Be.bra Verlag, Berlin, 1996
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ERZÄHLERIN:
Ein Löschzug der Feuerwehr unterwegs zum Einsatz. Jemand hat den Notruf 112 gewählt. Von jetzt kann man damit rechnen: in spätestens 12 Minuten ist Hilfe da. Das ist die Frist, in der die Feuerwehr hierzulande vor Ort sein muss. Damit das geschehen kann, stehen allein in Deutschland mehr als eine Million Feuerwehrleute bereit, Tag und Nacht.
Sprecher
Dabei ist der Name „Feuerwehr“ ein bisschen irreführend: denn sie leistet Hilfe nicht nur bei Bränden. Löschen ist nur ein Teil der vier Tätigkeiten, die das Motto des Deutschen Feuerwehrverbandes bilden. Das sind:
Retten – Löschen – Bergen und Schützen.
ERZÄHLERIN:
Dazu gehört die Notfallrettung ebenso wie die technische Hilfeleistung. Doch das Feuer hat unsere Geschichte besonders stark geprägt – und damit auch die Notwendigkeit, sich dagegen zur Wehr zu setzen. Daher soll es in dieser Sendung hauptsächlich darum gehen.
ATMO: Feuer knistert
SPRECHER:
Feuer war lange Zeit zunächst eines: eine Naturgewalt, entfacht durch Blitz oder Funkenflug. Dass der Mensch das Element gezähmt und für seine Zwecke nutzbar gemacht hat, dürfte die Entwicklung unserer Spezies maßgeblich beeinflusst haben. Feuer half als Schutz vor wilden Tieren, machte Nahrung durch Erhitzen leichter verdaulich und ermöglichte schließlich auch die Herstellung diversester Gebrauchsgegenstände.
MUSIK 2 (Imogen Heap: The Fire)
ERZÄHLERIN:
Doch es gab auch die Kehrseite: Feuer geriet leicht außer Kontrolle und konnte Zerstörung und Tod bedeuten.
MUSIK 3 (Gothic Voices: O Ignis Spiritus)
SPRECHER:
Jahrtausende lang betrachtete man Brände als eine Strafe Gottes – und nahm sie als Schicksal hin. Im Mittelalter wurde von der Kanzel herunter oft sogar verboten, Feuer zu bekämpfen: denn das hieß ja, Gottes Strafe zurückzuweisen.
MUSIK 4 (Conrad Steinmann: Nomos M)
ERZÄHLERIN:
In der Antike begannen vor allem die Griechen und die Römer, die Brandbekämpfung pragmatisch zu betrachten. Speziell im alten Rom war die Lage oft brenzlig: in der dicht bebauten Hauptstadt des Römischen Reiches herrschte durch den regen Zuzug Wohnungsnot. So wurden in Eile windige Mietskasernen aus Lehm und Stroh hochgezogen, deren Statik eine Katastrophe war. So oft gingen Gebäude in Flammen auf, dass der Senat beschloss, etwas dagegen zu unternehmen.
Markus Zawadke, Kurator des Feuerwehrmuseums Bayern in Waldkraiburg, hat die Geschichte der Feuerwehr von Anbeginn im Blick.
ZUSPIELER 1 (O Ton Zawadke)
Griechen und die Römer waren uns ja schon um Tausende von Jahren voraus. Haben tatsächlich die Pumpe erfunden, haben tatsächlich den Schlauch erfunden und haben tatsächlich auch schon die Feuerwehr erfunden. Das gab es alles im römischen und im griechischen Reich und ist auch teilweise bis zur Perfektion schon entwickelt worden. Wir wissen alle, das Römischen Reich ist untergegangen, die Griechen damit übrigens auch. Und dann ist das alles in Vergessenheit geraten. Gerade in Deutschland, und in Deutschland herrschte einfach noch tiefstes Mittelalter, und da hat halt schlicht und einfach der Landmann wie der Bauer wie das Gesindel einfach nur den Eimer gekannt und die Eimerkette.
ERZÄHLERIN:
Und so sahen sich die im Mittelalter wieder wachsenden Siedlungen der Gefahr hilflos gegenüber. Die Zeit vom 12. bis 14. Jahrhundert gilt als Epoche der großen Stadtbrände. Unzählige Städte wurden durch Feuer komplett zerstört – manche davon nicht nur einmal. In den – eng an eng stehenden – Holzhäusern gab es keine Kamine: geheizt und gekocht wurde mit einem offenen Feuer; der Rauchabzug war ein Loch im Strohdach. Ein ungünstiger Funkenflug, und alles stand in Flammen. Selbst jene Hausbesitzer, die brav ihren Ledereimer mit Wasser bereithielten, konnten nur dann noch Schlimmeres verhindern, wenn sie schnell reagierten, gegen größere Brände konnte man selbst mit vereinten Eimern und Kräften kaum noch etwas ausrichten.
ATMO: Sturmglocken, Feuer
MUSIK 5 (Ennio Morricone: Overture)
ERZÄHLERIN:
Während immer noch viele Menschen die Katastrophen als gottgegeben hinnahmen, regte sich doch auch immer mehr der Wille zur Gegenwehr.
Nach dem großen Brand von London im Jahr 1189 gab die Stadt eine Feuerschutzordnung heraus: jeder Hausbesitzer hatte von nun an ein Fass mit Wasser bereitzuhalten. Nachts patrouillierten Wächter durch die Straßen. Andere Städte zogen nach. In Hamburg hatten Türmer von oben ein Auge auf Brandherde.
Doch trotz alledem wurde es in den folgenden Jahrhunderten nicht viel besser.
ZUSPIELER 2 (O Zawadke)
Das Problem war: eigentlich die Städte, wie sie sich entwickelt haben. Man hat Handel betrieben, die Städte sind reich geworden, teilweise natürlich durch den Handel, haben das durch eine entsprechende Bebauung auch gezeigt. Also Wohnungsnot, die gibt es nicht nur heute, sondern die war damals auch schon um 1500,1600,1700 in den Städten durchaus vorhanden. Das heißt, die wurden enger gebaut. Es wurden auf die ersten Stockwerke zweite Stockwerke, dritte Stockwerke gesetzt, die teilweise auch sehr chaotisch gebaut worden sind. Man denkt also nur mal an London, wo das erste Stockwerk dann schon in die Straße reingeragt hat und das zweite und dritte Stockwerk noch weiter, weil man dafür eben keine Steuern bezahlen musste. Man hat eben nur unten einmal die unten die Grundsteuer bezahlt und obenhin dann nicht mehr. Und dadurch sind die Straßen auch eng geworden, Und hier sind natürlich auch verheerende Brände passiert in allen Städten, es gibt keine in Anführungszeichen Großstadt der Welt, wo nicht verheerend schon mal irgendwas abgebrannt worden ist…
ERZÄHLERIN:
Und so versuchte man, diesem Problem mit Bauordnungen zu Leibe zu rücken. Darin wurde zum Beispiel geregelt, dass Dächer mit Schindeln statt mit Stroh zu decken waren, oder es wurden Mindestabstände zwischen Gebäuden vorgeschrieben. Durchaus mit Erfolg: Viele Dinge, die um 1500 festgelegt wurden, gelten auch heute noch, etwa in der Bayerischen Bauordnung.
MUSIK 6 (Ennio Morricone: Overture)
ERZÄHLERIN:
Paradoxerweise brannten gerade die beiden europäischen Metropolen, die die fortschrittlichsten Brandschutzvorkehrungen besaßen, noch einmal nieder: London im Jahr 1666 und Hamburg knapp zwei Jahrhunderte später, 1842. Allzu sehr hatte man sich durch die Errungenschaften in Sicherheit gewiegt.
SPRECHER:
Traurig, aber wahr ist oft: dass erst nach großen Katastrophen ein Umdenken passiert. So war ein zentraler Wendepunkt für die Feuerwehrtechnik um den Großen Brand von London zu verzeichnen.
MUSIK 7 (Ennio Morricone: L’inferno bianco)
ATMO: Schmiedewerkstatt
ERZÄHLERIN:
Schon kurz zuvor, im Jahr 1650, gelang dem Nürnberger Zirkelschmied Hans Hautsch ein großer Wurf: er konstruierte eine Feuerspritze, die so massiv war, dass sie von drei Pferden gezogen werden musste. Achtundzwanzig Mann waren nötig, um sie mit vereinter Muskelkraft zu bedienen. Aber was sie vermochte, lohnte den Aufwand: Durch ein ausgeklügeltes technisches System konnte sie einen ununterbrochenen Löschwasserstrahl bis zu zwanzig Meter weit in die Flammen schleudern.
ATMO: Wasserstrahl ins Feuer
ERZÄHLERIN:
Das war revolutionär. Die Menschen horchten auf. Waren Brände vielleicht doch etwas, das man bezwingen konnte?
Ähnliches Aufsehen erregte schon bald darauf eine andere Erfindung; sie kam aus Holland von einem Vater und Sohn namens van der Heyde. Die beiden analysierten die Katastrophe von London und gingen der Frage nach, wie man einen Brand künftig frühzeitig in den Griff bekommen könnte. Ein zentrales Problem, folgerten sie, waren Brände in Räumen, auf Türmen und allgemein an Stellen, wo man mit den Feuerspritzen nicht hinkam. Und sie kamen auf eine geniale Lösung: sogenannte „Schlangenspritzen“ aus Leder, sprich: Feuerwehrschläuche. Mit deren Hilfe konnte man nun bis in die Häuser vordringen. Und dank zusätzlicher Verstärkerpumpen in den Kirchtürmen ließ sich das Wasser sogar bis zum Turmhelm hinauf befördern.
MUSIK 8 (Ennio Morricone: Overture)
SPRECHER:
Dann, 1842, kam die Brandkatastrophe von Hamburg. Ein weiterer Wendepunkt der Feuerwehrgeschichte. Die Entwicklung der Löschgeräte schritt nun schon lange stetig voran; aber die Ohnmacht der Hamburger Brandabwehr zeigte, dass auch die Organisation stark verbesserungswürdig war.
ERZÄHLERIN:
Bis dahin hatte es in Deutschland nur Pflichtfeuerwehren gegeben: das heißt, Angehörige bestimmter Berufsgruppen wurden verpflichtet, Hilfe zu leisten, wenn es brannte. Doch das hieß nicht, dass es auch so war: manche kamen nicht rechtzeitig hin, andere nahmen lieber ein Bußgeld in Kauf, als sich aus dem Haus und in Gefahr zu begeben.
Eine zündende Idee kam von einem Mann, der in vielfacher Weise die Geschichte der Feuerwehr prägen sollte: Carl Metz. Er plädierte für das Konzept einer Freiwilligenmannschaft – rekrutiert aus den damals aufkommenden Turnvereinen. Die Männer dort waren jung, kräftig und voller Tatendrang. So wurde in Durlach bei Karlsruhe im Jahr 1846 ein freiwilliges „Pompierkorps“ gegründet, bestehend aus 50 Mann. Für diese Truppe schuf Carl Metz dann auch erstmals die Bezeichnung „Feuerwehr“.
MUSIK 9 (Keller Steff: Feierwehr )
SPRECHER
Das Konzept der freiwilligen Helfer machte Schule. Auch in anderen Städten wurden ab jetzt Freiwillige Feuerwehren gegründet.
[In München – heute Stadt mit einer der bestbestückten Feuerwehren Deutschlands – brauchte es dafür allerdings mehrere Anläufe, wie Markus Zawadke weiß:
ZUSPIELER 3 (O Zawadke)
München hatte drei Ansätze gemacht zur Feuerwehrgründung bis eine Freiwillige Feuerwehr endlich sich gründen konnte. Weil die die ersten zwei haben sie gleich einmal verboten. Der berühmteste existiert heute noch, der TSV 1860. Der hat tatsächlich 1860 als Turnermannschaft versucht, die erste Feuerwehr zu gründen. Also man kann eigentlich sogar tatsächlich sagen die Sechziger wären die erste Feuerwehr gewesen, wenn sie nicht gleich verboten worden wären. Wegen politischer Umtriebe.]
ERZÄHLERIN:
Der Große Brand von Hamburg brachte auch den Berliner Magistrat zum Nachdenken. Die Stadt, so befand er, braucht Feuerwachen mit Personal, das rund um die Uhr einsatzbereit ist. So wurde dort im Jahr 1851 die erste Berufsfeuerwehr gegründet. Das heißt: die Feuerwehrleute waren rund um die Uhr in Schichten eingeteilt; sie waren von der Stadt angestellt und bekamen ein festes Gehalt.
SPRECHER:
So ruht das Konzept der Nothilfe in etlichen europäischen Ländern seither auf zwei Säulen: den freiwilligen und den Berufsfeuerwehren – das sind die Länder Deutschland, Österreich, die Schweiz und Polen. In Deutschland gibt es heute die Vorschrift, dass jede größere Stadt – meist ab 100.000 Einwohnern – eine Berufsfeuerwehr haben muss. Dennoch stellen die freiwilligen bei weitem den größten Teil der Helferinnen und Helfer: auf 35.000 Berufsfeuerwehrleute kommen gut eine Million Ehrenamtliche.
Damit die Feuerwehr ausrücken kann, muss sie natürlich erst einmal erfahren, dass und wo es brennt.
ATMO: Reiter galoppiert
ERZÄHLERIN:
Die Städte bezahlten nun auch Feuerboten. Teilweise bis in die 1930er Jahre gab es solche Boten, die zu Pferde oder später auch per Fahrrad zur Feuerwache eilten und Bescheid gaben. Das dauerte natürlich oft viel zu lange. Wieder einmal war Berlin Vorreiter mit einer Neuerung: zusammen mit der Gründung der Berufsfeuerwehr konnte dort auch gleich eine neue Meldetechnik an den Start gehen: Feuermelder, die per Telegrafie funktionierten, anfangs noch per Morsealphabet. In der gesamten Stadt baute man ein Netz aus automatischen Meldern auf. Jeder, der ein Feuer bemerkte, konnte nun per Knopfdruck die Feuerwehr alarmieren – eine segensreiche Erfindung, die sich lange hielt:
ZUSPIELER 5 (O Zawadke)
Grad um von 1860, 70 bis weit, also sogar in den 1950er 60er 70er-Jahren noch waren also diese Feuermelder an allen Ecken und Enden gestanden, Druckknopfmelder, wo man so reindrücken konnte und dann die Feuerwehr alarmieren konnte. Es gab da eben Lochstreifen und dann hat man anhand der Lochstreifen genau feststellen können: Ah, das ist der Feuermelder sowieso in der Straße sowieso. Und dann ist da die Feuerwehr hingeschickt worden.
ATMO: Sirene
SPRECHER:
Viele kennen die allgegenwärtigen Kästchen mit dem Druckknopf noch gut. Inzwischen hat das Handy die fest installierten Melder weitgehend überflüssig gemacht.
ERZÄHLERIN:
Um ein Feuer löschen zu können, muss man natürlich erstmal so schnell wie möglich zur Brandstelle gelangen. Schon zu Zeiten der Pferdefuhrwerke gab es dafür eine ausgeklügelte Strategie. Die Münchner Hauptfeuerwache, erbaut 1902, wurde noch für die Fuhrwerke konstruiert. Der Pressesprecher der Münchner Feuerwehr, Florian Hörhammer, erzählt:
ZUSPIELER 6 (Hörhammer)
Hier waren Ställe und dementsprechend auch dort genau dort, wo jetzt die hochmodernen Fahrzeuge stehen, standen zu dieser Zeit Kutschen. Bei einem Alarm haben sich also die Boxentüren automatisch geöffnet, Pferdeboxen-Türen, die Pferde waren annähernd zirkusreif, also sie haben sich dann vor der richtigen Kutsche eingefunden, und an der Decke hingen dann dementsprechend die sogenannten Klapp-Geschirre, die dann halt von einer Mannschaft geschlossen wurde(n), weil es musste erst eingespannt werden.
ATMO: Fuhrwerk rückt aus, Glocken
ERZÄHLERIN:
Das ging alles schon sehr schnell – so schnell, dass es heute im Durchschnitt nur eine Minute länger dauert, bis die Fahrzeuge die Wache verlassen haben.
Auf dem Land dagegen sah das schon anders aus. Da standen die Pferde nicht parat. Sie wurden von den Bauern oder Fuhrunternehmern gestellt. Und die hatten nicht unbedingt Interesse, ihre Arbeit von jetzt auf gleich liegen zu lassen, um die Pferde zum Einsatz zu schicken. Markus Zawadke vom Feuerwehrmuseum Bayern:
ZUSPIELER 7 (O-Ton Zawadke)
Das war natürlich das größte Problem in Zeiten, wo es noch mit der Pferdekutsche war; jetzt hatte man sich da verschiedene Systeme ausgedacht, dass die Bauern in der Regel oder die Fuhrunternehmer, dass die möglichst schnell ans Gerätehaus kommen und dann anspannen. Und jetzt hat man natürlich nicht sagen können: der erste kriegt das Geld, weil dann weiß der eine oder andere: hm, wenn i der zwoate bin, kriag i nix. Also in der Regel war es so: der erste hat Geld bekommen, der zweite hat noch ein Geld bekommen und auch vielleicht der dritte hat noch ein Geld bekommen. Aber halt immer in Abstufungen weniger, sodass die halt nicht leer ausgegangen sind, wenn sie halt nicht anspannen konnten, weil man halt damit verhindern wollte, dass der eine oder andere sagt: woaßt was, i bin so weit weg. Das hat kein Zopf, ich fahre da nicht hin. Also man hat ja schon auch bisschen einen gesunden Wettbewerb damit gefördert, dass es möglichst schnell geht.

65 Listeners

18 Listeners
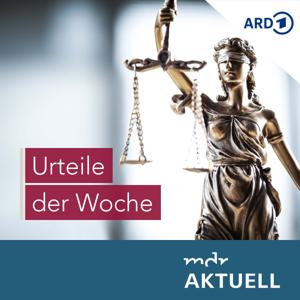
4 Listeners

43 Listeners

7 Listeners

8 Listeners

5 Listeners

21 Listeners

113 Listeners

104 Listeners

46 Listeners

7 Listeners

9 Listeners

19 Listeners

0 Listeners

20 Listeners

0 Listeners

44 Listeners

34 Listeners

10 Listeners

34 Listeners

70 Listeners

4 Listeners

1 Listeners

32 Listeners

47 Listeners

19 Listeners
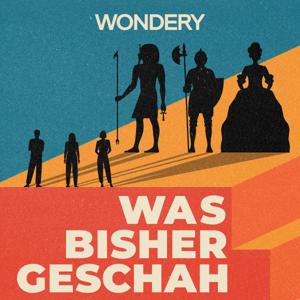
46 Listeners

1 Listeners

0 Listeners