
Sign up to save your podcasts
Or




Stadtgrün ist Lebensraum, Erholungsort und Klimaschützer. Doch wie kam das Grün in die Stadt? Wie hat sich die Bedeutung von Parks, Alleen und Grünflächen mit der Zeit verändert? In der Geschichte des Stadtgrüns spiegelt sich auch ein Wandel der Gesellschaft. Von Susanne Hofmann (BR 2025)
Credits
Autorin dieser Folge: Susanne Hofmann
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprachen: Maren Ulrich, Johannes Hitzelberger, Heiko Ruprecht
Technik: Moritz Herrmann
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
Professor Stefan Schweizer, Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wiss. Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V.
PD Dr.-Ing. Sylvia Butenschön, Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin
Professor Klaus K. Loenhart, Institut für Architektur und Landschaft der TU Graz
Podcast Tipp:
Wir helfen Garten-Anfängern zu echten Auskennern zu werden. Egal ob gepachteter Kleingarten oder das erste Hochbeet fürs eigene Gemüse am Häuschen – wir haben die richtigen Tipps und Ratschläge für Euch! ZUM PODCAST
Diese hörenswerten Folgen von IQ - Wissenschaft und Forschung könnten Sie auch interessieren:
Schwammstadt - Architektur der Zukunft
Enge in der Stadt - Alltag und Gesundheit
Klimawandel - was soll ich allein schon dagegen tun?
Klimarisiken - Wie können wir Europa retten?
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Für praktische Tipps wie Gärten Insekten-freundlich gestaltet werden können empfehlen wir Ihnen Summende Gärten
Linktipps:
Traktat von Karl Gottlob Schelle „Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen“ aus dem „Deutschen Textarchiv“ HIER geht es zu Website
Christian Cay Lorenz Hirschfeld 1785, Theorie der Gartenkunst HIER geht es zur Website
Literatur:
A. Thumfart, B. Hollstein, S. Tänzer (Hg.), Gärten – Von der Naturbeherrschung zur gesellschaftlichen Utopie
Ira Diana Mazzoni, 50 Klassiker Gärten und Parks, Gerstenberg Verlag, 2005
Jessica Jungbauer, Urban Oasis, Parks and Projects for a Greener Future, teNeues Verlag, 2023
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZITATORIN – werbend gesprochen
Ihr neues Zuhause wartet! Schmuckes Appartement in Altstadtnähe, nur wenige Schritte zu den grünen Oasen der Stadt mit naturnahen Freizeitmöglichkeiten. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!
ERZÄHLER
Städtisch und dennoch im Grünen – das beschreibt für viele Menschen die ideale Wohnlage. Die moderne Stadt ist eine grüne Stadt. Das städtische Grün gilt fast schon als Allheilmittel – gegen die Klimakrise, für die Volksgesundheit, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht zuletzt steigert das Grün auch den Wert von Immobilien. Man spricht von grüner Infrastruktur – also vernetzten Grünflächen, die für eine Stadt lebensnotwendig sind. Davon ist auch die Landschaftsarchitektin Dr. Sylvia Butenschön von der TU Berlin überzeugt:
1. ZUSPIELUNG Butenschön 3.05
Heute ist es ein wichtiges Element, um die Städte zu strukturieren, Grün- und Freiraum in die Stadtquartiere zu bringen. Und es ist natürlich aus ökologischer Sicht oder aus naturschutzfachlicher Sicht ein wichtiges Element der Stadt: Wir profitieren von der Frischluftentstehung oder der Kaltluftentstehung in den Grünflächen, davon, dass es großen Raum für Biodiversität in der Stadt bietet, also für Tiere und Pflanzen. Ja, und dann eben in der Folge als Lebensraum, als Aufenthaltsraum, als Erholungsraum für die Bevölkerung geeignet ist.
ERZÄHLER
Und doch ist die grüne Stadt aus historischer Sicht ein recht junges Phänomen, sagt der Kunsthistoriker Stefan Schweizer, Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sein Spezialgebiet ist die Gartengeschichte ab dem 17. Jahrhundert.
2. ZUSPIELUNG Schweizer 2.00
Das ist eigentlich eine Anomalie städtebaugeschichtlich seit der Frühneuzeit…. Bis 1600, vielleicht doch bis 1700 und mit den befestigten Städten bis 1800, ist die Stadt eigentlich genau das Gegenteil gewesen von Natur und das Gegenteil von Landschaft. Es war quasi die Ausgliederung von Natur aus dem urbanen Raum. (2.50) Wenn Sie sich historische Altstädte ansehen, … wenn sie an Siena denken oder Arezzo, die hochmittelalterlich geprägt sind, dann werden Sie … mit einer Enge und Dichte konfrontiert, die überhaupt keinen Raum ließ für öffentliches Grün.
Musik 2: Begegnung mit Barbarossa - – 1.02 Min+
Atmo Schafweide, später Atmo Wiese
ERZÄHLER
Natur und Landschaft fanden sich im Mittelalter überwiegend außerhalb der Städte. Auch die Allmenden, also unbebaute Flächen, die allen gemeinsam gehörten – daher der altdeutsche Begriff - , lagen für gewöhnlich außerhalb der Stadtmauern. Man ließ Schafe und Rinder dort weiden und sammelte dort Brennholz. In der Stadt, verborgen hinter Mauern, befanden sich zwar durchaus grüne Oasen: Sorgfältig gepflegte, geometrisch um einen Brunnen angelegte Klostergärten zum Beispiel. Doch zu ihnen hatte das Volk keinen Zugang. Ebenso wenig wie zu den privaten Stadtgärten der besseren Gesellschaft. Die hatte selbst in der dicht besiedelten Stadt ihr eigenes Grün, oft in Form begrünter Innenhöfe. Man konnte sie von der Straße aus nicht einmal sehen. Begrünte öffentliche Plätze oder auch nur Bäume in der Stadt waren rar in Mittelalter und Renaissance, sagt der Kunsthistoriker Stefan Schweizer:
3. ZUSPIELUNG Schweizer 4.30
Kurz nach 1600 beginnen dann die Diskussionen darüber, weil die Städte sich vergrößern, weil die Städte sich verdichten, weil die sozialhygienischen Bedingungen immer prekärer werden, auch für die Oberschicht prekärer werden, also auch die Oberschicht ist vor Pandemien oder Epidemien eben nicht gefeit. …Und daraus lernt man natürlich: Die sozial-hygienischen Bedingungen in der Stadt müssen verbessert werden.
Musik 3: 3. Satz: Sarabande en rondeau - CD492710 103 – 1:02 Min
ERZÄHLER
Man lechzte nach mehr Raum in den engen, überlaufenen Gassen. Auch nach frischer Luft - Schmutzwasser, Küchenabfälle und Fäkalien landeten schließlich oft in offenen Abwasserrinnen und sorgten für einen entsprechend strengen Geruch in der Stadt. Natur wurde dem gemeinen Städter erst peu-à-peu zugänglich gemacht, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts. In
London waren einzelne königliche Parks öffentlich, der St. James’s Park beispielsweise. Mit der Öffnung für das Volk wollte sich der damalige englische König Charles II. als großzügiger Herrscher präsentieren. Ebenso öffentlich zugänglich war in Paris der barocke Garten am Palast der Tuilerien. Dort residierte der Sonnenkönig Ludwig XIV. Bei dem königlichen Garten handelte es sich um eine streng symmetrische Anlage, mit Alleen, Zierbrunnen, Skulpturen, Blumenarrangements und penibel gestutzten Hecken.
4. ZUSPIELUNG Schweizer 9.50
Dort wird so ne Art Stände-übergreifende Nutzung eingeübt, was auch interessant ist, weil Gärten damit überhaupt zu eminenten Orten der bürgerlichen Partizipation auch werden und der Emanzipation. … Also in Kirchen sind sie separiert, in Rathäusern sind sie separiert – überall wird segregiert und separiert, und in Gärten passiert es eben nicht.
ERZÄHLER
Später bekam das öffentliche städtische Grün sozusagen Schützenhilfe, und zwar aus unerwarteter Richtung: der Waffentechnik. Die Weiterentwicklung der Artillerie führte dazu, dass sich die Art der Kriegsführung grundlegend änderte. Da Kanonenkugeln jetzt Bastionen durchdringen konnten, wurden diese militärisch wertlos. Deshalb baute man ab dem 19. Jahrhundert die Festungen sukzessive zurück und hatte damit auf einmal Platz, viel Platz rund um die Städte. Und den konnte man gut gebrauchen, viele platzten schon aus allen Nähten.
Musik 4: 1. Satz aus: Sinfonia concertante (Haydn) – R0115330101 – 55 Sek
ERZÄHLER
Auf den eingeebneten Festungsringen entstanden großzügige Grüngürtel sowie breite Straßen, Boulevards – ein Wort, das sich aus dem niederländischen Begriff für Bollwerk ableitet. Die Boulevards waren von Bäumen gesäumt. Auch grüne Wege für Fußgänger entstanden rings um die Stadt, sogenannte Promenaden. Zum Beispiel in Wien. Da vermeldeten die Wiener Nachrichten am 14. September 1859:
ZITATORIN
Die dreißig Klafter
ERZÄHLER
also gut 50 Meter
ZITATORIN
breite, mit doppelten Baumreihen besetzte Straße, welche nach dem Stadterweiterungs-Plane gleich einem regelmäßigen Gürtel um die Stadt gezogen werden wird, erhielt den officiellen Namen Ringstraße.
Musik aus, Wechsel in Atmo Parkanlange, Schritte, Tauben
ERZÄHLER
Oder der Leipziger Promenadenring, mit Sitzbänken und Raum für eine neue Kulturtechnik: Das Spazierengehen.
ZITATOR
Oeftere Spatziergänge im Freyen erhalten den Sinn für die Natur und geben ihr auf das Gemüth wohlthätigen Einfluß. Jeder nicht unedle Mensch fühlt sich im Freyen reiner und menschlicher gestimmt. Alles Gute seiner Natur entfaltet sich da. … Die großen und freyen Ansichten der Natur entfesseln von den kleinlichen Verhältnissen des städtischen Zwanges.
ERZÄHLER
So lobt der Schriftsteller Karl Gottlob Schelle 1802 in seinem Traktat „Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen“. Stefan Schweizer:
5. ZUSPIELUNG Schweizer 26.55
Das Promenieren ist nichts, was der Bürger des 16. Jahrhunderts als normal angesehen hätte, der hat seine Zeit mit wichtigeren Dingen zu verbringen, als zu promenieren. (27.22) Dazu brauchen sie ein gewisses Mindset, … und das hat auch sehr viel mit Freundschaftskult zu tun, der dann in der Romantik eben aufkommt, also unter Freunden gemeinsam in die Natur zu gehen. Und das ist übrigens dann auch eine politische Sache, in Teplitz besucht Goethe Beethoven, diesen schroffen Kerl, der ist da auf Kur und Goethe will sich mal mit ihm unterhalten, und dann gehen die an dem Tag spazieren, außerhalb der Stadt, an dem auch die Kaiserin dort aufschlägt. Und Beethoven und die Kaiserin gehen auf einen schmalen Pfad sich entgegen, und Beethoven weicht nicht. Und Goethe: Um Himmels Willen, Sie müssen doch der Kaiserin Platz machen! Nein – sie muss es für uns tun.
Musik 5: Beethoven: Allegro vivace – M00113027Z00- 45 Sek
ERZÄHLER
Das Erwachen des bürgerlichen Selbstbewusstseins zeigt sich in dieser Kulturtechnik des Promenierens. Der Spaziergang wird zu einem wichtigen Teil der städtischen Freizeitkultur. Die Landschaftsarchitektin Sylvia Butenschön:
6. ZUSPIELUNG Butenschön 7.05
Und dann kommt eben von Hirschfeld Ende des 18. Jahrhunderts erstmal die Idee, zu sagen, wir brauchen eigentlich was Größeres, was Flächenhaftes, wo sich die Leute ausbreiten können, wo man sich erholen kann, wo man andere Leute treffen kann, was wirklich so ein Gegengewicht quasi zur dicht besiedelten Stadt bildet.
ERZÄHLER
Christian Cay Lorenz Hirschfeld, seines Zeichens ordentlicher Professor der Philosophie und der schönen Wissenschaften auf der Universität zu Kiel, formuliert es 1785 in seiner „Theorie der Gartenkunst“ so:
Musik 6: Mozart: Oboenkonzert – 1:21 Min
ZITATOR
Eine ansehnliche Stadt muss in ihrem Umfang einen oder mehrere große offene Plätze haben, wo sich das Volk in gewissen Zeitpunkten der Freude oder der Noth versammeln und sich ausbreiten kann, wo eine freye und gesunde Luft athmet, und die Schönheit des Himmels und der Landschaft sich wieder zum Genuß eröffnet. Diese Plätze machen eine vorzügliche Zierde der Städte, wenn sie mit Rasen, mit Springbrunnen, mit Bildsäulen geschmückt, und von Baumpflanzungen und den schönern Gebäuden umkränzt sind.
ERZÄHLER
Die Idee des Volksgartens ist geboren, der Vorläufer des Volksparks und des späteren Stadtparks. Der Gartentheoretiker Hirschfeld zeigt sich in seinen Formulierungen ganz als Kind seiner Zeit, der Aufklärung:
ZITATOR
Diese Volksgärten sind… als ein wichtiges Bedürfnis des Stadtbewohners zu betrachten. Denn sie erquicken ihn nicht allein nach der Mühe des Tages mit anmuthigen Bildern und Empfindungen; sie ziehen ihn auch, indem sie ihn auf die Schauplätze der Natur locken, unmerklich von den unedlen … Arten der städtischen Zeitverkürzung ab, und gewöhnen ihn allmälig an das wohlfeile Vergnügen… Alle gelangen hier ungehindert zu ihrem Rechte, sich an der Natur zu freuen. (S. 68 Theorie, Band 5)
Musik 7: Walzer mit Trio – 23 Sek
ERZÄHLER
Wenig später, 1789, folgt der Theorie die Praxis. Auf Geheiß des Kurfürsten Karl Theodor wird in München ein riesiger Park angelegt, der Karl-Theodor-Park. Der Volksmund nennt ihn schnell den Englischen Garten. Denn er entspricht in seiner Gestaltung dem englischen Landschaftsgarten, ein Gegenentwurf zu den geometrisch angeordneten, übersichtlichen französischen Herrschaftsgärten der Barockzeit..
8. ZUSPIELUNG Butenschön 7.40
Es war noch so ein Top-Down-Produkt, wo der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz ja in Anbetracht der Ereignisse in Frankreich, also der französischen Revolution, den klugen Rat bekommen hat, seinem Volk irgendwas Gutes zu tun … und gesagt hat, okay, wir machen einen großen Park für die Stadtbevölkerung direkt vor den Toren der Stadt und hat diesen Englischen Garten als Stadtpark angelegt, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das ist in zwei Jahren gebaut worden, am Anfang mit Fackelbeleuchtung in der Nacht, damit es möglichst schnell geht und damit man also möglichst schnell was präsentieren kann und was zeigen kann. Aber ganz klar das Motiv von dem Herrscher, der seinem Volk irgendwie was Gutes tun wollte, um die ruhig zu halten, sag ich mal so platt.
ERZÄHLER
Statt auf die Barrikaden zu gehen, sollte das Volk lieber flanieren. Dafür bot der Englische Garten mit seinen über 370 Hektar viel Platz. Er gehört noch heute zu den größten innerstädtischen Parks weltweit. Der erste Volksgarten, den eine Stadt selbst in Auftrag gab, unabhängig von einem adeligen Regenten, entstand in Magdeburg, genauer: unmittelbar vor der Stadt: der Klosterbergegarten. Alle Grünflächen rund um die Festung waren während der napoleonischen Kriege dem Erdboden gleich gemacht worden – damit auch das Stück Natur, zu dem die Magdeburger sonntags gerne strömten. Da beschloss die Stadt:
9. ZUSPIELUNG Butenschön 10.00
Das geht so nicht weiter, wir müssen irgendwie Grünflächen anlegen, weil um die Stadt rum ist alles öde und trist und in der Stadt ist es dicht bebaut und wir haben riesige Festungsanlagen um uns rum. Und 1824 hat dann die Stadt den damaligen Landschaftsarchitekten oder Obergärtner in Preußen, nämlich Peter Joseph Lenné, gebeten, einen Entwurf für einen Stadtpark vorzulegen für die Stadt Magdeburg.
ATMO Garten, Schiffshorn
ERZÄHLER
Am Elbufer, südlich der Altstadt von Magdeburg, legte der Gartengestalter Peter Joseph Lenné den Volksgarten an, auf großzügigen 35 Hektar.
10. ZUSPIELUNG Butenschön 15:00
Er findet total richtig, dass dieser Park ein Ausdruck dessen sei, dass die Stadt sich so etwas leisten könne und wolle. Und damit hängt auch zusammen, dass nicht nur in seinem Stadtpark, sondern dann eigentlich in den meisten Stadtparks des 19. Jahrhunderts, dass immer ein Blick auf die Stadt geboten wird aus diesen Parkanlagen, also von den Spazierwegen. Das Bild der Stadt, die Silhouette mit den Türmen, dem Rathaus ist immer einbezogen und gerne der Ort, wo das Geld verdient wird. Das ist in Magdeburg die Elbe. Also der Blick auf die Elbe, wo die Schiffe fahren und wo der Handel getrieben wird. Das ist ein Bild in diesem Park, was man sehen soll, weil das quasi die Grundlage dafür ist, dass sich die Stadt so eine Anlage leisten kann.
Musik 8: Der Tod aus Metropolis – 36 Sek
ERZÄHLER
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen die urbanen Zentren. Zu Hunderttausenden drängten die Menschen, vor allem Arbeiter, in die Städte, die gar nicht so schnell Mietskasernen hochziehen konnten, um sie alle unterzubringen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner hausten in Hinterhauswohnungen ohne Luft und Licht und ohne Grün. Etliche Mieter mussten sich sogar schichtweise eine Schlafstelle teilen. Seuchen breiteten sich aus. Die Enge und die Konkurrenz um Arbeitsplätze führten zu sozialen Spannungen.
11. ZUSPIELUNG Loenhart 2.40
Die Lebensbedingungen der Bevölkerung wurden zunehmend kritischer…
ERZÄHLER
Der Landschaftsarchitekt und Professor an der TU Graz Klaus K. Loenhart [Lo-enhart]. Er sieht in den Parks
12. ZUSPIELUNG Loenhart 2.55
wirklich ein revolutionäres Konzept, nämlich einen öffentlichen Landschaftsraum zu gestalten, der allen Menschen zugänglich war, unabhängig von ihrer sozialen Stellung.
ERZÄHLER
Überall in den Ballungsgebieten halten jetzt Parks Einzug, dort wo noch Platz ist, in den Vorstädten und Arbeitervierteln. Das Ideal: soziale Integration mittels gemeinsamer Grünräume. Die Berliner Landschaftsarchitektin Sylvia Butenschön:
13. ZUSPIELUNG Butenschön 3.30
Diese Möglichkeit, einen für alle zugänglichen Raum zu haben, an dem jede Bewohnerin der Stadt sein darf, verschiedenste Dinge machen kann, ohne dass es was kostet, ohne dass man dafür Geld ausgeben muss, die finde ich einfach großartig. Und ich denke, das ist eines der ganz wichtigen Errungenschaften, die kommen aus den Gedanken der Aufklärung und des Humanismus.
ERZÄHLER
Die Besucherinnen und Besucher der Stadtparks sollten nicht nur aufatmen und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun – allein schon, um ihre Arbeitskraft zu erhalten. Man richtete an den Park auch einen moralischen Anspruch. Er sollte die Besucher in gewisser Weise zu besseren Menschen machen.
14. ZUSPIELUNG Butenschön 18.20
Und das fängt in Berlin an. Und zwar genau in den Bereichen, wo die Arbeiterschaft wohnt und wo man sagt, die Leute sollen nicht Geld ausgeben im Park, sondern die sollen dort gesund bleiben, indem sie sich spielerisch, sportlich, wie auch immer betätigen, also an der frischen Luft sind und eben nicht dazu verführt werden, ins Wirtshaus zu gehen und das Geld für Alkohol oder sonst irgendwas auszugeben.
Musik 9: False words – 1:58 Min
ERZÄHLER
Wie ein grüner Faden zieht sich durch die Geschichte des Stadtparks und ihrer Vorläufer: Er soll Begegnung ermöglichen. Damit das gelingt, spielt aus Sicht des Landschaftsarchitekten Klaus Loenhart eine wichtige Rolle, dass sich alle in einem Park zu Hause fühlen können.
15. ZUSPIELUNG Loenhart 16:18
Also wenn wir in den Park gehen, dass wir eben nicht in den Garten eines anderen gehen, sondern wir mitunter wirklich ein Gefühl haben: Ich darf mich da jetzt hinlegen, denn es ist auch ein Stückchen meins, mein Zuhause, mein Garten.
ERZÄHLER
Als „Benutzerpark und Gebrauchslandschaft“ – so verstand der Landschaftsarchitekt Günther Grzimek seinen Olympiapark in München. Entworfen hat er ihn in Zusammenarbeit mit dem Architekten Günther Behnisch für die Olympischen Spiele 1972: Eine Art Voralpenlandschaft mit einem See, künstlich geschaffen auf einem drei Quadratkilometer großen früheren Militärflugplatz, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Symbolträchtig: Der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg wurde begrünt und zum Olympiaberg transformiert. Grzimeks Kredo: Auf die Parkbesucher oder besser -benutzer und –benutzerinnen und ihre Bedürfnisse kommt es an. Sylvia Butenschön:
16. ZUSPIELUNG Butenschön 35.00
Die Gestaltung muss sich darauf einstellen, dass der Park wie ein guter Gebrauchsgegenstand von allen irgendwie genutzt werden kann, der akzeptiert, dass es Trampelpfade gibt, also dass die Entwicklung von Wegen nicht festgelegt wird von vornherein, sondern dass die Nutzerinnen das festlegen können und dass man auch im Park Blumen pflücken und eben Sträucher oder was abbrechen darf für die Eigennutzung als Gebrauchsgegenstand.
ERZÄHLER
Grzimeks Wunsch: Die Menschen sollten vom Park Besitz ergreifen, ihn sich aneignen. Klaus Loenhart:
17. ZUSPIELUNG Loenhart 17.30
Grzimek ist so ein Kind der sozialen Revolution, der Aneignung und mir gefällt dieser Begriff sehr, sehr gut, weil es eben ausdrückt auch die Freiheit, sich frei und unbefangen verhalten zu dürfen. Und eben quasi ein bisschen aus der eigenen sozialen Kontrolle, die man vielleicht auch anders lebt, in der Fußgängerzone oder auf dem Gehsteig, loszulassen und einfach mal zu laufen oder zu spielen.
ATMO Park, Kinder
ERZÄHLER
Ein solcher Gebrauchspark ist zum Beispiel auch der Volkspark Friedrichshain in Berlin. Er zieht Freizeitsportler, Anwohner und Anwohnerinnen und Touristen gleichermaßen an. Ob Freiluftkino im Sommer, Rodeln im Winter, Bouldern auf dem Kletterfelsen, Plantschen in einem riesigen Springbrunnen oder Grillen auf dem Rasen, alles ist dort möglich. Diese vielfältige Nutzung ist typisch für Parks des 20. und 21. Jahrhunderts. Hier rückt das gemeinschaftliche Erlebnis im Grünen in den Mittelpunkt, so Klaus Loenhart:
18. ZUSPIELUNG Loenhart 7.27
Was dazukommt und was natürlich ein großes gesellschaftliches Thema heute ist, sind natürlich die ökologischen Funktionen wie Klimaregulierung, Wasser-Retention und beispielsweise die Förderung der Biodiversität, die mir jetzt auch sehr am Herzen liegt, die eben viel stärker in diese Parks integriert wurden und werden.
Musik 10: False words – siehe oben – 1:08 Min
ERZÄHLER
Bäume sorgen für Schatten und Verdunstungskühle, sie reinigen die Luft, dämpfen den Verkehrslärm und halten mit ihren Wurzeln das Regenwasser im Boden. Gerade wenn sich die Stadt im Sommer aufheizt aufgrund der versiegelten und asphaltierten Flächen, sind Bäume für die Menschen dort eine Wohltat. Wo grüne Oasen entstehen und wie sie aussehen sollen, entscheidet heute nicht mehr allein die Stadtverwaltung. Man lässt die Bürger mitreden. Auf die Weise hat auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Stadt seit 2014 einer grünen Transformation unterzogen. Ihr Ziel: Paris soll eine nachhaltige, umweltfreundliche Metropole werden, in der die Menschen saubere Luft atmen können. Autos und riesige Parkplatzflächen wurden verbannt, dafür Tausende Bäume gepflanzt und Grünflächen geschaffen. Aus Sicht von Landschaftsarchitekt Klaus Loenhart ist das gelungen:
19. ZUSPIELUNG Loenhart 23.00
Das bedeutet natürlich viel Aufwand, viele Gespräche und Workshops mit den Bürgerinnen und Anwohnerinnen. … es scheint mir aber wirklich das einzig richtige Prinzip zu sein. Man spürt es in Paris, … wie dieses neue Grün gelebt, ganz begeistert angenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern und eben auch wertgeschätzt wird. Man spürt es im Umgang dann auch mit der Nachbarschaft. Die wird dann sehr, sehr wenig auch verschmutzt. ... Also die Tendenz ist geht dahin, von den zentralen Stadtparks hin in die Viertel zu gehen und kleine Garden Pockets auch zu entwickeln.
Musik 11: Infinite – 1:40 Min
ERZÄHLER
Die meisten Städte sind dicht bebaut, es herrscht Konkurrenz um die begrenzte Fläche. Garden Pockets, die Begrünung von Nischen, ist eine Antwort darauf: So werden Verkehrsinseln, Straßenecken, aber auch Fassaden, Innenhöfe und Flachdächer zu kleinen grünen Oasen in der Stadt. Oft gepflanzt, liebevoll gestaltet und gepflegt von Menschen aus der Nachbarschaft. Eine Chance für großflächiges Grün in der Stadt eröffnet sich immer dann, wenn Fabrikgelände, Hüttenwerke, Areale der Bahn, Kasernengelände aufgegeben werden. Der ehemalige Berliner Flughafen Tempelhof – heute ein riesiges, freies, überwiegend grünes Areal für Spaziergänger, Jogger, Inlineskater. Oder die High Line in New York City - eine stillgelegte Hochbahntrasse mitten in Manhattan – heute ein beliebter langgestreckter Garten.
Zur Musik: Atmo Parkwiese, Menschen
Die grüne Stadt von heute und morgen gibt es nicht, vielmehr ist jede Stadt auf ihre Weise grün. Idealerweise wird sie dem gerecht, was der erste große Gartentheoretiker Christian Cay Lorenz Hirschfeld vor über 250 Jahren schrieb:
ZITATOR 1
Alle gelangen hier ungehindert zu ihrem Rechte, sich an der Natur zu freuen.
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8181 ratings

Stadtgrün ist Lebensraum, Erholungsort und Klimaschützer. Doch wie kam das Grün in die Stadt? Wie hat sich die Bedeutung von Parks, Alleen und Grünflächen mit der Zeit verändert? In der Geschichte des Stadtgrüns spiegelt sich auch ein Wandel der Gesellschaft. Von Susanne Hofmann (BR 2025)
Credits
Autorin dieser Folge: Susanne Hofmann
Regie: Kirsten Böttcher
Es sprachen: Maren Ulrich, Johannes Hitzelberger, Heiko Ruprecht
Technik: Moritz Herrmann
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
Professor Stefan Schweizer, Honorarprofessor am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, wiss. Vorstand der Stiftung Schloss und Park Benrath und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur e.V.
PD Dr.-Ing. Sylvia Butenschön, Institut für Stadt- und Regionalplanung der TU Berlin
Professor Klaus K. Loenhart, Institut für Architektur und Landschaft der TU Graz
Podcast Tipp:
Wir helfen Garten-Anfängern zu echten Auskennern zu werden. Egal ob gepachteter Kleingarten oder das erste Hochbeet fürs eigene Gemüse am Häuschen – wir haben die richtigen Tipps und Ratschläge für Euch! ZUM PODCAST
Diese hörenswerten Folgen von IQ - Wissenschaft und Forschung könnten Sie auch interessieren:
Schwammstadt - Architektur der Zukunft
Enge in der Stadt - Alltag und Gesundheit
Klimawandel - was soll ich allein schon dagegen tun?
Klimarisiken - Wie können wir Europa retten?
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Für praktische Tipps wie Gärten Insekten-freundlich gestaltet werden können empfehlen wir Ihnen Summende Gärten
Linktipps:
Traktat von Karl Gottlob Schelle „Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen“ aus dem „Deutschen Textarchiv“ HIER geht es zu Website
Christian Cay Lorenz Hirschfeld 1785, Theorie der Gartenkunst HIER geht es zur Website
Literatur:
A. Thumfart, B. Hollstein, S. Tänzer (Hg.), Gärten – Von der Naturbeherrschung zur gesellschaftlichen Utopie
Ira Diana Mazzoni, 50 Klassiker Gärten und Parks, Gerstenberg Verlag, 2005
Jessica Jungbauer, Urban Oasis, Parks and Projects for a Greener Future, teNeues Verlag, 2023
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZITATORIN – werbend gesprochen
Ihr neues Zuhause wartet! Schmuckes Appartement in Altstadtnähe, nur wenige Schritte zu den grünen Oasen der Stadt mit naturnahen Freizeitmöglichkeiten. Lassen Sie sich diese Gelegenheit nicht entgehen!
ERZÄHLER
Städtisch und dennoch im Grünen – das beschreibt für viele Menschen die ideale Wohnlage. Die moderne Stadt ist eine grüne Stadt. Das städtische Grün gilt fast schon als Allheilmittel – gegen die Klimakrise, für die Volksgesundheit, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Nicht zuletzt steigert das Grün auch den Wert von Immobilien. Man spricht von grüner Infrastruktur – also vernetzten Grünflächen, die für eine Stadt lebensnotwendig sind. Davon ist auch die Landschaftsarchitektin Dr. Sylvia Butenschön von der TU Berlin überzeugt:
1. ZUSPIELUNG Butenschön 3.05
Heute ist es ein wichtiges Element, um die Städte zu strukturieren, Grün- und Freiraum in die Stadtquartiere zu bringen. Und es ist natürlich aus ökologischer Sicht oder aus naturschutzfachlicher Sicht ein wichtiges Element der Stadt: Wir profitieren von der Frischluftentstehung oder der Kaltluftentstehung in den Grünflächen, davon, dass es großen Raum für Biodiversität in der Stadt bietet, also für Tiere und Pflanzen. Ja, und dann eben in der Folge als Lebensraum, als Aufenthaltsraum, als Erholungsraum für die Bevölkerung geeignet ist.
ERZÄHLER
Und doch ist die grüne Stadt aus historischer Sicht ein recht junges Phänomen, sagt der Kunsthistoriker Stefan Schweizer, Honorarprofessor an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Sein Spezialgebiet ist die Gartengeschichte ab dem 17. Jahrhundert.
2. ZUSPIELUNG Schweizer 2.00
Das ist eigentlich eine Anomalie städtebaugeschichtlich seit der Frühneuzeit…. Bis 1600, vielleicht doch bis 1700 und mit den befestigten Städten bis 1800, ist die Stadt eigentlich genau das Gegenteil gewesen von Natur und das Gegenteil von Landschaft. Es war quasi die Ausgliederung von Natur aus dem urbanen Raum. (2.50) Wenn Sie sich historische Altstädte ansehen, … wenn sie an Siena denken oder Arezzo, die hochmittelalterlich geprägt sind, dann werden Sie … mit einer Enge und Dichte konfrontiert, die überhaupt keinen Raum ließ für öffentliches Grün.
Musik 2: Begegnung mit Barbarossa - – 1.02 Min+
Atmo Schafweide, später Atmo Wiese
ERZÄHLER
Natur und Landschaft fanden sich im Mittelalter überwiegend außerhalb der Städte. Auch die Allmenden, also unbebaute Flächen, die allen gemeinsam gehörten – daher der altdeutsche Begriff - , lagen für gewöhnlich außerhalb der Stadtmauern. Man ließ Schafe und Rinder dort weiden und sammelte dort Brennholz. In der Stadt, verborgen hinter Mauern, befanden sich zwar durchaus grüne Oasen: Sorgfältig gepflegte, geometrisch um einen Brunnen angelegte Klostergärten zum Beispiel. Doch zu ihnen hatte das Volk keinen Zugang. Ebenso wenig wie zu den privaten Stadtgärten der besseren Gesellschaft. Die hatte selbst in der dicht besiedelten Stadt ihr eigenes Grün, oft in Form begrünter Innenhöfe. Man konnte sie von der Straße aus nicht einmal sehen. Begrünte öffentliche Plätze oder auch nur Bäume in der Stadt waren rar in Mittelalter und Renaissance, sagt der Kunsthistoriker Stefan Schweizer:
3. ZUSPIELUNG Schweizer 4.30
Kurz nach 1600 beginnen dann die Diskussionen darüber, weil die Städte sich vergrößern, weil die Städte sich verdichten, weil die sozialhygienischen Bedingungen immer prekärer werden, auch für die Oberschicht prekärer werden, also auch die Oberschicht ist vor Pandemien oder Epidemien eben nicht gefeit. …Und daraus lernt man natürlich: Die sozial-hygienischen Bedingungen in der Stadt müssen verbessert werden.
Musik 3: 3. Satz: Sarabande en rondeau - CD492710 103 – 1:02 Min
ERZÄHLER
Man lechzte nach mehr Raum in den engen, überlaufenen Gassen. Auch nach frischer Luft - Schmutzwasser, Küchenabfälle und Fäkalien landeten schließlich oft in offenen Abwasserrinnen und sorgten für einen entsprechend strengen Geruch in der Stadt. Natur wurde dem gemeinen Städter erst peu-à-peu zugänglich gemacht, im Laufe des 17. und 18. Jahrhunderts. In
London waren einzelne königliche Parks öffentlich, der St. James’s Park beispielsweise. Mit der Öffnung für das Volk wollte sich der damalige englische König Charles II. als großzügiger Herrscher präsentieren. Ebenso öffentlich zugänglich war in Paris der barocke Garten am Palast der Tuilerien. Dort residierte der Sonnenkönig Ludwig XIV. Bei dem königlichen Garten handelte es sich um eine streng symmetrische Anlage, mit Alleen, Zierbrunnen, Skulpturen, Blumenarrangements und penibel gestutzten Hecken.
4. ZUSPIELUNG Schweizer 9.50
Dort wird so ne Art Stände-übergreifende Nutzung eingeübt, was auch interessant ist, weil Gärten damit überhaupt zu eminenten Orten der bürgerlichen Partizipation auch werden und der Emanzipation. … Also in Kirchen sind sie separiert, in Rathäusern sind sie separiert – überall wird segregiert und separiert, und in Gärten passiert es eben nicht.
ERZÄHLER
Später bekam das öffentliche städtische Grün sozusagen Schützenhilfe, und zwar aus unerwarteter Richtung: der Waffentechnik. Die Weiterentwicklung der Artillerie führte dazu, dass sich die Art der Kriegsführung grundlegend änderte. Da Kanonenkugeln jetzt Bastionen durchdringen konnten, wurden diese militärisch wertlos. Deshalb baute man ab dem 19. Jahrhundert die Festungen sukzessive zurück und hatte damit auf einmal Platz, viel Platz rund um die Städte. Und den konnte man gut gebrauchen, viele platzten schon aus allen Nähten.
Musik 4: 1. Satz aus: Sinfonia concertante (Haydn) – R0115330101 – 55 Sek
ERZÄHLER
Auf den eingeebneten Festungsringen entstanden großzügige Grüngürtel sowie breite Straßen, Boulevards – ein Wort, das sich aus dem niederländischen Begriff für Bollwerk ableitet. Die Boulevards waren von Bäumen gesäumt. Auch grüne Wege für Fußgänger entstanden rings um die Stadt, sogenannte Promenaden. Zum Beispiel in Wien. Da vermeldeten die Wiener Nachrichten am 14. September 1859:
ZITATORIN
Die dreißig Klafter
ERZÄHLER
also gut 50 Meter
ZITATORIN
breite, mit doppelten Baumreihen besetzte Straße, welche nach dem Stadterweiterungs-Plane gleich einem regelmäßigen Gürtel um die Stadt gezogen werden wird, erhielt den officiellen Namen Ringstraße.
Musik aus, Wechsel in Atmo Parkanlange, Schritte, Tauben
ERZÄHLER
Oder der Leipziger Promenadenring, mit Sitzbänken und Raum für eine neue Kulturtechnik: Das Spazierengehen.
ZITATOR
Oeftere Spatziergänge im Freyen erhalten den Sinn für die Natur und geben ihr auf das Gemüth wohlthätigen Einfluß. Jeder nicht unedle Mensch fühlt sich im Freyen reiner und menschlicher gestimmt. Alles Gute seiner Natur entfaltet sich da. … Die großen und freyen Ansichten der Natur entfesseln von den kleinlichen Verhältnissen des städtischen Zwanges.
ERZÄHLER
So lobt der Schriftsteller Karl Gottlob Schelle 1802 in seinem Traktat „Die Spatziergänge oder die Kunst spatzieren zu gehen“. Stefan Schweizer:
5. ZUSPIELUNG Schweizer 26.55
Das Promenieren ist nichts, was der Bürger des 16. Jahrhunderts als normal angesehen hätte, der hat seine Zeit mit wichtigeren Dingen zu verbringen, als zu promenieren. (27.22) Dazu brauchen sie ein gewisses Mindset, … und das hat auch sehr viel mit Freundschaftskult zu tun, der dann in der Romantik eben aufkommt, also unter Freunden gemeinsam in die Natur zu gehen. Und das ist übrigens dann auch eine politische Sache, in Teplitz besucht Goethe Beethoven, diesen schroffen Kerl, der ist da auf Kur und Goethe will sich mal mit ihm unterhalten, und dann gehen die an dem Tag spazieren, außerhalb der Stadt, an dem auch die Kaiserin dort aufschlägt. Und Beethoven und die Kaiserin gehen auf einen schmalen Pfad sich entgegen, und Beethoven weicht nicht. Und Goethe: Um Himmels Willen, Sie müssen doch der Kaiserin Platz machen! Nein – sie muss es für uns tun.
Musik 5: Beethoven: Allegro vivace – M00113027Z00- 45 Sek
ERZÄHLER
Das Erwachen des bürgerlichen Selbstbewusstseins zeigt sich in dieser Kulturtechnik des Promenierens. Der Spaziergang wird zu einem wichtigen Teil der städtischen Freizeitkultur. Die Landschaftsarchitektin Sylvia Butenschön:
6. ZUSPIELUNG Butenschön 7.05
Und dann kommt eben von Hirschfeld Ende des 18. Jahrhunderts erstmal die Idee, zu sagen, wir brauchen eigentlich was Größeres, was Flächenhaftes, wo sich die Leute ausbreiten können, wo man sich erholen kann, wo man andere Leute treffen kann, was wirklich so ein Gegengewicht quasi zur dicht besiedelten Stadt bildet.
ERZÄHLER
Christian Cay Lorenz Hirschfeld, seines Zeichens ordentlicher Professor der Philosophie und der schönen Wissenschaften auf der Universität zu Kiel, formuliert es 1785 in seiner „Theorie der Gartenkunst“ so:
Musik 6: Mozart: Oboenkonzert – 1:21 Min
ZITATOR
Eine ansehnliche Stadt muss in ihrem Umfang einen oder mehrere große offene Plätze haben, wo sich das Volk in gewissen Zeitpunkten der Freude oder der Noth versammeln und sich ausbreiten kann, wo eine freye und gesunde Luft athmet, und die Schönheit des Himmels und der Landschaft sich wieder zum Genuß eröffnet. Diese Plätze machen eine vorzügliche Zierde der Städte, wenn sie mit Rasen, mit Springbrunnen, mit Bildsäulen geschmückt, und von Baumpflanzungen und den schönern Gebäuden umkränzt sind.
ERZÄHLER
Die Idee des Volksgartens ist geboren, der Vorläufer des Volksparks und des späteren Stadtparks. Der Gartentheoretiker Hirschfeld zeigt sich in seinen Formulierungen ganz als Kind seiner Zeit, der Aufklärung:
ZITATOR
Diese Volksgärten sind… als ein wichtiges Bedürfnis des Stadtbewohners zu betrachten. Denn sie erquicken ihn nicht allein nach der Mühe des Tages mit anmuthigen Bildern und Empfindungen; sie ziehen ihn auch, indem sie ihn auf die Schauplätze der Natur locken, unmerklich von den unedlen … Arten der städtischen Zeitverkürzung ab, und gewöhnen ihn allmälig an das wohlfeile Vergnügen… Alle gelangen hier ungehindert zu ihrem Rechte, sich an der Natur zu freuen. (S. 68 Theorie, Band 5)
Musik 7: Walzer mit Trio – 23 Sek
ERZÄHLER
Wenig später, 1789, folgt der Theorie die Praxis. Auf Geheiß des Kurfürsten Karl Theodor wird in München ein riesiger Park angelegt, der Karl-Theodor-Park. Der Volksmund nennt ihn schnell den Englischen Garten. Denn er entspricht in seiner Gestaltung dem englischen Landschaftsgarten, ein Gegenentwurf zu den geometrisch angeordneten, übersichtlichen französischen Herrschaftsgärten der Barockzeit..
8. ZUSPIELUNG Butenschön 7.40
Es war noch so ein Top-Down-Produkt, wo der Kurfürst Karl Theodor von der Pfalz ja in Anbetracht der Ereignisse in Frankreich, also der französischen Revolution, den klugen Rat bekommen hat, seinem Volk irgendwas Gutes zu tun … und gesagt hat, okay, wir machen einen großen Park für die Stadtbevölkerung direkt vor den Toren der Stadt und hat diesen Englischen Garten als Stadtpark angelegt, in einer unglaublichen Geschwindigkeit. Das ist in zwei Jahren gebaut worden, am Anfang mit Fackelbeleuchtung in der Nacht, damit es möglichst schnell geht und damit man also möglichst schnell was präsentieren kann und was zeigen kann. Aber ganz klar das Motiv von dem Herrscher, der seinem Volk irgendwie was Gutes tun wollte, um die ruhig zu halten, sag ich mal so platt.
ERZÄHLER
Statt auf die Barrikaden zu gehen, sollte das Volk lieber flanieren. Dafür bot der Englische Garten mit seinen über 370 Hektar viel Platz. Er gehört noch heute zu den größten innerstädtischen Parks weltweit. Der erste Volksgarten, den eine Stadt selbst in Auftrag gab, unabhängig von einem adeligen Regenten, entstand in Magdeburg, genauer: unmittelbar vor der Stadt: der Klosterbergegarten. Alle Grünflächen rund um die Festung waren während der napoleonischen Kriege dem Erdboden gleich gemacht worden – damit auch das Stück Natur, zu dem die Magdeburger sonntags gerne strömten. Da beschloss die Stadt:
9. ZUSPIELUNG Butenschön 10.00
Das geht so nicht weiter, wir müssen irgendwie Grünflächen anlegen, weil um die Stadt rum ist alles öde und trist und in der Stadt ist es dicht bebaut und wir haben riesige Festungsanlagen um uns rum. Und 1824 hat dann die Stadt den damaligen Landschaftsarchitekten oder Obergärtner in Preußen, nämlich Peter Joseph Lenné, gebeten, einen Entwurf für einen Stadtpark vorzulegen für die Stadt Magdeburg.
ATMO Garten, Schiffshorn
ERZÄHLER
Am Elbufer, südlich der Altstadt von Magdeburg, legte der Gartengestalter Peter Joseph Lenné den Volksgarten an, auf großzügigen 35 Hektar.
10. ZUSPIELUNG Butenschön 15:00
Er findet total richtig, dass dieser Park ein Ausdruck dessen sei, dass die Stadt sich so etwas leisten könne und wolle. Und damit hängt auch zusammen, dass nicht nur in seinem Stadtpark, sondern dann eigentlich in den meisten Stadtparks des 19. Jahrhunderts, dass immer ein Blick auf die Stadt geboten wird aus diesen Parkanlagen, also von den Spazierwegen. Das Bild der Stadt, die Silhouette mit den Türmen, dem Rathaus ist immer einbezogen und gerne der Ort, wo das Geld verdient wird. Das ist in Magdeburg die Elbe. Also der Blick auf die Elbe, wo die Schiffe fahren und wo der Handel getrieben wird. Das ist ein Bild in diesem Park, was man sehen soll, weil das quasi die Grundlage dafür ist, dass sich die Stadt so eine Anlage leisten kann.
Musik 8: Der Tod aus Metropolis – 36 Sek
ERZÄHLER
Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert wuchsen die urbanen Zentren. Zu Hunderttausenden drängten die Menschen, vor allem Arbeiter, in die Städte, die gar nicht so schnell Mietskasernen hochziehen konnten, um sie alle unterzubringen. Viele Bewohnerinnen und Bewohner hausten in Hinterhauswohnungen ohne Luft und Licht und ohne Grün. Etliche Mieter mussten sich sogar schichtweise eine Schlafstelle teilen. Seuchen breiteten sich aus. Die Enge und die Konkurrenz um Arbeitsplätze führten zu sozialen Spannungen.
11. ZUSPIELUNG Loenhart 2.40
Die Lebensbedingungen der Bevölkerung wurden zunehmend kritischer…
ERZÄHLER
Der Landschaftsarchitekt und Professor an der TU Graz Klaus K. Loenhart [Lo-enhart]. Er sieht in den Parks
12. ZUSPIELUNG Loenhart 2.55
wirklich ein revolutionäres Konzept, nämlich einen öffentlichen Landschaftsraum zu gestalten, der allen Menschen zugänglich war, unabhängig von ihrer sozialen Stellung.
ERZÄHLER
Überall in den Ballungsgebieten halten jetzt Parks Einzug, dort wo noch Platz ist, in den Vorstädten und Arbeitervierteln. Das Ideal: soziale Integration mittels gemeinsamer Grünräume. Die Berliner Landschaftsarchitektin Sylvia Butenschön:
13. ZUSPIELUNG Butenschön 3.30
Diese Möglichkeit, einen für alle zugänglichen Raum zu haben, an dem jede Bewohnerin der Stadt sein darf, verschiedenste Dinge machen kann, ohne dass es was kostet, ohne dass man dafür Geld ausgeben muss, die finde ich einfach großartig. Und ich denke, das ist eines der ganz wichtigen Errungenschaften, die kommen aus den Gedanken der Aufklärung und des Humanismus.
ERZÄHLER
Die Besucherinnen und Besucher der Stadtparks sollten nicht nur aufatmen und ihrer Gesundheit etwas Gutes tun – allein schon, um ihre Arbeitskraft zu erhalten. Man richtete an den Park auch einen moralischen Anspruch. Er sollte die Besucher in gewisser Weise zu besseren Menschen machen.
14. ZUSPIELUNG Butenschön 18.20
Und das fängt in Berlin an. Und zwar genau in den Bereichen, wo die Arbeiterschaft wohnt und wo man sagt, die Leute sollen nicht Geld ausgeben im Park, sondern die sollen dort gesund bleiben, indem sie sich spielerisch, sportlich, wie auch immer betätigen, also an der frischen Luft sind und eben nicht dazu verführt werden, ins Wirtshaus zu gehen und das Geld für Alkohol oder sonst irgendwas auszugeben.
Musik 9: False words – 1:58 Min
ERZÄHLER
Wie ein grüner Faden zieht sich durch die Geschichte des Stadtparks und ihrer Vorläufer: Er soll Begegnung ermöglichen. Damit das gelingt, spielt aus Sicht des Landschaftsarchitekten Klaus Loenhart eine wichtige Rolle, dass sich alle in einem Park zu Hause fühlen können.
15. ZUSPIELUNG Loenhart 16:18
Also wenn wir in den Park gehen, dass wir eben nicht in den Garten eines anderen gehen, sondern wir mitunter wirklich ein Gefühl haben: Ich darf mich da jetzt hinlegen, denn es ist auch ein Stückchen meins, mein Zuhause, mein Garten.
ERZÄHLER
Als „Benutzerpark und Gebrauchslandschaft“ – so verstand der Landschaftsarchitekt Günther Grzimek seinen Olympiapark in München. Entworfen hat er ihn in Zusammenarbeit mit dem Architekten Günther Behnisch für die Olympischen Spiele 1972: Eine Art Voralpenlandschaft mit einem See, künstlich geschaffen auf einem drei Quadratkilometer großen früheren Militärflugplatz, nur wenige Kilometer vom Zentrum entfernt. Symbolträchtig: Der Trümmerberg aus dem Zweiten Weltkrieg wurde begrünt und zum Olympiaberg transformiert. Grzimeks Kredo: Auf die Parkbesucher oder besser -benutzer und –benutzerinnen und ihre Bedürfnisse kommt es an. Sylvia Butenschön:
16. ZUSPIELUNG Butenschön 35.00
Die Gestaltung muss sich darauf einstellen, dass der Park wie ein guter Gebrauchsgegenstand von allen irgendwie genutzt werden kann, der akzeptiert, dass es Trampelpfade gibt, also dass die Entwicklung von Wegen nicht festgelegt wird von vornherein, sondern dass die Nutzerinnen das festlegen können und dass man auch im Park Blumen pflücken und eben Sträucher oder was abbrechen darf für die Eigennutzung als Gebrauchsgegenstand.
ERZÄHLER
Grzimeks Wunsch: Die Menschen sollten vom Park Besitz ergreifen, ihn sich aneignen. Klaus Loenhart:
17. ZUSPIELUNG Loenhart 17.30
Grzimek ist so ein Kind der sozialen Revolution, der Aneignung und mir gefällt dieser Begriff sehr, sehr gut, weil es eben ausdrückt auch die Freiheit, sich frei und unbefangen verhalten zu dürfen. Und eben quasi ein bisschen aus der eigenen sozialen Kontrolle, die man vielleicht auch anders lebt, in der Fußgängerzone oder auf dem Gehsteig, loszulassen und einfach mal zu laufen oder zu spielen.
ATMO Park, Kinder
ERZÄHLER
Ein solcher Gebrauchspark ist zum Beispiel auch der Volkspark Friedrichshain in Berlin. Er zieht Freizeitsportler, Anwohner und Anwohnerinnen und Touristen gleichermaßen an. Ob Freiluftkino im Sommer, Rodeln im Winter, Bouldern auf dem Kletterfelsen, Plantschen in einem riesigen Springbrunnen oder Grillen auf dem Rasen, alles ist dort möglich. Diese vielfältige Nutzung ist typisch für Parks des 20. und 21. Jahrhunderts. Hier rückt das gemeinschaftliche Erlebnis im Grünen in den Mittelpunkt, so Klaus Loenhart:
18. ZUSPIELUNG Loenhart 7.27
Was dazukommt und was natürlich ein großes gesellschaftliches Thema heute ist, sind natürlich die ökologischen Funktionen wie Klimaregulierung, Wasser-Retention und beispielsweise die Förderung der Biodiversität, die mir jetzt auch sehr am Herzen liegt, die eben viel stärker in diese Parks integriert wurden und werden.
Musik 10: False words – siehe oben – 1:08 Min
ERZÄHLER
Bäume sorgen für Schatten und Verdunstungskühle, sie reinigen die Luft, dämpfen den Verkehrslärm und halten mit ihren Wurzeln das Regenwasser im Boden. Gerade wenn sich die Stadt im Sommer aufheizt aufgrund der versiegelten und asphaltierten Flächen, sind Bäume für die Menschen dort eine Wohltat. Wo grüne Oasen entstehen und wie sie aussehen sollen, entscheidet heute nicht mehr allein die Stadtverwaltung. Man lässt die Bürger mitreden. Auf die Weise hat auch die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo die Stadt seit 2014 einer grünen Transformation unterzogen. Ihr Ziel: Paris soll eine nachhaltige, umweltfreundliche Metropole werden, in der die Menschen saubere Luft atmen können. Autos und riesige Parkplatzflächen wurden verbannt, dafür Tausende Bäume gepflanzt und Grünflächen geschaffen. Aus Sicht von Landschaftsarchitekt Klaus Loenhart ist das gelungen:
19. ZUSPIELUNG Loenhart 23.00
Das bedeutet natürlich viel Aufwand, viele Gespräche und Workshops mit den Bürgerinnen und Anwohnerinnen. … es scheint mir aber wirklich das einzig richtige Prinzip zu sein. Man spürt es in Paris, … wie dieses neue Grün gelebt, ganz begeistert angenommen wird von den Bürgerinnen und Bürgern und eben auch wertgeschätzt wird. Man spürt es im Umgang dann auch mit der Nachbarschaft. Die wird dann sehr, sehr wenig auch verschmutzt. ... Also die Tendenz ist geht dahin, von den zentralen Stadtparks hin in die Viertel zu gehen und kleine Garden Pockets auch zu entwickeln.
Musik 11: Infinite – 1:40 Min
ERZÄHLER
Die meisten Städte sind dicht bebaut, es herrscht Konkurrenz um die begrenzte Fläche. Garden Pockets, die Begrünung von Nischen, ist eine Antwort darauf: So werden Verkehrsinseln, Straßenecken, aber auch Fassaden, Innenhöfe und Flachdächer zu kleinen grünen Oasen in der Stadt. Oft gepflanzt, liebevoll gestaltet und gepflegt von Menschen aus der Nachbarschaft. Eine Chance für großflächiges Grün in der Stadt eröffnet sich immer dann, wenn Fabrikgelände, Hüttenwerke, Areale der Bahn, Kasernengelände aufgegeben werden. Der ehemalige Berliner Flughafen Tempelhof – heute ein riesiges, freies, überwiegend grünes Areal für Spaziergänger, Jogger, Inlineskater. Oder die High Line in New York City - eine stillgelegte Hochbahntrasse mitten in Manhattan – heute ein beliebter langgestreckter Garten.
Zur Musik: Atmo Parkwiese, Menschen
Die grüne Stadt von heute und morgen gibt es nicht, vielmehr ist jede Stadt auf ihre Weise grün. Idealerweise wird sie dem gerecht, was der erste große Gartentheoretiker Christian Cay Lorenz Hirschfeld vor über 250 Jahren schrieb:
ZITATOR 1
Alle gelangen hier ungehindert zu ihrem Rechte, sich an der Natur zu freuen.

65 Listeners

17 Listeners
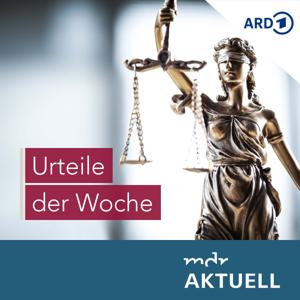
3 Listeners

44 Listeners

11 Listeners

8 Listeners

9 Listeners

5 Listeners

21 Listeners

110 Listeners

102 Listeners

50 Listeners

6 Listeners

9 Listeners

21 Listeners

0 Listeners

19 Listeners

0 Listeners

35 Listeners

33 Listeners

68 Listeners

4 Listeners

1 Listeners

31 Listeners

46 Listeners

12 Listeners

19 Listeners
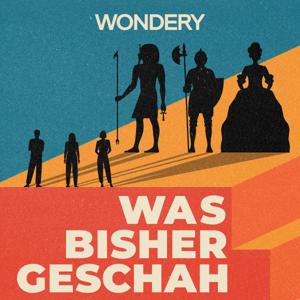
47 Listeners

1 Listeners

0 Listeners