
Sign up to save your podcasts
Or




Mehr als 80 Pflanzenarten können auf einer Wiese wachsen und viele Tiere anlocken. Diese Vielfalt bildet das Fundament vieler Ökosysteme. Intensiv genutztes Grünland ist üppig grün, aber weniger artenreich. Wie lassen sich Wiesen-Ökologie und Ökonomie ausbalancieren? Autorin: Renate Ell (BR 2025)
Credits
Autor/in dieser Folge: Renate Ell
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Rahel Comtesse
Technik: Monika Gsaenger
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
- Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie, Technische Universität München
- Inge Steidl, Biologin, Freising
- Rita Rott, BUND Naturschutz in Bayern, Landesfachgeschäftsstelle München
- Dr. Sabine Heinz, Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising
- Maria Bathow, Fachgebiet II 1.5, Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung, Umweltbundesamt, Dessau
Und noch eine Empfehlung der Redaktion:
IQ - Wissenschaft und Forschung · Waldmedizin - Kann der Wald wirklich heilen? · Podcast in der ARD Audiothek
Quellen und weiterführende Links:
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Atmo „Landschaft“, z.B. mit Lerchen, Schwalben, Heuschrecken
ERZÄHLERIN
Wälder, Äcker, Wiesen – das ist der Dreiklang unserer Kulturlandschaft. Also dem, was nicht die Natur geschaffen hat, sondern wir Menschen. Wiesen sind das jüngste dieser drei Elemente. Würden sie nicht gemäht, um Tierfutter zu erzeugen, gäbe es sie nicht. Dann würden dort erst Büsche wachsen und irgendwann ein Wald. Nur auf wenigen Flächen kommen natürliche Grasflächen vor, erklärt Wolfgang Weisser, Professor für Terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München.
(1. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Wenn der Boden sehr dünn ist, und Büsche und insbesondere Bäume schlecht wachsen können, hat man oft eine sehr kurze Vegetation; oder wenn es sehr feucht wäre, und keine Bäume wachsen können, kann es sein, dass man da Grasländer hat, aber im Grunde sind Grasländer erst durch die menschliche Nutzung sehr häufig geworden.
MUSIK: ANCIENT FLUTE JOURNEY 0‘40
ERZÄHLERIN
Bevor Menschen anfingen, Rinder und Schafe zu halten, haben wildlebende Pflanzenfresser wie Wisente, Auerochsen, Elche oder Hirsche das Gras abgeweidet. Mit der Ausweitung der Landwirtschaft entstanden „halboffene“ Landschaften mit Grasflächen und Bäumen. Bauern trieben ihre Tiere in diese sogenannten Hutewälder wie heute auf eine Weide. Im Lauf des Mittelalters entwickelte sich dann die Heuwirtschaft mit großen, eigens angelegten Wiesenflächen, um immer mehr Nutztiere zu versorgen, auch mit getrocknetem Gras im Winter. Für heutige Hochleistungs-Rinder liefert Heu allerdings nicht genug Nährstoffe. Sie werden mit Silage gefüttert – das ist vergorenes Gras, vergleichbar mit Sauerkraut. Dieser jüngste Entwicklungsschritt der Wiesen-Wirtschaft hat das Grasland stark verändert.
(2. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Für Silage möchte man möglichst viel frische Biomasse haben, die proteinreich ist, die man dann vergären kann, wenn Sie also nur das maximieren wollen, dann ist es gut, wenn sie sehr, sehr oft mähen und die Pflanzen nicht zur Blüte kommen lassen.
ERZÄHLERIN
Sehr oft mähen, bis zu sieben mal im Jahr: Das funktioniert nur mit viel Dünger. Den liefern die Tiere, die mit der Silage gefüttert werden; vor allem Gülle. Im Extremfall werden solche Wiesen sogar alle paar Jahre umgebrochen und neu angelegt, damit bestimmte Gräser und Klee-Arten mit hohem Proteingehalt immer dominieren.
(3. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Dann haben Sie natürlich immer eine Artengemeinschaft, die ganz weit abweicht von dem, was eine Wiese ist, Insekten insbesondere; aber Wiesen sind, wenn sie nicht so intensiv bewirtschaftet werden, sehr artenreich, was die Pflanzen angeht und eben auch sehr artenreich, was die Tiere angeht, was besonders ist und was viele Leute auch eben schön finden.
Musik: Good reasons 0‘40
Atmo Wiese und Heuschrecke
ERZÄHLERIN
Etwa die Hälfte der in Deutschland heimischen Pflanzen können in Wiesen vorkommen – und je größer die Pflanzenvielfalt ist, desto mehr Tiere lockt eine Wiese an: Insekten wie Hummeln, Schmetterlinge und Ameisen, Vögel vom Kiebitz bis zum Storch, außerdem Mäuse, Kaninchen, Frösche, Eidechsen und so weiter. Landwirte, denen eine ideale Balance zwischen Ökologie und Ertrag gelingt, weil sie nicht intensiv, sondern extensiv wirtschaften, können in Bayern bei der „Wiesen-Meisterschaft“ punkten.
(4. ZUSP.) INGE STEIDL MIT ATMO – Z.T. UNTER DEN TEXT BLENDEN, IN TEXTPAUSEN FREI, SODASS MAN IMMER WIEDER PFLANZENNAMEN HÖRT.
(nennt Pflanzennamen)
ERZÄHLERIN
Die Biologin Inge Steidl aus Freising, eine ausgewiesene Pflanzenbestimmungs-Expertin geht über eine Wiese, die für den Wettbewerb angemeldet ist, und schaut, was dort wächst.
Immer Anfang Mai finden solche Begehungen statt – seit 2009 können sich jedes Jahr Landwirte in einer anderen Region Bayerns um die Wiesenmeisterschaft bewerben.
Der Wettbewerb ist ein gemeinsames Projekt der Landesanstalt für Landwirtschaft und des Bund Naturschutz in Bayern – und diese Zusammenarbeit spiegelt auch die Ziele wider, erklärt Rita Rott vom Bund Naturschutz, die auch bei der Wiesen-Begutachtung dabei ist.
(5. ZUSP.) RITA ROTT
Weil wir eben nicht nur die Hobby-Wiesen sehen wollen, kartieren wollen, sondern wir wollen wirklich an die Betriebe ran, die das im Betriebssystem gut unterbringen und trotzdem noch einen Blick für den Naturschutz und Artenschutz auf der Fläche haben. Immer wo eine extensive Wiese ist, wirklich eine artenreiche Wiese, muss ein Bewirtschafter dahinter sein, der sich darüber Gedanken gemacht hat
ERZÄHLERIN
Und die Biologin Inge Steidl ergänzt:
(6. ZUSP.) INGE STEIDL
Diese Wiesen, die wir dann prämieren, die sollen ja auch gewisse Vorbildcharakter haben für den ganz normalen Durchschnitts-Landwirt, um eben zu zeigen, dass sich Artenreichtum und Nutzung nicht von vornherein ausschließen. Also das ist uns eben ganz wichtig.
Musik: Critical tasks 0‘25
Atmo Rasenmäher
ERZÄHLERIN
In der Kategorie Naturschutz gibt es die höchste Punktzahl, wenn auf der Wettbewerbs-Wiese mehr als 50 Arten wachsen – in den Alpen können es über 80 werden – und noch dazu seltene, gefährdete Rote-Liste-Arten. Artenreiche Wiesen werden auf trockenen Standorten typischerweise zweimal jährlich gemäht, auf anderen Standorten dreimal, oder zweimal plus Weide-Nutzung im Herbst. Im Gegensatz zu intensiven Wiesen, die bis zu siebenmal gemäht werden – und schon so früh, dass wiesenbrütende Vögel wie Kiebitze keine Chance haben. Es spielt aber auch eine Rolle, wie gemäht wird, erklärt Sabine Heinz. Sie kümmert sich in der Landesanstalt für Landwirtschaft um die Wiesen-Meisterschaften .
(7. ZUSP.) SABINE HEINZ
Es gibt Kreiselmäher, die einen sehr starken Sog entwickeln, und bei diesem Sog werden halt kleine Tiere mit in das Mähwerk hineingesogen und dann zerkleinert, danach kommt dann häufig noch der Aufbereiter, der das Ganze noch zerquetscht, das führt zu einer schnelleren Trocknung, führt aber auch dazu, dass die Tiere tatsächlich das nicht überleben; wesentlich schonender sind Balkenmäher, die schneiden das Gras mit zwei gegeneinander sich bewegenden Schneiden ab, das Gras fällt einfach nur runter, dadurch können halt wesentlich mehr Tiere entkommen, und es gibt auch keinen Aufbereiter, von daher bleiben einfach wesentlich mehr Insekten am Leben; wichtig wäre es aber auch noch zusätzlich am besten einen Altgrasstreifen stehen zu lassen, wo nämlich die Insekten, die sich haben retten können, dann hineinkönnen, wenn die ganze Wiese gemäht ist, das wäre so das ideale.
ERZÄHLERIN
In der Kategorie Landwirtschaft geht es um den Futter-Ertrag und wie das Futter im Betrieb verwertet wird.
(8. ZUSP.) SABINE HEINZ
Beispielsweise die eigenen Tiere, die damit gefüttert werden, das wird sehr positiv bewertet bei uns, und wenn die eigenen Tiere dann auch noch gleich vor Ort beispiels¬weise geschlachtet und zu Fleischpaketen verarbeitet und vermarktet werden, sodass die Wertschöpfung halt im Betrieb bleibt, im Ort bleibt, das gibt bei uns für den Betrieb dann auch nochmal Punkte, weil es wichtig ist, dass auch tatsächlich eine Wertschöpfung da ist, dass man Artenvielfalt und landwirtschaftliche Nutzung zusammenbringt.
Musik: Critical tasks 0‘27
ERZÄHLERIN
Die Sieger im Wiesen-Wettbewerb haben vielleicht nicht die volle Punktzahl in beiden Kategorien – aber sie zeigen, wie eine gute Balance zwischen Naturschutz und Landwirtschaft gelingt. Dabei helfen Fördermittel, die den geringeren Ertrag im Vergleich zu intensiv gedüngten Wiesen ausgleichen. Die fließen zum Beispiel, wenn sich ein Landwirt verpflichtet, erst nach dem 15. Juni oder 1. Juli das erste Mal zu mähen – wenn Gras und andere Pflanzen schon weniger Proteine enthalten. Der Nachteil ist: Wenn zu diesem Termin Dauerregen droht, darf man trotzdem nicht mal einen Tag früher mähen. Aber es gibt auch eine Alternative: die sogenannte „ergebnisorientierte Honorierung“. Dabei dienen bestimmte Pflanzenarten als Indikatoren für artenreiches Grünland.
(9. ZUSP.) SABINE HEINZ
Das heißt, die Landwirte werden nicht dafür gefördert, was sie tun, sondern dafür, dass sie das Ergebnis haben „artenreiches Grünland“, das bekommen Sie natürlich nur, wenn Sie spät mähen, nicht zu viel düngen, aber der Landwirt hat praktisch selbst die Entscheidung, wann mähe ich, wann dünge ich, wie viel dünge ich, und wie erhalte ich den Zustand?
ATMO DRESCHMASCHINE
MUSIK: GREEN TINY GRASS 0‘25
ERZÄHLERIN
Entscheidet sich der Landwirt doch, die Fläche intensiv zu bewirtschaften, ist das nicht nur ein Verlust für alle Pflanzen und Tiere, die in und von diesem Ökosystem gelebt haben. Sondern auch für Menschen. Und dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, erklärt die Psychologin Maria Bathow, die sich am Umweltbundesamt mit dem Einfluss von Natur und Umwelt auf die mentale Gesundheit beschäftigt.
(10. ZUSP.) MARIA BATHOW
Solastalgie, das beschreibt ein Gefühl von Heimweh, ohne dass ich meine Heimat aber jemals verlassen habe. Wenn sich jetzt eine artenreiche, blütenreiche Wiese wandelt, hin zu einer artenarmen Wiese, kann sich dieses Gefühl von Verlust, von Trauer einstellen. Insbesondere eben dann, wenn ich die ehemals artenreiche Wiese als etwas sehr Positives, wohltuendes und auch identitätsstiftendes erlebt habe.
Atmo: Wiese
ERZÄHLERIN
Identitätsstiftend sind bunte, artenreiche Wiesen für Menschen, die in einer Gegend mit entsprechender Landwirtschaft leben – aber sicher auch für regelmäßige Urlaubsgäste. Dass Wiesen wohltuend sind, merkt man vielleicht erst, wenn sie fehlen. Schon weil sie alle Sinne ansprechen.
(11. ZUSP.) MARIA BATHOW
Ich habe visuelle Reize. Also ich kann mir verschiedene Pflanzen angucken, ich kann Tiere angucken, ich kann Vögel beobachten, das wirkt alles wohltuend positiv stimulierend, und über verschiedene Gruppen von Menschen hinweg hat man da gefunden, dass das als besonders ästhetisch empfunden wird. Dann gibt es eine Vielzahl akustischer Reize. Wir können Insekten summen oder brummen hören, wir können Vogelgesang hören, und wir haben Naturgerüche. Und auch da gibt es Hinweise, dass so ein Geruch von Kräutern, Blumen oder Gräsern sehr stressreduzierend wirken kann.
Slow ballet (reduced) 0‘40
ERZÄHLERIN
Im Zusammenhang mit der wohltuenden Wirkung von Natur ist in den letzten Jahren das „Waldbaden“ populär geworden, ein Trend aus Japan. Auch dabei geht es um das Wahrnehmen mit allen Sinnen, für das man vielleicht sogar barfuß geht. Es kann nachweisbar den Blutdruck senken, Stress reduzieren und das Immunsystem stärken.
Könnte man nicht auch „Wiesenbaden“?
(12. ZUSP.) MARIA BATHOW
Je intensiver, je direkter ich mit Natur interagiere, desto eher kann ich diese erholsamen Qualitäten für mich selbst nutzen. Und deshalb finde ich die Idee von so einem Wiesen¬baden gar nicht so uninteressant, dann könnte man dieses Konzept Waldbaden einfach auf den Wiesenraum übertragen und sagen: Ich spaziere jetzt entlang dieser Wiese und versuche mal mit allen Sinnen, diese Wiese wahrzunehmen.
ERZÄHLERIN
Daran entlang spazieren, nicht mitten rein! Gerade bei blütenreichen, hoch-gewachsenen Wiesen, denn plattgetretene Pflanzen möchte der Landwirt nicht haben.
Experimente speziell zur Wirkung artenreicher Wiesen hat bisher nur eine Gruppe von Forschenden um Petra Lindemann-Mathies angestellt, ehemals Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Dazu absolvierten die Teilnehmenden erst einen Test, der sie unter Stress setzte, und schauten dann zur Entspannung eine Zeit lang entweder auf einen sandigen Boden oder auf ein Stück Wiese. Vor und nach dieser Entspannungsphase wurde der Blutdruck gemessen.
(13. ZUSP.) MARIA BATHOW
Die Studie hat gezeigt, dass Pflanzenvielfalt Stressabbau fördert, im Gegensatz zum Betrachten von vegetationslosen Flächen. Und diese verschiedenen Wiesenabschnitte, die da präsentiert wurden, die wurden ja nochmal variiert hinsichtlich der Artenvielfalt. Und da hat sich gezeigt: Eine mittlere Artenvielfalt trägt ganz besonders zum Stressabbau bei.
MUSIK: A BEGINNING 0‘55
ERZÄHLERIN
32 Pflanzenarten waren ideal. Bei dem Experiment zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht oder Naturverbundenheit der Teilnehmenden. Das ist auch insofern interessant, als die Vielzahl stark gedüngter, artenarmer Wiesen eine neue Entwicklung sind. Ältere oder besonders naturverbundene Menschen könnten also Wehmut oder „Solastalgie“ empfinden, weil sie bunte Wiesen vermissen, und vielleicht auch Kiebitze oder andere Wiesenbrüter, die in solchen Wiesen ihre Nester bauen konnten. Viele junge Menschen hingegen vermissen nichts, sie kennen nur dichte, blütenarme Wiesen ohne Vogelnester. Für solche Entwicklungen gibt es den Begriff „neues Normal“. Aber:
(14. ZUSP.) MARIA BATHOW
Studien haben gezeigt, dass Menschen unabhängig von ihrem Wissen über Biodiversität, oder unabhängig davon, ob sie sich selbst als naturverbunden beschreiben, Biodiversität immer vorziehen und immer eher schätzen als eine artenarme Fläche. Das ist was Intuitives, was wir alle in uns tragen. Um es dann auch zu schützen, braucht es Wissen. Und da könnten artenreiche Grünflächen ja durchaus so etwas wie Lernorte sein. Wo Exkursionen angeboten werden, wo naturpädagogische Programme angeboten werden, um die ökologischen Zusammenhänge noch besser zu verstehen, und zu verstehen was müssen wir da eigentlich schützen, um letztlich auch uns selber gut zu tun?
Atmo Wiese
ERZÄHLERIN
Um uns ganz direkt gut zu tun – durch Entspannung und Erlebnisse mit allen Sinnen, wenn wir an einer Wiese entlang spazieren oder uns am Rand zu einer Rast niederlassen. Aber auch weit über diesen Ort und diesen Moment hinaus. Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der erst vor rund 20 Jahren geprägt wurde: „Ökosystem-Leistungen“. Gerade mit Wiesen lässt er sich besonders gut illustrieren. Große Auwiesen zum Beispiel können bei einem Hochwasser viel Wasser aufnehmen. Nicht nur durch ihre schiere Fläche, wichtig ist auch die Bodenstruktur. Je älter eine Wiese ist, desto mehr Poren hat sie, weil es viele verschiedene Regenwurm-Arten gibt, erklärt der Ökologie-Professor Wolfgang Weisser.
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8282 ratings

Mehr als 80 Pflanzenarten können auf einer Wiese wachsen und viele Tiere anlocken. Diese Vielfalt bildet das Fundament vieler Ökosysteme. Intensiv genutztes Grünland ist üppig grün, aber weniger artenreich. Wie lassen sich Wiesen-Ökologie und Ökonomie ausbalancieren? Autorin: Renate Ell (BR 2025)
Credits
Autor/in dieser Folge: Renate Ell
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Rahel Comtesse
Technik: Monika Gsaenger
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
- Prof. Dr. Wolfgang Weisser, Lehrstuhl für Terrestrische Ökologie, Technische Universität München
- Inge Steidl, Biologin, Freising
- Rita Rott, BUND Naturschutz in Bayern, Landesfachgeschäftsstelle München
- Dr. Sabine Heinz, Institut für Ökologischen Landbau, Bodenkultur und Ressourcenschutz, Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft, Freising
- Maria Bathow, Fachgebiet II 1.5, Umweltmedizin und gesundheitliche Bewertung, Umweltbundesamt, Dessau
Und noch eine Empfehlung der Redaktion:
IQ - Wissenschaft und Forschung · Waldmedizin - Kann der Wald wirklich heilen? · Podcast in der ARD Audiothek
Quellen und weiterführende Links:
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Atmo „Landschaft“, z.B. mit Lerchen, Schwalben, Heuschrecken
ERZÄHLERIN
Wälder, Äcker, Wiesen – das ist der Dreiklang unserer Kulturlandschaft. Also dem, was nicht die Natur geschaffen hat, sondern wir Menschen. Wiesen sind das jüngste dieser drei Elemente. Würden sie nicht gemäht, um Tierfutter zu erzeugen, gäbe es sie nicht. Dann würden dort erst Büsche wachsen und irgendwann ein Wald. Nur auf wenigen Flächen kommen natürliche Grasflächen vor, erklärt Wolfgang Weisser, Professor für Terrestrische Ökologie an der Technischen Universität München.
(1. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Wenn der Boden sehr dünn ist, und Büsche und insbesondere Bäume schlecht wachsen können, hat man oft eine sehr kurze Vegetation; oder wenn es sehr feucht wäre, und keine Bäume wachsen können, kann es sein, dass man da Grasländer hat, aber im Grunde sind Grasländer erst durch die menschliche Nutzung sehr häufig geworden.
MUSIK: ANCIENT FLUTE JOURNEY 0‘40
ERZÄHLERIN
Bevor Menschen anfingen, Rinder und Schafe zu halten, haben wildlebende Pflanzenfresser wie Wisente, Auerochsen, Elche oder Hirsche das Gras abgeweidet. Mit der Ausweitung der Landwirtschaft entstanden „halboffene“ Landschaften mit Grasflächen und Bäumen. Bauern trieben ihre Tiere in diese sogenannten Hutewälder wie heute auf eine Weide. Im Lauf des Mittelalters entwickelte sich dann die Heuwirtschaft mit großen, eigens angelegten Wiesenflächen, um immer mehr Nutztiere zu versorgen, auch mit getrocknetem Gras im Winter. Für heutige Hochleistungs-Rinder liefert Heu allerdings nicht genug Nährstoffe. Sie werden mit Silage gefüttert – das ist vergorenes Gras, vergleichbar mit Sauerkraut. Dieser jüngste Entwicklungsschritt der Wiesen-Wirtschaft hat das Grasland stark verändert.
(2. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Für Silage möchte man möglichst viel frische Biomasse haben, die proteinreich ist, die man dann vergären kann, wenn Sie also nur das maximieren wollen, dann ist es gut, wenn sie sehr, sehr oft mähen und die Pflanzen nicht zur Blüte kommen lassen.
ERZÄHLERIN
Sehr oft mähen, bis zu sieben mal im Jahr: Das funktioniert nur mit viel Dünger. Den liefern die Tiere, die mit der Silage gefüttert werden; vor allem Gülle. Im Extremfall werden solche Wiesen sogar alle paar Jahre umgebrochen und neu angelegt, damit bestimmte Gräser und Klee-Arten mit hohem Proteingehalt immer dominieren.
(3. ZUSP.) WOLFGANG WEISSER
Dann haben Sie natürlich immer eine Artengemeinschaft, die ganz weit abweicht von dem, was eine Wiese ist, Insekten insbesondere; aber Wiesen sind, wenn sie nicht so intensiv bewirtschaftet werden, sehr artenreich, was die Pflanzen angeht und eben auch sehr artenreich, was die Tiere angeht, was besonders ist und was viele Leute auch eben schön finden.
Musik: Good reasons 0‘40
Atmo Wiese und Heuschrecke
ERZÄHLERIN
Etwa die Hälfte der in Deutschland heimischen Pflanzen können in Wiesen vorkommen – und je größer die Pflanzenvielfalt ist, desto mehr Tiere lockt eine Wiese an: Insekten wie Hummeln, Schmetterlinge und Ameisen, Vögel vom Kiebitz bis zum Storch, außerdem Mäuse, Kaninchen, Frösche, Eidechsen und so weiter. Landwirte, denen eine ideale Balance zwischen Ökologie und Ertrag gelingt, weil sie nicht intensiv, sondern extensiv wirtschaften, können in Bayern bei der „Wiesen-Meisterschaft“ punkten.
(4. ZUSP.) INGE STEIDL MIT ATMO – Z.T. UNTER DEN TEXT BLENDEN, IN TEXTPAUSEN FREI, SODASS MAN IMMER WIEDER PFLANZENNAMEN HÖRT.
(nennt Pflanzennamen)
ERZÄHLERIN
Die Biologin Inge Steidl aus Freising, eine ausgewiesene Pflanzenbestimmungs-Expertin geht über eine Wiese, die für den Wettbewerb angemeldet ist, und schaut, was dort wächst.
Immer Anfang Mai finden solche Begehungen statt – seit 2009 können sich jedes Jahr Landwirte in einer anderen Region Bayerns um die Wiesenmeisterschaft bewerben.
Der Wettbewerb ist ein gemeinsames Projekt der Landesanstalt für Landwirtschaft und des Bund Naturschutz in Bayern – und diese Zusammenarbeit spiegelt auch die Ziele wider, erklärt Rita Rott vom Bund Naturschutz, die auch bei der Wiesen-Begutachtung dabei ist.
(5. ZUSP.) RITA ROTT
Weil wir eben nicht nur die Hobby-Wiesen sehen wollen, kartieren wollen, sondern wir wollen wirklich an die Betriebe ran, die das im Betriebssystem gut unterbringen und trotzdem noch einen Blick für den Naturschutz und Artenschutz auf der Fläche haben. Immer wo eine extensive Wiese ist, wirklich eine artenreiche Wiese, muss ein Bewirtschafter dahinter sein, der sich darüber Gedanken gemacht hat
ERZÄHLERIN
Und die Biologin Inge Steidl ergänzt:
(6. ZUSP.) INGE STEIDL
Diese Wiesen, die wir dann prämieren, die sollen ja auch gewisse Vorbildcharakter haben für den ganz normalen Durchschnitts-Landwirt, um eben zu zeigen, dass sich Artenreichtum und Nutzung nicht von vornherein ausschließen. Also das ist uns eben ganz wichtig.
Musik: Critical tasks 0‘25
Atmo Rasenmäher
ERZÄHLERIN
In der Kategorie Naturschutz gibt es die höchste Punktzahl, wenn auf der Wettbewerbs-Wiese mehr als 50 Arten wachsen – in den Alpen können es über 80 werden – und noch dazu seltene, gefährdete Rote-Liste-Arten. Artenreiche Wiesen werden auf trockenen Standorten typischerweise zweimal jährlich gemäht, auf anderen Standorten dreimal, oder zweimal plus Weide-Nutzung im Herbst. Im Gegensatz zu intensiven Wiesen, die bis zu siebenmal gemäht werden – und schon so früh, dass wiesenbrütende Vögel wie Kiebitze keine Chance haben. Es spielt aber auch eine Rolle, wie gemäht wird, erklärt Sabine Heinz. Sie kümmert sich in der Landesanstalt für Landwirtschaft um die Wiesen-Meisterschaften .
(7. ZUSP.) SABINE HEINZ
Es gibt Kreiselmäher, die einen sehr starken Sog entwickeln, und bei diesem Sog werden halt kleine Tiere mit in das Mähwerk hineingesogen und dann zerkleinert, danach kommt dann häufig noch der Aufbereiter, der das Ganze noch zerquetscht, das führt zu einer schnelleren Trocknung, führt aber auch dazu, dass die Tiere tatsächlich das nicht überleben; wesentlich schonender sind Balkenmäher, die schneiden das Gras mit zwei gegeneinander sich bewegenden Schneiden ab, das Gras fällt einfach nur runter, dadurch können halt wesentlich mehr Tiere entkommen, und es gibt auch keinen Aufbereiter, von daher bleiben einfach wesentlich mehr Insekten am Leben; wichtig wäre es aber auch noch zusätzlich am besten einen Altgrasstreifen stehen zu lassen, wo nämlich die Insekten, die sich haben retten können, dann hineinkönnen, wenn die ganze Wiese gemäht ist, das wäre so das ideale.
ERZÄHLERIN
In der Kategorie Landwirtschaft geht es um den Futter-Ertrag und wie das Futter im Betrieb verwertet wird.
(8. ZUSP.) SABINE HEINZ
Beispielsweise die eigenen Tiere, die damit gefüttert werden, das wird sehr positiv bewertet bei uns, und wenn die eigenen Tiere dann auch noch gleich vor Ort beispiels¬weise geschlachtet und zu Fleischpaketen verarbeitet und vermarktet werden, sodass die Wertschöpfung halt im Betrieb bleibt, im Ort bleibt, das gibt bei uns für den Betrieb dann auch nochmal Punkte, weil es wichtig ist, dass auch tatsächlich eine Wertschöpfung da ist, dass man Artenvielfalt und landwirtschaftliche Nutzung zusammenbringt.
Musik: Critical tasks 0‘27
ERZÄHLERIN
Die Sieger im Wiesen-Wettbewerb haben vielleicht nicht die volle Punktzahl in beiden Kategorien – aber sie zeigen, wie eine gute Balance zwischen Naturschutz und Landwirtschaft gelingt. Dabei helfen Fördermittel, die den geringeren Ertrag im Vergleich zu intensiv gedüngten Wiesen ausgleichen. Die fließen zum Beispiel, wenn sich ein Landwirt verpflichtet, erst nach dem 15. Juni oder 1. Juli das erste Mal zu mähen – wenn Gras und andere Pflanzen schon weniger Proteine enthalten. Der Nachteil ist: Wenn zu diesem Termin Dauerregen droht, darf man trotzdem nicht mal einen Tag früher mähen. Aber es gibt auch eine Alternative: die sogenannte „ergebnisorientierte Honorierung“. Dabei dienen bestimmte Pflanzenarten als Indikatoren für artenreiches Grünland.
(9. ZUSP.) SABINE HEINZ
Das heißt, die Landwirte werden nicht dafür gefördert, was sie tun, sondern dafür, dass sie das Ergebnis haben „artenreiches Grünland“, das bekommen Sie natürlich nur, wenn Sie spät mähen, nicht zu viel düngen, aber der Landwirt hat praktisch selbst die Entscheidung, wann mähe ich, wann dünge ich, wie viel dünge ich, und wie erhalte ich den Zustand?
ATMO DRESCHMASCHINE
MUSIK: GREEN TINY GRASS 0‘25
ERZÄHLERIN
Entscheidet sich der Landwirt doch, die Fläche intensiv zu bewirtschaften, ist das nicht nur ein Verlust für alle Pflanzen und Tiere, die in und von diesem Ökosystem gelebt haben. Sondern auch für Menschen. Und dafür gibt es sogar einen Fachbegriff, erklärt die Psychologin Maria Bathow, die sich am Umweltbundesamt mit dem Einfluss von Natur und Umwelt auf die mentale Gesundheit beschäftigt.
(10. ZUSP.) MARIA BATHOW
Solastalgie, das beschreibt ein Gefühl von Heimweh, ohne dass ich meine Heimat aber jemals verlassen habe. Wenn sich jetzt eine artenreiche, blütenreiche Wiese wandelt, hin zu einer artenarmen Wiese, kann sich dieses Gefühl von Verlust, von Trauer einstellen. Insbesondere eben dann, wenn ich die ehemals artenreiche Wiese als etwas sehr Positives, wohltuendes und auch identitätsstiftendes erlebt habe.
Atmo: Wiese
ERZÄHLERIN
Identitätsstiftend sind bunte, artenreiche Wiesen für Menschen, die in einer Gegend mit entsprechender Landwirtschaft leben – aber sicher auch für regelmäßige Urlaubsgäste. Dass Wiesen wohltuend sind, merkt man vielleicht erst, wenn sie fehlen. Schon weil sie alle Sinne ansprechen.
(11. ZUSP.) MARIA BATHOW
Ich habe visuelle Reize. Also ich kann mir verschiedene Pflanzen angucken, ich kann Tiere angucken, ich kann Vögel beobachten, das wirkt alles wohltuend positiv stimulierend, und über verschiedene Gruppen von Menschen hinweg hat man da gefunden, dass das als besonders ästhetisch empfunden wird. Dann gibt es eine Vielzahl akustischer Reize. Wir können Insekten summen oder brummen hören, wir können Vogelgesang hören, und wir haben Naturgerüche. Und auch da gibt es Hinweise, dass so ein Geruch von Kräutern, Blumen oder Gräsern sehr stressreduzierend wirken kann.
Slow ballet (reduced) 0‘40
ERZÄHLERIN
Im Zusammenhang mit der wohltuenden Wirkung von Natur ist in den letzten Jahren das „Waldbaden“ populär geworden, ein Trend aus Japan. Auch dabei geht es um das Wahrnehmen mit allen Sinnen, für das man vielleicht sogar barfuß geht. Es kann nachweisbar den Blutdruck senken, Stress reduzieren und das Immunsystem stärken.
Könnte man nicht auch „Wiesenbaden“?
(12. ZUSP.) MARIA BATHOW
Je intensiver, je direkter ich mit Natur interagiere, desto eher kann ich diese erholsamen Qualitäten für mich selbst nutzen. Und deshalb finde ich die Idee von so einem Wiesen¬baden gar nicht so uninteressant, dann könnte man dieses Konzept Waldbaden einfach auf den Wiesenraum übertragen und sagen: Ich spaziere jetzt entlang dieser Wiese und versuche mal mit allen Sinnen, diese Wiese wahrzunehmen.
ERZÄHLERIN
Daran entlang spazieren, nicht mitten rein! Gerade bei blütenreichen, hoch-gewachsenen Wiesen, denn plattgetretene Pflanzen möchte der Landwirt nicht haben.
Experimente speziell zur Wirkung artenreicher Wiesen hat bisher nur eine Gruppe von Forschenden um Petra Lindemann-Mathies angestellt, ehemals Professorin an der Pädagogischen Hochschule Karlsruhe. Dazu absolvierten die Teilnehmenden erst einen Test, der sie unter Stress setzte, und schauten dann zur Entspannung eine Zeit lang entweder auf einen sandigen Boden oder auf ein Stück Wiese. Vor und nach dieser Entspannungsphase wurde der Blutdruck gemessen.
(13. ZUSP.) MARIA BATHOW
Die Studie hat gezeigt, dass Pflanzenvielfalt Stressabbau fördert, im Gegensatz zum Betrachten von vegetationslosen Flächen. Und diese verschiedenen Wiesenabschnitte, die da präsentiert wurden, die wurden ja nochmal variiert hinsichtlich der Artenvielfalt. Und da hat sich gezeigt: Eine mittlere Artenvielfalt trägt ganz besonders zum Stressabbau bei.
MUSIK: A BEGINNING 0‘55
ERZÄHLERIN
32 Pflanzenarten waren ideal. Bei dem Experiment zeigten sich keine Unterschiede hinsichtlich Alter, Geschlecht oder Naturverbundenheit der Teilnehmenden. Das ist auch insofern interessant, als die Vielzahl stark gedüngter, artenarmer Wiesen eine neue Entwicklung sind. Ältere oder besonders naturverbundene Menschen könnten also Wehmut oder „Solastalgie“ empfinden, weil sie bunte Wiesen vermissen, und vielleicht auch Kiebitze oder andere Wiesenbrüter, die in solchen Wiesen ihre Nester bauen konnten. Viele junge Menschen hingegen vermissen nichts, sie kennen nur dichte, blütenarme Wiesen ohne Vogelnester. Für solche Entwicklungen gibt es den Begriff „neues Normal“. Aber:
(14. ZUSP.) MARIA BATHOW
Studien haben gezeigt, dass Menschen unabhängig von ihrem Wissen über Biodiversität, oder unabhängig davon, ob sie sich selbst als naturverbunden beschreiben, Biodiversität immer vorziehen und immer eher schätzen als eine artenarme Fläche. Das ist was Intuitives, was wir alle in uns tragen. Um es dann auch zu schützen, braucht es Wissen. Und da könnten artenreiche Grünflächen ja durchaus so etwas wie Lernorte sein. Wo Exkursionen angeboten werden, wo naturpädagogische Programme angeboten werden, um die ökologischen Zusammenhänge noch besser zu verstehen, und zu verstehen was müssen wir da eigentlich schützen, um letztlich auch uns selber gut zu tun?
Atmo Wiese
ERZÄHLERIN
Um uns ganz direkt gut zu tun – durch Entspannung und Erlebnisse mit allen Sinnen, wenn wir an einer Wiese entlang spazieren oder uns am Rand zu einer Rast niederlassen. Aber auch weit über diesen Ort und diesen Moment hinaus. Hier kommt ein Begriff ins Spiel, der erst vor rund 20 Jahren geprägt wurde: „Ökosystem-Leistungen“. Gerade mit Wiesen lässt er sich besonders gut illustrieren. Große Auwiesen zum Beispiel können bei einem Hochwasser viel Wasser aufnehmen. Nicht nur durch ihre schiere Fläche, wichtig ist auch die Bodenstruktur. Je älter eine Wiese ist, desto mehr Poren hat sie, weil es viele verschiedene Regenwurm-Arten gibt, erklärt der Ökologie-Professor Wolfgang Weisser.

74 Listeners

18 Listeners
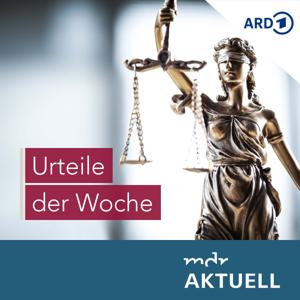
4 Listeners

51 Listeners

6 Listeners

5 Listeners

19 Listeners

108 Listeners

105 Listeners

26 Listeners

49 Listeners

4 Listeners

9 Listeners

18 Listeners

16 Listeners

0 Listeners

37 Listeners

12 Listeners

36 Listeners

67 Listeners

3 Listeners

1 Listeners

1 Listeners

28 Listeners

44 Listeners

16 Listeners

16 Listeners
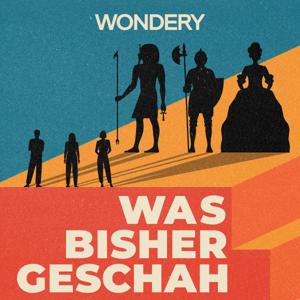
46 Listeners

0 Listeners

1 Listeners