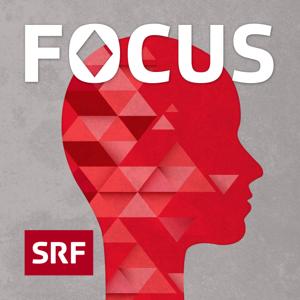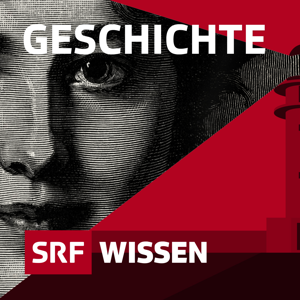Sie stechen und kratzen. Sie breiten sich oft rasch und flächendeckend aus. Doch einige gelten als Delikatesse und manche eignen sich sogar als Futtermittel. SRF-Gartenfachfrau Silvia Meister gibt einen Überblick.
Disteln sind äusserst wehrhafte Pflanzen. Die ursprüngliche indogermanische Bedeutung des Wortes «Distel» lautet: spitzig, stachelig, scharf. Verschiedene Distelarten wurden in der Schweiz seit Jahrhunderten vielfältig genutzt – etwa als:
· Gemüse in der welschen Schweiz: Die «Wälschdistle», gemeint ist die Wilde Artischocke, der sogenannte Cardy.
· Viehfutter: Verschiedene Gänsedisteln, auch Bitterdistel, Milchdistel oder «Sü-Dischtle» genannt.
· Heilpflanze: Etwa die Mariendistel – sie wird auch Froschdistel genannt, wegen ihrer getupften Blätter.
· Wetterzeiger: Die Silberdistel zeigt zuverlässig höhere Luftfeuchtigkeit und damit ein nahendes Tiefdruckgebiet an.
· Schnitt- und Trockenblume: Die Edeldistel, auch Mannstreu oder «Chrüsi-Distel» genannt.
Die meisten Weidetiere meiden die stacheligen Pflanzen. Nur Esel mit ihren festen Lippen und Zungen sowie Ziegen fressen Disteln.
Neben dem Schutz erfüllt das stachelige Gewand noch eine wichtige Funktion: Disteln wachsen oft an trockenen, sonnigen Standorten mit wasserdurchlässiger Erde – Wasser ist hier Mangelware. An ihren Stacheln perlt Regenwasser ab und tropft direkt zu den Wurzeln.





 View all episodes
View all episodes


 By Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)
By Schweizer Radio und Fernsehen (SRF)