
Sign up to save your podcasts
Or




Afrika. Der schwarze Kontinent. Dunkel, gefährlich, primitiv. So hat das Europa lange dargestellt. Erst nach der Kolonialzeit hat sich eine andere Geschichtsschreibung herausgebildet - von Afrikanern selbst, nicht nur über sie. Von Klaus Uhrig (BR 2016)
Credits
Autor: Klaus Uhrig
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Katja Amberger, Stefan Wilkening, Friedrich Schloffer, Heinz Peter
Technik: Monika Gsaenger
Redaktion: Gerda Kuhn & Nicole Ruchlak
Im Interview: Prof. Dr. Toyin Falola, Prof. Dr. Andreas Eckert
Besonderer Linktipp der Redaktion:
SR: Fragen an den Autor
Die traditionsreichste Sachbuchsendung im deutschen Sprachraum stellt seit über 50 Jahren jeweils ein Buch eines Autors eine Stunde lang im Gespräch vor – und das mittlerweile auch als Podcast. Die Themen reichen von Politik und Wirtschaft bis zu Gesundheit, Erziehung oder Psychologie. Dabei kann auch das Publikum Fragen an die Autorinnen und Autoren stellen. ZUM PODCAST
Linktipps:
Deutschlandfunk (2024): Afrika im Aufbruch – Koloniales überwinden, sich selbst bestimmen
Die Geschichte Afrikas reicht Jahrmillionen zurück. Kulturschaffende wie Designerinnen und Musiker wollen heute auf dieser reichen Vergangenheit aufbauen, den Kolonialismus überwinden und selbst bestimmen, was Afrika ist. JETZT ANHÖREN
ZDF (2023): Afrika von oben - Menschen
In Afrika existieren viele unterschiedliche Volksgruppen. Ihre Art zu leben unterscheidet sich stark – von sehr ursprünglich als Jäger und Sammler bis hypermodern. JETZT ANSEHEN
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
Im Podcast „TATORT GESCHICHTE“ sprechen die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrandt über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte. True Crime – und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun?
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Erzähler:
Das große Missverständnis zwischen Afrika und der Geschichtswissenschaft zeigt sich bereits ganz am Anfang.
Erzählerin:
Also ganz am Anfang der Geschichtswissenschaft.
MUSIK
Erzähler:
Am 26. Mai 1789 hält ein gewisser Friedrich Schiller seine Antrittsvorlesung an der Universität von Jena - mit dem Titel: "Was ist und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?"
Erzählerin:
Der Saal ist völlig überfüllt. Schiller ist zu diesem Zeitpunkt längst als Schriftsteller berühmt. Außerdem ist das Fach neu. So neu, dass der Historiker Schiller offiziell eine Professur für Philosophie bekommt - denn Lehrstühle für Geschichte gibt es noch nicht. Die Geschichtswissenschaft beginnt gerade erst, sich als akademische Disziplin herauszubilden.
Erzähler:
Schillers Antrittsvorlesung findet ein begeistertes Publikum. Dass sie so lebendig wirkt, liegt auch an einem rhetorischen Kniff: Schiller zählt nicht nur die Errungenschaften der abendländischen Geschichte auf, sondern er kontrastiert sie immer wieder mit einem anschaulichen Gegenbeispiel: Die nach seinem Wissen völlig unzivilisierten Weltgegenden außerhalb Europas. Südamerika. Der Südpazifik. Afrika.
Zitator (Schiller):
„Was erzählen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden sie ohne Bekanntschaft mit den unentbehrlichsten Künsten, ohne das Eisen, ohne den Pflug, einige sogar ohne den Besitz des Feuers. Manche rangen noch mit wilden Thieren um Speise und Wohnung, bei vielen hatte sich die Sprache noch kaum von thierischen Tönen zu verständlichen Zeichen erhoben.“
Erzählerin:
Schiller ist kein Rassist. Das muss man dazu sagen. Er hat nur - wie fast alle Europäer - wenig Ahnung von der Welt außerhalb Europas.
Erzähler:
Er weiß zum Beispiel nicht, dass zu diesem Zeitpunkt mitten in diesem Afrika das zweitgrößte Bauwerk der Menschheitsgeschichte steht: Die Mauern von Benin im heutigen Nigeria. Eine mächtige Festungsanlage, die weltweit nur von der Chinesischen Mauer übertroffen wird.
Erzählerin:
Er weiß auch nichts von den Staaten an den großen Seen: Den Königreichen Bunyoro und Buganda und Ruanda, ihren komplexen Kulturen und ausgefeilten staatlichen Strukturen.
Erzähler:
Und dass es in Afrika - und zwar nicht nur in Ägypten - antike Hochkulturen gab, die bereits 2.000 Jahre vor seiner Zeit große Leistungen vollbrachten - auch das ist Schiller völlig unbekannt.
Erzählerin:
Seine Idee von "Universalgeschichte" ist eine Geschichte des Abendlandes. Dass irgendwelche Afrikaner dazu irgendetwas beizutragen haben könnten, ist offenbar selbst für einen der klügsten Köpfe des späten 18. Jahrhunderts kaum vorstellbar.
Erzähler:
Das ändert sich auch im 19. Jahrhundert nicht. Beispiel Hegel: Der berühmte Philosoph formuliert 1837 einen Gedanken über Afrika, der sich in den nächsten eineinhalb Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreuen wird: Afrika, der Kontinent ohne Geschichte.
MUSIK
Zitator (Hegel):
„Jenes (...) Afrika ist, so weit die Geschichte zurückgeht, für den Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben; es ist das in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewußten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist.“
O-Ton Andreas Eckert:
Die Vorstellung, Afrikaner könnten irgendwas entwickeln oder zur Menschheitsgeschichte Entscheidendes beitragen, das erschien den meisten Zeitgenossen einfach absurd oder unmöglich.
Erzählerin:
Andreas Eckert, Professor für Afrikanische Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin.
O-Ton Andreas Eckert:
Sicherlich gab es auch nicht so furchtbar viele Quellen. Aber der Hauptgrund ist glaub ich doch ein zutiefst rassistisches Denken. Und für ihn war Afrika etwas Unbekanntes, etwas Anderes, das er vor allem mit dem Sklavenhandel und der Sklaverei verband, und damit auch sehr stark ein zeitgenössisches Bild transportierte, das Afrika auch als Opfer auch des Sklavenhandels zeigte, aber eben als irgendwie erbärmlichen Kontinent, wo eigentlich nichts passiert.
MUSIK
Erzähler:
Natürlich ist so ein Afrikabild für die europäische Öffentlichkeit auch durchaus praktisch. Denn im 19. Jahrhundert liefern sich die Europäer einen kolonialen Wettlauf um Afrika. Briten, Franzosen und Portugiesen annektieren große Gebiete. Der belgische König sichert sich den Kongo als Privatkolonie. Und gegen Ende des Jahrhunderts tauchen auch noch die Deutschen auf und besetzen die paar Landstriche, die noch übrig sind.
Erzählerin:
Und wenn das so arme Primitive sind, dort in Afrika, geschichts- und kulturlos, dann ist es natürlich völlig in Ordnung, sich ihre Länder einzuverleiben.
Erzähler:
Und die verquere Logik des Kolonialismus geht sogar noch einen Schritt weiter.
Erzählerin:
Es ist nicht nur natürlich, es ist sogar die verdammte Pflicht eines zivilisierten Europäers. Die Bürde des weißen Mannes.
Erzähler:
Das Bild vom geschichtslosen Kontinent hält sich noch lange - und das, obwohl mit den Kolonialherren auch die ersten europäischen Wissenschaftler nach Afrika kommen. Darunter auch ein paar Historiker.
Erzählerin:
Das Interesse an afrikanischer Geschichte ist allerdings immer noch überschaubar. Aus mehreren Gründen. Zum einen traut man den Afrikanern nicht zu, allzu viel Geschichte zu haben. Zum anderen versteht man die afrikanischen Sprachen noch zu wenig – und Schriftzeugnisse gibt es kaum.
Erzähler:
Das hält die Historiker und Sprachforscher aber nicht davon ab, wilde Theorien über die Geschichte Afrikas aufzustellen.
Erzählerin:
Eine der bizarrsten und mit Sicherheit die von den Auswirkungen her tragischste dieser Theorien ist die sogenannte Hamitentheorie.
Erzähler:
Sie hat ihren Ursprung in den Überlegungen des englischen Forschungsreisenden John Hanning Speke. Speke hatte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts eine Expedition angeführt, die sich auf die Suche nach den Quellen des Nils machte. Dabei drang er bis ins Gebiet des heutigen Uganda und Ruanda vor.
Erzählerin:
Dort traf er - für ihn überraschend - auf äußerst komplexe Gesellschafts-Strukturen, die er sich nur dadurch erklären kann, dass dort unterschiedliche Stämme nacheinander eingewandert seien. Für ihn und seine Nachfolger war dadurch klar: Die Geschichte Afrikas musste eine Geschichte von Wanderungsbewegungen sein.
O-Ton Andreas Eckert:
Das war allerdings oft sehr rassistisch geprägt und immer mit der Idee verbunden, bestimmte Entwicklungen in der Geschichte Afrikas könne man eigentlich nur erklären über den Einfluss von Nicht-Afrikanern, von Gruppen, die nach Afrika eingewandert sind, hellhäutige Gruppen. „Hamiten“ wurden die oft genannt und es gibt eine sogenannte Hamitentheorie, die im Grunde besagt, dass alles, was in Afrika an Entwicklung vor der Kolonialzeit geschah, von diesen Völkern von außen initiiert worden ist.
Erzähler:
Der Begriff „Hamiten“ geht auf die biblische Geschichte des Ham zurück. Ham, ein Sohn des Noah, wird darin von seinem Vater verflucht. Wobei sich der Fluch nicht direkt auf ihn bezieht, sondern auf seine Nachkommen.
Erzählerin:
Schon früh wurde diese Geschichte von Juden, Moslems, und Christen auch rassistisch interpretiert: Der Makel des Fluches sei sichtbar geworden durch die dunkle Hautfarbe der Nachkommen Hams.
Erzähler:
In der modernen Interpretation wurden die Hamiten dann zu einer eigenen Rasse erklärt. Hamiten seien zwar dunkelhäutig, aber bei genauerem Hinsehen nicht ganz so schwarz, wie andere Schwarze. Außerdem seien sie intelligenter und kriegerischer und hätten so, aus dem Nahen Osten kommend, viele "minderwertige" Völker unterworfen.
Erzählerin:
Ein Beispiel: Ruanda. Die Gesellschaft in Ruanda gliedert sich traditionell in zwei Gruppen: Hutu und Tutsi. Die Hutu waren früher großteils Bauern und stellten die große Masse der Bevölkerung. Die Tutsi dagegen waren großteils Viehhirten und bildeten die schmalere Oberschicht der ruandischen Kultur.
MUSIK
Erzähler:
Die Vertreter der Hamitentheorie interpretieren diese Gesellschaftsstruktur so: Die Hutu seien die ursprüngliche Bevölkerung Ruandas, und vergleichsweise primitiv. Die kriegerischen und klugen, weil angeblich „hamitischen“ Tutsi seien irgendwann von Norden her eingewandert, hätten die Hutu-Bauern unterworfen und bildeten nun die "natürliche Oberschicht" des Landes. Jahrzehntelang ist diese Theorie wissenschaftlicher Konsens. Und das, obwohl sie schon im Falle Ruandas voller Widersprüche ist. So kann sie kaum erklären, wieso die angeblich völlig unterschiedlichen Völker der Hutu und Tutsi die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Götter anbeten, überhaupt: Teil derselben Kultur sind. Andreas Eckert:
O-Ton Andreas Eckert:
Die Hamitentheorie ist wissenschaftlich völliger Humbug. Sie ist aber natürlich wirkungsmächtig gewesen, weil sie auch in ein bestimmtes Bild hineinpasst. Und weil es eben durchaus sehr bekannten Wissenschaftlern der Zeit gleichsam gelungen ist, diese Theorie wissenschaftlich scheinbar zu belegen. Mit bestimmten sprachgeschichtlichen Zeugnissen, die dann vermeintlich Hinweise auf bestimmte Wanderungen geben und so weiter und so fort. Sie hat eben den Zeitgeist relativ gut widergespiegelt und schien gewissermaßen rassistische Annahmen auch wissenschaftlich zu belegen. Das klärt ein Stück weit ihren großen Erfolg bis weit in das 20. Jahrhundert hinein.
Erzähler:
Im Falle Ruandas entwickelt die Hamitentheorie dann schließlich ein gespenstisches Eigenleben. Die Belgier übernehmen 1918 Ruanda von den Deutschen und errichten ein äußerst rassistisches Kolonialregime. Dabei bedienen sie sich der traditionellen Tutsi-Eliten, denen sie mit der Hamitentheorie eine Rechtfertigung für ihre Höherstellung in der ruandischen Gesellschaft liefern.
Erzählerin:
Gemeinsam schreiben Tutsi und Belgier eine neue Geschichte des Landes, in der Tutsi zu einer überlegenen Eroberer-Rasse stilisiert werden, die sich ganz „natürlich“ die Herrschaft über die Hutu erkämpft hat.
Erzähler:
Später wird genau diese Geschichtserzählung den Tutsi zum Verhängnis. Nach der Unabhängigkeit kommt in Ruanda die Hutu-Mehrheit an die Macht. Die neuen Hutu-Eliten übernehmen die rassistische Geschichtsschreibung – deuten sie aber in ihrem Sinne um. Denn wenn die Tutsi tatsächlich irgendwann später nach Ruanda eingewandert waren – sind sie dann nicht eigentlich Invasoren? Fremde, die gar nicht nach Ruanda gehören, und die man genauso gut wieder vertreiben könnte?
Erzählerin:
Jahrzehntelang kocht die Hutu-Rassenideologie vor sich hin, immer wieder gibt es Pogrome an den Tutsi, dann einen Aufstand von Tutsi-Rebellen. Schließlich bildet sich Anfang der 90er Jahre eine radikale Hutu-Bewegung, die ganz offen über die Ausrottung der zu „fremden Einwanderern“ erklärten Tutsi nachdenkt.
O-Ton Andreas Eckert:
Ruanda ist ohne Zweifel das radikalste und traurigste Beispiel, dass eine solche Theorie dann eben nicht nur von Europäern, sondern auch von afrikanischen Eliten blutig gleichsam in die Praxis getragen wurde.
Erzähler:
Was dann passiert im Frühjahr 1994 ist bekannt: Der Genozid an den Tutsi. Eine Million Tote.
MUSIK
Erzählerin:
Natürlich gibt für den Genozid zahlreiche weitere Gründe: wirtschaftliche, machtpolitische. Aber als Begründung für den größten Massenmord der afrikanischen Geschichte wird immer wieder die angebliche „Fremdrassigkeit“ der Tutsi angeführt.
Erzähler:
Nicht überall wird die koloniale Geschichtsschreibung so wenig hinterfragt, wie in Ruanda. Im Gegenteil.
Erzählerin:
Als in den späten 1950er und frühen 60er Jahren die meisten afrikanischen Staaten unabhängig werden, ist das Interesse an der eigenen Geschichte groß. Für den bekannten nigerianischen Historiker Toyin Falola ein beispielloser Aufbruch.
O-Ton Toyin Falola:
Very big interest. Because we want to know our past. We want to use the information on this past to build development. We are interested in making history relevant to contemporary education and were also interested in connecting history to nation building.
Overvoice:
Das Interesse an Geschichte war riesig. Wir wollten unsere Vergangenheit erforschen. Und wir wollten dieses Wissen nutzen, um uns weiter zu entwickeln. Wir wollten, dass die Geschichte eine wichtige Rolle in unserem Bildungssystem spielt. Und natürlich ging es auch um die Rolle der Geschichte für den Aufbau unserer Nation.
Erzähler:
In vielen afrikanischen Staaten entwickelt sich eine eigene Geschichtswissenschaft. Von den Europäern übernimmt man wissenschaftliche Methoden – ohne sich allerdings die europäischen Geschichtsdeutungen zu eigen zu machen.
Erzählerin:
Mündliche Erzählungen werden von einigen dieser Historiker erstmals als gleichwertige Quellen akzeptiert. Und die alten Quellen, die Reiseberichte und Kolonialgeschichtsbücher, werden sozusagen gegen den Strich gelesen. Also analysiert und hinterfragt. Toyin Falola:
O-Ton Toyin Falola:
There was a generation before me that was interested in what we call Nationalist Historiography. The idea of Nationalist Historiography is to argue that Africans in the past were able to create great civilizations, like Egypt, Mali Empire or Ghana Empire. They wanted to argue that Africans have been able to manage their continent and to create leadership that could manage.
Overvoice:
Das war eine Generation vor mir. Da gab es großes Interesse an dem, was man "Nationalist Historiography" nannte. Die Idee dahinter ist, zu argumentieren, dass Afrikaner in der Vergangenheit große Zivilisationen geschaffen haben. Ägypten, Mali, das Reich von Ghana. Die Forscher wollten zeigen, dass Afrikaner durchaus in der Lage waren, ihren Kontinent zu verwalten und eigene Führungsschichten hervorzubringen.
Erzähler:
Die Vertreter dieser “nationalistischen Geschichtsschreibung” konzentrieren sich stark auf die positiven Errungenschaften afrikanischer Völker. Viele von ihnen betätigen sich nebenbei auch als Schriftsteller oder Politiker.
Erzählerin:
Zahlreiche europäische Geschichtsdeutungen werden auf einmal von afrikanischen Wissenschaftlern völlig auf den Kopf gestellt. Und nicht nur das: Auch in Europa und den USA beginnt in den 50er und 60er Jahren ein Umdenken – weg vom Rassismus, hin zu einer neuen, weniger vorurteilsbelasteten Art der Geschichtsschreibung.
Erzähler:
Einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten afrikanischen Historiker dieser Zeit ist der Senegalese Cheikh Anta Diop.
O-Ton Andreas Eckert:
Der hat betont, dass das alte Ägypten viele Impulse gesetzt hat, die nachher die Griechen gleichsam geklaut und als ihre eigenen ausgegeben haben. Also dass die Wiege der Zivilisation eigentlich in Ägypten und damit in Afrika spielt. Um das ganze Argument noch zu verstärken hat er behauptet, dass eben ein Großteil des alten Ägyptens von einer schwarzen Bevölkerung bevölkert war, und das ist natürlich etwas, was sich wissenschaftlich als kaum haltbar erweist, zeigt aber noch mal sehr deutlich diesen Versuch jetzt, in besonders radikaler Weise auch die Geschichte gleichsam zu politisieren und für die Gegenwart relevant zu machen, indem man eben sagt, wir haben eine glorreiche Geschichte, und an diese Geschichte müssen wir jetzt nach dem Joch der Kolonialzeit wieder anknüpfen.
Erzählerin:
Bei Cheikh Anta Diop lassen sich Geschichtswissenschaft und politischer Aktivismus kaum trennen. Drei Parteien gründet er im Laufe seines Lebens - von denen allerdings nie eine die Regierung stellt. Seine Schriften sind leidenschaftliche Manifeste gegen die europäische Geschichtsdeutung.
Erzähler:
Heute ist zwar die Universität der senegalesischen Hauptstadt Dakar nach Diop benannt. Doch seine radikalen Interpretationen teilen nur noch wenige afrikanische Forscher.
MUSIK
Erzählerin:
Auf den großen Aufbruch der 60er Jahre folgt in den meisten afrikanischen Ländern die große Ernüchterung. In einigen Staaten brechen schon kurz nach der Unabhängigkeit blutige Bürgerkriege aus - im Kongo zum Beispiel, etwas später auch in Nigeria. Dazu kommt: Die allgegenwärtige Korruption.
Erzähler:
Die weißen Kolonisatoren sind weg - doch die neuen, einheimischen Eliten beuten ihre Bevölkerung weiter aus. Viele der jüngeren Intellektuellen, darunter auch Historiker, werden zu den schärfsten Kritikern ihrer eigenen Staaten.
O-Ton Toyin Falola:
In my own generation we began to look for new ideas. Especially Marxism. We’re looking for socialist ideas to transform the continent. Because of the disappointment with the performance of the states. So in the 70s and 80s you find academics of the left trying to write radical history and use that radical history to make an argument regarding the failure of the postcolonial state. I was part of that movement.
Overvoice:
Meine Generation begann dann, sich neuen Ideen zuzuwenden. Vor allem dem Marxismus. Wir wollten mit sozialistischen Idealen unseren Kontinent verändern - Weil wir so enttäuscht waren von den postkolonialen Staaten. Also gab es in den 70ern und 80ern viele linke Akademiker, die anders an die Geschichtsschreibung herangegangen sind. Radikal. Politisch. Um auf das Scheitern der Postkolonialen Staaten hinzuweisen. Auch ich habe zu dieser Bewegung gehört.
Erzählerin:
Trotz aller Versuche, die Geschichtswissenschaft in Afrika neu zu etablieren, ist ihr Einfluss in den letzten Jahrzehnten eher zurückgegangen. Viele afrikanische Staaten haben ihren Universitäten die Gelder gekürzt.
Erzähler:
Und gerade die Geisteswissenschaften haben in vielen Ländern einen schweren Stand, wie Toyin Falola am Beispiel seines Heimatlandes Nigeria erklärt.
O-Ton Toyin Falola:
It is not useful to find jobs. (…) You find the same argument in other places. Arguments that humanities in general, English, literature art history, history, they’re a waste of time in the sense that if you get degrees in them, there are no jobs waiting for you. And the second argument, specific to Nigeria is that they fought a civil war and they thought that talking about that civil war may create problems for the country.
Overvoice:
Man findet eben keinen Job damit. Das Argument gibt es doch immer wieder: Dass die ganzen Geisteswissenschaften, Sprache, Literatur, Kunstgeschichte, Geschichte, dass das alles Zeitverschwendung ist, weil mit so einem Abschluss keine Jobs auf einen warten. Und in Nigeria gibt es noch ein ganz anderes Argument: Dort gab es ja den Bürgerkrieg. Und heute denken viele, wenn man über diesen Krieg reden würde, könnte das große Probleme für unser Land verursachen.
Erzählerin:
Noch dazu verlassen häufig die besten Forscher ihre Heimatländer und gehen ins Ausland - vor allem in die USA.
Erzähler:
Auch Toyin Falola hat zwar in Nigeria studiert, unterrichtet aber schon seit vielen Jahren an der University of Texas in Austin.
O-Ton Toyin Falola:
The brain drain started in the 1980s with the structural adjustment program. African countries owed a lot of money. (…) And then the World Bank and IMF asked them to devalue their currencies. Asked them to cut down the number of university professors. Cost of living was high. And that’s the brain drain – in which you find African engineers, African doctors, African professionals leaving Africa and coming to the west.
Overvoice:
Dieser "Brain Drain" begann in den 1980ern mit dem sogenannten Strukturanpassungsprogramm. Die Afrikanischen Länder hatten viele Schulden. Und dann kamen die Weltbank und der IWF und sagten, sie sollten ihre Währungen entwerten. Uni-Professoren entlassen. Die Lebenshaltungskosten waren hoch. Da begannen afrikanische Ingenieure, Ärzte und andere Akademiker, Afrika zu verlassen und in den Westen zu gehen.
MUSIK
Erzählerin:
Trotz aller Probleme werden immer noch viele spannende Entdeckungen aus der afrikanischen Geschichte zu Tage gefördert. Das ist auch der Archäologie zu verdanken.
Erzähler:
Lange hatten sich europäische und amerikanische Archäologen in Afrika ausschließlich für Ägypten interessiert. Das ändert sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - mit teilweise spektakulären Ergebnissen.
Erzählerin:
Alleine in Nigeria finden Archäologen Artefakte zahlreicher antiker Kulturen. Darunter die faszinierenden Kunstwerke des Volkes der Nok, die schon um 600 vor Christus qualitativ hochwertige Eisengegenstände herstellten.
Erzähler:
Und auf dem Gebiet des heutigen Sudan studieren Forscher sogar die Überreste von drei aufeinanderfolgenden Hochkulturen: Kerma, Kusch und Meroe, jeweils benannt nach den Hauptstädten der antiken Staaten. Die späteste dieser Kulturen, das Königreich von Meroe, existierte rund um Christi Geburt. Die Meroiten erbauten nicht nur beeindruckende Tempel und Grabstätten, sondern hatten auch eine eigene Schrift und weitreichende Handelskontakte bis ins antike Europa.
Erzählerin:
Kurz gesagt: Was die Archäologen in vielen Regionen des Kontinents zu Tage fördern, lässt sich nun wirklich überhaupt nicht in Einklang bringen mit dem Bild des wilden und geschichtslosen Afrika, das so lange unsere Vorstellung dominiert hat. Und auch die europäische und US-amerikanische Afrikanistik forscht mittlerweile an so vielen unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Fragestellungen zur Geschichte Afrikas, dass schon eine bloße Aufzählung den Rahmen dieser Sendung sprengen würde.
MUSIK
Erzähler:
Bleibt die Frage: Warum haben sich diese Erkenntnisse zwar in der Wissenschaft langsam durchgesetzt, aber nicht in einer breiteren Öffentlichkeit? Warum spielen die Meroiten oder Nok noch keine Rolle in unserem Geschichtsunterricht? Warum gibt es in unseren Fernsehprogrammen zwar zahllose Dokumentarfilme über die europäische Geschichte, aber aus Afrika fast immer nur Tier-Dokus oder Kriegsberichterstattung?
Erzählerin:
Auch der nigerianische Historiker Toyin Falola stellt fest, dass sich die alten Afrika-Bilder erstaunlich hartnäckig halten, egal was die Historiker herausfinden.
O-Ton Toyin Falola:
It has to be exotic, National Geographic, Massai, Wildlife. And then it has to be erotic. About sex. Many of these stereotypes relate to issues about backward people. Issues about a continent that doesn’t contribute to civilization. Issues about poverty and lack of dignity, issues about in popular imagination, that the place is a jungle and that it is all about violence, war, disease, those are the major stereotypes, that you find expressed in the media. Especially in a place like the US. (…) In other words, it’s the bad, bad, bad things that shape the media imagination of Africa.
Overvoice:
Es muss immer exotisch sein, so National Geographic-mäßig. Die Massai! Wilde Tiere! Und dann muss es noch erotisch sein. Es muss um Sex gehen. Diese Stereotype zeigen Afrikaner immer als rückständig. Ein ganzer Kontinent, der nichts zur Zivilisation beiträgt, arm und würdelos. Viele Menschen stellen sich ja vor, dass in Afrika überall Dschungel ist, dass es überall Gewalt gibt, Krieg, Seuchen. Das sind so die gängigen Vorurteile in den Medien. Vor allem in den Vereinigten Staaten. Kurz gesagt: Es ist immer das ganz, ganz, ganz Schlimme, das die mediale Vorstellung von Afrika prägt.
Erzähler:
Aber warum? Warum fällt es uns scheinbar so schwer, zu akzeptieren, dass Afrika weder ein exotischer Abenteuerspielplatz ist, noch ein Kontinent der ausschließlichen und permanenten Katastrophen?
Erzählerin:
Vielleicht müssen wir für eine Antwort wieder zum Anfang der Geschichte zurückkehren, also zu Schiller und zu seiner Antrittsvorlesung.
MUSIK
Erzähler:
Wir erinnern uns: Schiller hat ja überhaupt keine Ahnung von der Geschichte oder auch nur der Gegenwart der von ihm als "Wilde" bezeichneten Völker. Er benutzt sie nur als Gegenbeispiel. Als Kontrast, um daran zu zeigen, wie weit die europäische Zivilisation schon gekommen ist.
Erzählerin:
Vielleicht brauchen wir noch immer Afrika als Kontrast. Um uns besser zu fühlen, sicherer, fortschrittlicher.
Erzähler:
Und vielleicht ist dieses Bild auch immer noch - wie zur Kolonialzeit - nicht ganz unpraktisch. Zur Rechtfertigung westlicher Machtpolitik und ganz handfester wirtschaftlicher Interessen.
 View all episodes
View all episodes


 By ARD
By ARD




4.7
3131 ratings

Afrika. Der schwarze Kontinent. Dunkel, gefährlich, primitiv. So hat das Europa lange dargestellt. Erst nach der Kolonialzeit hat sich eine andere Geschichtsschreibung herausgebildet - von Afrikanern selbst, nicht nur über sie. Von Klaus Uhrig (BR 2016)
Credits
Autor: Klaus Uhrig
Regie: Sabine Kienhöfer
Es sprachen: Katja Amberger, Stefan Wilkening, Friedrich Schloffer, Heinz Peter
Technik: Monika Gsaenger
Redaktion: Gerda Kuhn & Nicole Ruchlak
Im Interview: Prof. Dr. Toyin Falola, Prof. Dr. Andreas Eckert
Besonderer Linktipp der Redaktion:
SR: Fragen an den Autor
Die traditionsreichste Sachbuchsendung im deutschen Sprachraum stellt seit über 50 Jahren jeweils ein Buch eines Autors eine Stunde lang im Gespräch vor – und das mittlerweile auch als Podcast. Die Themen reichen von Politik und Wirtschaft bis zu Gesundheit, Erziehung oder Psychologie. Dabei kann auch das Publikum Fragen an die Autorinnen und Autoren stellen. ZUM PODCAST
Linktipps:
Deutschlandfunk (2024): Afrika im Aufbruch – Koloniales überwinden, sich selbst bestimmen
Die Geschichte Afrikas reicht Jahrmillionen zurück. Kulturschaffende wie Designerinnen und Musiker wollen heute auf dieser reichen Vergangenheit aufbauen, den Kolonialismus überwinden und selbst bestimmen, was Afrika ist. JETZT ANHÖREN
ZDF (2023): Afrika von oben - Menschen
In Afrika existieren viele unterschiedliche Volksgruppen. Ihre Art zu leben unterscheidet sich stark – von sehr ursprünglich als Jäger und Sammler bis hypermodern. JETZT ANSEHEN
Und hier noch ein paar besondere Tipps für Geschichts-Interessierte:
Im Podcast „TATORT GESCHICHTE“ sprechen die Historiker Niklas Fischer und Hannes Liebrandt über bekannte und weniger bekannte Verbrechen aus der Geschichte. True Crime – und was hat das eigentlich mit uns heute zu tun?
DAS KALENDERBLATT erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum - skurril, anrührend, witzig und oft überraschend.
Und noch viel mehr Geschichtsthemen, aber auch Features zu anderen Wissensbereichen wie Literatur und Musik, Philosophie, Ethik, Religionen, Psychologie, Wirtschaft, Gesellschaft, Forschung, Natur und Umwelt gibt es bei RADIOWISSEN.
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Alles Geschichte finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Alles Geschichte
JETZT ENTDECKEN
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
Erzähler:
Das große Missverständnis zwischen Afrika und der Geschichtswissenschaft zeigt sich bereits ganz am Anfang.
Erzählerin:
Also ganz am Anfang der Geschichtswissenschaft.
MUSIK
Erzähler:
Am 26. Mai 1789 hält ein gewisser Friedrich Schiller seine Antrittsvorlesung an der Universität von Jena - mit dem Titel: "Was ist und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte?"
Erzählerin:
Der Saal ist völlig überfüllt. Schiller ist zu diesem Zeitpunkt längst als Schriftsteller berühmt. Außerdem ist das Fach neu. So neu, dass der Historiker Schiller offiziell eine Professur für Philosophie bekommt - denn Lehrstühle für Geschichte gibt es noch nicht. Die Geschichtswissenschaft beginnt gerade erst, sich als akademische Disziplin herauszubilden.
Erzähler:
Schillers Antrittsvorlesung findet ein begeistertes Publikum. Dass sie so lebendig wirkt, liegt auch an einem rhetorischen Kniff: Schiller zählt nicht nur die Errungenschaften der abendländischen Geschichte auf, sondern er kontrastiert sie immer wieder mit einem anschaulichen Gegenbeispiel: Die nach seinem Wissen völlig unzivilisierten Weltgegenden außerhalb Europas. Südamerika. Der Südpazifik. Afrika.
Zitator (Schiller):
„Was erzählen uns die Reisebeschreiber nun von diesen Wilden? Manche fanden sie ohne Bekanntschaft mit den unentbehrlichsten Künsten, ohne das Eisen, ohne den Pflug, einige sogar ohne den Besitz des Feuers. Manche rangen noch mit wilden Thieren um Speise und Wohnung, bei vielen hatte sich die Sprache noch kaum von thierischen Tönen zu verständlichen Zeichen erhoben.“
Erzählerin:
Schiller ist kein Rassist. Das muss man dazu sagen. Er hat nur - wie fast alle Europäer - wenig Ahnung von der Welt außerhalb Europas.
Erzähler:
Er weiß zum Beispiel nicht, dass zu diesem Zeitpunkt mitten in diesem Afrika das zweitgrößte Bauwerk der Menschheitsgeschichte steht: Die Mauern von Benin im heutigen Nigeria. Eine mächtige Festungsanlage, die weltweit nur von der Chinesischen Mauer übertroffen wird.
Erzählerin:
Er weiß auch nichts von den Staaten an den großen Seen: Den Königreichen Bunyoro und Buganda und Ruanda, ihren komplexen Kulturen und ausgefeilten staatlichen Strukturen.
Erzähler:
Und dass es in Afrika - und zwar nicht nur in Ägypten - antike Hochkulturen gab, die bereits 2.000 Jahre vor seiner Zeit große Leistungen vollbrachten - auch das ist Schiller völlig unbekannt.
Erzählerin:
Seine Idee von "Universalgeschichte" ist eine Geschichte des Abendlandes. Dass irgendwelche Afrikaner dazu irgendetwas beizutragen haben könnten, ist offenbar selbst für einen der klügsten Köpfe des späten 18. Jahrhunderts kaum vorstellbar.
Erzähler:
Das ändert sich auch im 19. Jahrhundert nicht. Beispiel Hegel: Der berühmte Philosoph formuliert 1837 einen Gedanken über Afrika, der sich in den nächsten eineinhalb Jahrhunderten großer Beliebtheit erfreuen wird: Afrika, der Kontinent ohne Geschichte.
MUSIK
Zitator (Hegel):
„Jenes (...) Afrika ist, so weit die Geschichte zurückgeht, für den Zusammenhang mit der übrigen Welt verschlossen geblieben; es ist das in sich gedrungene Goldland, das Kinderland, das jenseits des Tages der selbstbewußten Geschichte in die schwarze Farbe der Nacht gehüllt ist.“
O-Ton Andreas Eckert:
Die Vorstellung, Afrikaner könnten irgendwas entwickeln oder zur Menschheitsgeschichte Entscheidendes beitragen, das erschien den meisten Zeitgenossen einfach absurd oder unmöglich.
Erzählerin:
Andreas Eckert, Professor für Afrikanische Geschichte an der Humboldt-Universität Berlin.
O-Ton Andreas Eckert:
Sicherlich gab es auch nicht so furchtbar viele Quellen. Aber der Hauptgrund ist glaub ich doch ein zutiefst rassistisches Denken. Und für ihn war Afrika etwas Unbekanntes, etwas Anderes, das er vor allem mit dem Sklavenhandel und der Sklaverei verband, und damit auch sehr stark ein zeitgenössisches Bild transportierte, das Afrika auch als Opfer auch des Sklavenhandels zeigte, aber eben als irgendwie erbärmlichen Kontinent, wo eigentlich nichts passiert.
MUSIK
Erzähler:
Natürlich ist so ein Afrikabild für die europäische Öffentlichkeit auch durchaus praktisch. Denn im 19. Jahrhundert liefern sich die Europäer einen kolonialen Wettlauf um Afrika. Briten, Franzosen und Portugiesen annektieren große Gebiete. Der belgische König sichert sich den Kongo als Privatkolonie. Und gegen Ende des Jahrhunderts tauchen auch noch die Deutschen auf und besetzen die paar Landstriche, die noch übrig sind.
Erzählerin:
Und wenn das so arme Primitive sind, dort in Afrika, geschichts- und kulturlos, dann ist es natürlich völlig in Ordnung, sich ihre Länder einzuverleiben.
Erzähler:
Und die verquere Logik des Kolonialismus geht sogar noch einen Schritt weiter.
Erzählerin:
Es ist nicht nur natürlich, es ist sogar die verdammte Pflicht eines zivilisierten Europäers. Die Bürde des weißen Mannes.
Erzähler:
Das Bild vom geschichtslosen Kontinent hält sich noch lange - und das, obwohl mit den Kolonialherren auch die ersten europäischen Wissenschaftler nach Afrika kommen. Darunter auch ein paar Historiker.
Erzählerin:
Das Interesse an afrikanischer Geschichte ist allerdings immer noch überschaubar. Aus mehreren Gründen. Zum einen traut man den Afrikanern nicht zu, allzu viel Geschichte zu haben. Zum anderen versteht man die afrikanischen Sprachen noch zu wenig – und Schriftzeugnisse gibt es kaum.
Erzähler:
Das hält die Historiker und Sprachforscher aber nicht davon ab, wilde Theorien über die Geschichte Afrikas aufzustellen.
Erzählerin:
Eine der bizarrsten und mit Sicherheit die von den Auswirkungen her tragischste dieser Theorien ist die sogenannte Hamitentheorie.
Erzähler:
Sie hat ihren Ursprung in den Überlegungen des englischen Forschungsreisenden John Hanning Speke. Speke hatte bereits Anfang des 19. Jahrhunderts eine Expedition angeführt, die sich auf die Suche nach den Quellen des Nils machte. Dabei drang er bis ins Gebiet des heutigen Uganda und Ruanda vor.
Erzählerin:
Dort traf er - für ihn überraschend - auf äußerst komplexe Gesellschafts-Strukturen, die er sich nur dadurch erklären kann, dass dort unterschiedliche Stämme nacheinander eingewandert seien. Für ihn und seine Nachfolger war dadurch klar: Die Geschichte Afrikas musste eine Geschichte von Wanderungsbewegungen sein.
O-Ton Andreas Eckert:
Das war allerdings oft sehr rassistisch geprägt und immer mit der Idee verbunden, bestimmte Entwicklungen in der Geschichte Afrikas könne man eigentlich nur erklären über den Einfluss von Nicht-Afrikanern, von Gruppen, die nach Afrika eingewandert sind, hellhäutige Gruppen. „Hamiten“ wurden die oft genannt und es gibt eine sogenannte Hamitentheorie, die im Grunde besagt, dass alles, was in Afrika an Entwicklung vor der Kolonialzeit geschah, von diesen Völkern von außen initiiert worden ist.
Erzähler:
Der Begriff „Hamiten“ geht auf die biblische Geschichte des Ham zurück. Ham, ein Sohn des Noah, wird darin von seinem Vater verflucht. Wobei sich der Fluch nicht direkt auf ihn bezieht, sondern auf seine Nachkommen.
Erzählerin:
Schon früh wurde diese Geschichte von Juden, Moslems, und Christen auch rassistisch interpretiert: Der Makel des Fluches sei sichtbar geworden durch die dunkle Hautfarbe der Nachkommen Hams.
Erzähler:
In der modernen Interpretation wurden die Hamiten dann zu einer eigenen Rasse erklärt. Hamiten seien zwar dunkelhäutig, aber bei genauerem Hinsehen nicht ganz so schwarz, wie andere Schwarze. Außerdem seien sie intelligenter und kriegerischer und hätten so, aus dem Nahen Osten kommend, viele "minderwertige" Völker unterworfen.
Erzählerin:
Ein Beispiel: Ruanda. Die Gesellschaft in Ruanda gliedert sich traditionell in zwei Gruppen: Hutu und Tutsi. Die Hutu waren früher großteils Bauern und stellten die große Masse der Bevölkerung. Die Tutsi dagegen waren großteils Viehhirten und bildeten die schmalere Oberschicht der ruandischen Kultur.
MUSIK
Erzähler:
Die Vertreter der Hamitentheorie interpretieren diese Gesellschaftsstruktur so: Die Hutu seien die ursprüngliche Bevölkerung Ruandas, und vergleichsweise primitiv. Die kriegerischen und klugen, weil angeblich „hamitischen“ Tutsi seien irgendwann von Norden her eingewandert, hätten die Hutu-Bauern unterworfen und bildeten nun die "natürliche Oberschicht" des Landes. Jahrzehntelang ist diese Theorie wissenschaftlicher Konsens. Und das, obwohl sie schon im Falle Ruandas voller Widersprüche ist. So kann sie kaum erklären, wieso die angeblich völlig unterschiedlichen Völker der Hutu und Tutsi die gleiche Sprache sprechen, die gleichen Götter anbeten, überhaupt: Teil derselben Kultur sind. Andreas Eckert:
O-Ton Andreas Eckert:
Die Hamitentheorie ist wissenschaftlich völliger Humbug. Sie ist aber natürlich wirkungsmächtig gewesen, weil sie auch in ein bestimmtes Bild hineinpasst. Und weil es eben durchaus sehr bekannten Wissenschaftlern der Zeit gleichsam gelungen ist, diese Theorie wissenschaftlich scheinbar zu belegen. Mit bestimmten sprachgeschichtlichen Zeugnissen, die dann vermeintlich Hinweise auf bestimmte Wanderungen geben und so weiter und so fort. Sie hat eben den Zeitgeist relativ gut widergespiegelt und schien gewissermaßen rassistische Annahmen auch wissenschaftlich zu belegen. Das klärt ein Stück weit ihren großen Erfolg bis weit in das 20. Jahrhundert hinein.
Erzähler:
Im Falle Ruandas entwickelt die Hamitentheorie dann schließlich ein gespenstisches Eigenleben. Die Belgier übernehmen 1918 Ruanda von den Deutschen und errichten ein äußerst rassistisches Kolonialregime. Dabei bedienen sie sich der traditionellen Tutsi-Eliten, denen sie mit der Hamitentheorie eine Rechtfertigung für ihre Höherstellung in der ruandischen Gesellschaft liefern.
Erzählerin:
Gemeinsam schreiben Tutsi und Belgier eine neue Geschichte des Landes, in der Tutsi zu einer überlegenen Eroberer-Rasse stilisiert werden, die sich ganz „natürlich“ die Herrschaft über die Hutu erkämpft hat.
Erzähler:
Später wird genau diese Geschichtserzählung den Tutsi zum Verhängnis. Nach der Unabhängigkeit kommt in Ruanda die Hutu-Mehrheit an die Macht. Die neuen Hutu-Eliten übernehmen die rassistische Geschichtsschreibung – deuten sie aber in ihrem Sinne um. Denn wenn die Tutsi tatsächlich irgendwann später nach Ruanda eingewandert waren – sind sie dann nicht eigentlich Invasoren? Fremde, die gar nicht nach Ruanda gehören, und die man genauso gut wieder vertreiben könnte?
Erzählerin:
Jahrzehntelang kocht die Hutu-Rassenideologie vor sich hin, immer wieder gibt es Pogrome an den Tutsi, dann einen Aufstand von Tutsi-Rebellen. Schließlich bildet sich Anfang der 90er Jahre eine radikale Hutu-Bewegung, die ganz offen über die Ausrottung der zu „fremden Einwanderern“ erklärten Tutsi nachdenkt.
O-Ton Andreas Eckert:
Ruanda ist ohne Zweifel das radikalste und traurigste Beispiel, dass eine solche Theorie dann eben nicht nur von Europäern, sondern auch von afrikanischen Eliten blutig gleichsam in die Praxis getragen wurde.
Erzähler:
Was dann passiert im Frühjahr 1994 ist bekannt: Der Genozid an den Tutsi. Eine Million Tote.
MUSIK
Erzählerin:
Natürlich gibt für den Genozid zahlreiche weitere Gründe: wirtschaftliche, machtpolitische. Aber als Begründung für den größten Massenmord der afrikanischen Geschichte wird immer wieder die angebliche „Fremdrassigkeit“ der Tutsi angeführt.
Erzähler:
Nicht überall wird die koloniale Geschichtsschreibung so wenig hinterfragt, wie in Ruanda. Im Gegenteil.
Erzählerin:
Als in den späten 1950er und frühen 60er Jahren die meisten afrikanischen Staaten unabhängig werden, ist das Interesse an der eigenen Geschichte groß. Für den bekannten nigerianischen Historiker Toyin Falola ein beispielloser Aufbruch.
O-Ton Toyin Falola:
Very big interest. Because we want to know our past. We want to use the information on this past to build development. We are interested in making history relevant to contemporary education and were also interested in connecting history to nation building.
Overvoice:
Das Interesse an Geschichte war riesig. Wir wollten unsere Vergangenheit erforschen. Und wir wollten dieses Wissen nutzen, um uns weiter zu entwickeln. Wir wollten, dass die Geschichte eine wichtige Rolle in unserem Bildungssystem spielt. Und natürlich ging es auch um die Rolle der Geschichte für den Aufbau unserer Nation.
Erzähler:
In vielen afrikanischen Staaten entwickelt sich eine eigene Geschichtswissenschaft. Von den Europäern übernimmt man wissenschaftliche Methoden – ohne sich allerdings die europäischen Geschichtsdeutungen zu eigen zu machen.
Erzählerin:
Mündliche Erzählungen werden von einigen dieser Historiker erstmals als gleichwertige Quellen akzeptiert. Und die alten Quellen, die Reiseberichte und Kolonialgeschichtsbücher, werden sozusagen gegen den Strich gelesen. Also analysiert und hinterfragt. Toyin Falola:
O-Ton Toyin Falola:
There was a generation before me that was interested in what we call Nationalist Historiography. The idea of Nationalist Historiography is to argue that Africans in the past were able to create great civilizations, like Egypt, Mali Empire or Ghana Empire. They wanted to argue that Africans have been able to manage their continent and to create leadership that could manage.
Overvoice:
Das war eine Generation vor mir. Da gab es großes Interesse an dem, was man "Nationalist Historiography" nannte. Die Idee dahinter ist, zu argumentieren, dass Afrikaner in der Vergangenheit große Zivilisationen geschaffen haben. Ägypten, Mali, das Reich von Ghana. Die Forscher wollten zeigen, dass Afrikaner durchaus in der Lage waren, ihren Kontinent zu verwalten und eigene Führungsschichten hervorzubringen.
Erzähler:
Die Vertreter dieser “nationalistischen Geschichtsschreibung” konzentrieren sich stark auf die positiven Errungenschaften afrikanischer Völker. Viele von ihnen betätigen sich nebenbei auch als Schriftsteller oder Politiker.
Erzählerin:
Zahlreiche europäische Geschichtsdeutungen werden auf einmal von afrikanischen Wissenschaftlern völlig auf den Kopf gestellt. Und nicht nur das: Auch in Europa und den USA beginnt in den 50er und 60er Jahren ein Umdenken – weg vom Rassismus, hin zu einer neuen, weniger vorurteilsbelasteten Art der Geschichtsschreibung.
Erzähler:
Einer der bekanntesten und zugleich umstrittensten afrikanischen Historiker dieser Zeit ist der Senegalese Cheikh Anta Diop.
O-Ton Andreas Eckert:
Der hat betont, dass das alte Ägypten viele Impulse gesetzt hat, die nachher die Griechen gleichsam geklaut und als ihre eigenen ausgegeben haben. Also dass die Wiege der Zivilisation eigentlich in Ägypten und damit in Afrika spielt. Um das ganze Argument noch zu verstärken hat er behauptet, dass eben ein Großteil des alten Ägyptens von einer schwarzen Bevölkerung bevölkert war, und das ist natürlich etwas, was sich wissenschaftlich als kaum haltbar erweist, zeigt aber noch mal sehr deutlich diesen Versuch jetzt, in besonders radikaler Weise auch die Geschichte gleichsam zu politisieren und für die Gegenwart relevant zu machen, indem man eben sagt, wir haben eine glorreiche Geschichte, und an diese Geschichte müssen wir jetzt nach dem Joch der Kolonialzeit wieder anknüpfen.
Erzählerin:
Bei Cheikh Anta Diop lassen sich Geschichtswissenschaft und politischer Aktivismus kaum trennen. Drei Parteien gründet er im Laufe seines Lebens - von denen allerdings nie eine die Regierung stellt. Seine Schriften sind leidenschaftliche Manifeste gegen die europäische Geschichtsdeutung.
Erzähler:
Heute ist zwar die Universität der senegalesischen Hauptstadt Dakar nach Diop benannt. Doch seine radikalen Interpretationen teilen nur noch wenige afrikanische Forscher.
MUSIK
Erzählerin:
Auf den großen Aufbruch der 60er Jahre folgt in den meisten afrikanischen Ländern die große Ernüchterung. In einigen Staaten brechen schon kurz nach der Unabhängigkeit blutige Bürgerkriege aus - im Kongo zum Beispiel, etwas später auch in Nigeria. Dazu kommt: Die allgegenwärtige Korruption.
Erzähler:
Die weißen Kolonisatoren sind weg - doch die neuen, einheimischen Eliten beuten ihre Bevölkerung weiter aus. Viele der jüngeren Intellektuellen, darunter auch Historiker, werden zu den schärfsten Kritikern ihrer eigenen Staaten.
O-Ton Toyin Falola:
In my own generation we began to look for new ideas. Especially Marxism. We’re looking for socialist ideas to transform the continent. Because of the disappointment with the performance of the states. So in the 70s and 80s you find academics of the left trying to write radical history and use that radical history to make an argument regarding the failure of the postcolonial state. I was part of that movement.
Overvoice:
Meine Generation begann dann, sich neuen Ideen zuzuwenden. Vor allem dem Marxismus. Wir wollten mit sozialistischen Idealen unseren Kontinent verändern - Weil wir so enttäuscht waren von den postkolonialen Staaten. Also gab es in den 70ern und 80ern viele linke Akademiker, die anders an die Geschichtsschreibung herangegangen sind. Radikal. Politisch. Um auf das Scheitern der Postkolonialen Staaten hinzuweisen. Auch ich habe zu dieser Bewegung gehört.
Erzählerin:
Trotz aller Versuche, die Geschichtswissenschaft in Afrika neu zu etablieren, ist ihr Einfluss in den letzten Jahrzehnten eher zurückgegangen. Viele afrikanische Staaten haben ihren Universitäten die Gelder gekürzt.
Erzähler:
Und gerade die Geisteswissenschaften haben in vielen Ländern einen schweren Stand, wie Toyin Falola am Beispiel seines Heimatlandes Nigeria erklärt.
O-Ton Toyin Falola:
It is not useful to find jobs. (…) You find the same argument in other places. Arguments that humanities in general, English, literature art history, history, they’re a waste of time in the sense that if you get degrees in them, there are no jobs waiting for you. And the second argument, specific to Nigeria is that they fought a civil war and they thought that talking about that civil war may create problems for the country.
Overvoice:
Man findet eben keinen Job damit. Das Argument gibt es doch immer wieder: Dass die ganzen Geisteswissenschaften, Sprache, Literatur, Kunstgeschichte, Geschichte, dass das alles Zeitverschwendung ist, weil mit so einem Abschluss keine Jobs auf einen warten. Und in Nigeria gibt es noch ein ganz anderes Argument: Dort gab es ja den Bürgerkrieg. Und heute denken viele, wenn man über diesen Krieg reden würde, könnte das große Probleme für unser Land verursachen.
Erzählerin:
Noch dazu verlassen häufig die besten Forscher ihre Heimatländer und gehen ins Ausland - vor allem in die USA.
Erzähler:
Auch Toyin Falola hat zwar in Nigeria studiert, unterrichtet aber schon seit vielen Jahren an der University of Texas in Austin.
O-Ton Toyin Falola:
The brain drain started in the 1980s with the structural adjustment program. African countries owed a lot of money. (…) And then the World Bank and IMF asked them to devalue their currencies. Asked them to cut down the number of university professors. Cost of living was high. And that’s the brain drain – in which you find African engineers, African doctors, African professionals leaving Africa and coming to the west.
Overvoice:
Dieser "Brain Drain" begann in den 1980ern mit dem sogenannten Strukturanpassungsprogramm. Die Afrikanischen Länder hatten viele Schulden. Und dann kamen die Weltbank und der IWF und sagten, sie sollten ihre Währungen entwerten. Uni-Professoren entlassen. Die Lebenshaltungskosten waren hoch. Da begannen afrikanische Ingenieure, Ärzte und andere Akademiker, Afrika zu verlassen und in den Westen zu gehen.
MUSIK
Erzählerin:
Trotz aller Probleme werden immer noch viele spannende Entdeckungen aus der afrikanischen Geschichte zu Tage gefördert. Das ist auch der Archäologie zu verdanken.
Erzähler:
Lange hatten sich europäische und amerikanische Archäologen in Afrika ausschließlich für Ägypten interessiert. Das ändert sich in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts - mit teilweise spektakulären Ergebnissen.
Erzählerin:
Alleine in Nigeria finden Archäologen Artefakte zahlreicher antiker Kulturen. Darunter die faszinierenden Kunstwerke des Volkes der Nok, die schon um 600 vor Christus qualitativ hochwertige Eisengegenstände herstellten.
Erzähler:
Und auf dem Gebiet des heutigen Sudan studieren Forscher sogar die Überreste von drei aufeinanderfolgenden Hochkulturen: Kerma, Kusch und Meroe, jeweils benannt nach den Hauptstädten der antiken Staaten. Die späteste dieser Kulturen, das Königreich von Meroe, existierte rund um Christi Geburt. Die Meroiten erbauten nicht nur beeindruckende Tempel und Grabstätten, sondern hatten auch eine eigene Schrift und weitreichende Handelskontakte bis ins antike Europa.
Erzählerin:
Kurz gesagt: Was die Archäologen in vielen Regionen des Kontinents zu Tage fördern, lässt sich nun wirklich überhaupt nicht in Einklang bringen mit dem Bild des wilden und geschichtslosen Afrika, das so lange unsere Vorstellung dominiert hat. Und auch die europäische und US-amerikanische Afrikanistik forscht mittlerweile an so vielen unterschiedlichen Kulturen, Epochen und Fragestellungen zur Geschichte Afrikas, dass schon eine bloße Aufzählung den Rahmen dieser Sendung sprengen würde.
MUSIK
Erzähler:
Bleibt die Frage: Warum haben sich diese Erkenntnisse zwar in der Wissenschaft langsam durchgesetzt, aber nicht in einer breiteren Öffentlichkeit? Warum spielen die Meroiten oder Nok noch keine Rolle in unserem Geschichtsunterricht? Warum gibt es in unseren Fernsehprogrammen zwar zahllose Dokumentarfilme über die europäische Geschichte, aber aus Afrika fast immer nur Tier-Dokus oder Kriegsberichterstattung?
Erzählerin:
Auch der nigerianische Historiker Toyin Falola stellt fest, dass sich die alten Afrika-Bilder erstaunlich hartnäckig halten, egal was die Historiker herausfinden.
O-Ton Toyin Falola:
It has to be exotic, National Geographic, Massai, Wildlife. And then it has to be erotic. About sex. Many of these stereotypes relate to issues about backward people. Issues about a continent that doesn’t contribute to civilization. Issues about poverty and lack of dignity, issues about in popular imagination, that the place is a jungle and that it is all about violence, war, disease, those are the major stereotypes, that you find expressed in the media. Especially in a place like the US. (…) In other words, it’s the bad, bad, bad things that shape the media imagination of Africa.
Overvoice:
Es muss immer exotisch sein, so National Geographic-mäßig. Die Massai! Wilde Tiere! Und dann muss es noch erotisch sein. Es muss um Sex gehen. Diese Stereotype zeigen Afrikaner immer als rückständig. Ein ganzer Kontinent, der nichts zur Zivilisation beiträgt, arm und würdelos. Viele Menschen stellen sich ja vor, dass in Afrika überall Dschungel ist, dass es überall Gewalt gibt, Krieg, Seuchen. Das sind so die gängigen Vorurteile in den Medien. Vor allem in den Vereinigten Staaten. Kurz gesagt: Es ist immer das ganz, ganz, ganz Schlimme, das die mediale Vorstellung von Afrika prägt.
Erzähler:
Aber warum? Warum fällt es uns scheinbar so schwer, zu akzeptieren, dass Afrika weder ein exotischer Abenteuerspielplatz ist, noch ein Kontinent der ausschließlichen und permanenten Katastrophen?
Erzählerin:
Vielleicht müssen wir für eine Antwort wieder zum Anfang der Geschichte zurückkehren, also zu Schiller und zu seiner Antrittsvorlesung.
MUSIK
Erzähler:
Wir erinnern uns: Schiller hat ja überhaupt keine Ahnung von der Geschichte oder auch nur der Gegenwart der von ihm als "Wilde" bezeichneten Völker. Er benutzt sie nur als Gegenbeispiel. Als Kontrast, um daran zu zeigen, wie weit die europäische Zivilisation schon gekommen ist.
Erzählerin:
Vielleicht brauchen wir noch immer Afrika als Kontrast. Um uns besser zu fühlen, sicherer, fortschrittlicher.
Erzähler:
Und vielleicht ist dieses Bild auch immer noch - wie zur Kolonialzeit - nicht ganz unpraktisch. Zur Rechtfertigung westlicher Machtpolitik und ganz handfester wirtschaftlicher Interessen.

117 Listeners

8 Listeners

19 Listeners

73 Listeners

0 Listeners

0 Listeners

122 Listeners

7 Listeners

1 Listeners

9 Listeners

4 Listeners

189 Listeners

110 Listeners

38 Listeners

1 Listeners

24 Listeners

33 Listeners

6 Listeners

43 Listeners

64 Listeners

16 Listeners

30 Listeners
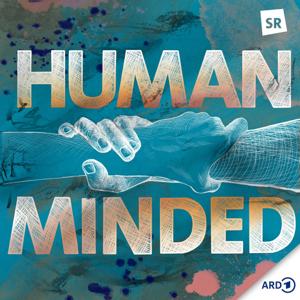
0 Listeners

36 Listeners

5 Listeners

4 Listeners

21 Listeners
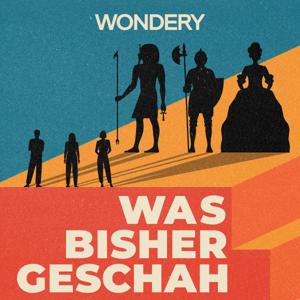
22 Listeners

9 Listeners

0 Listeners

0 Listeners
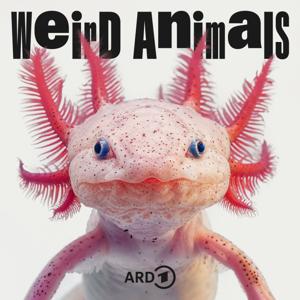
1 Listeners