
Sign up to save your podcasts
Or


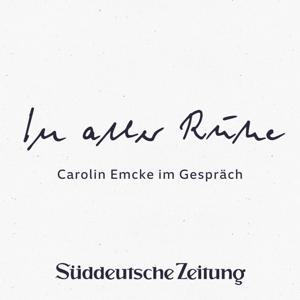

Die Demokratisierung der Bundesrepublik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird häufig verklärt. Gerade die Unterdrückungserfahrungen von Minderheiten werden im Rückblick ausgeblendet. Darüber spricht Carolin Emcke im Podcast mit der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Sie erzählt, wie auch lange nach dem Ende des Krieges Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus bestanden haben.
Ein Hinweis: Ab der nächsten Folge hören Sie diesen Podcast nur noch mit einem SZ Plus-Abo. Sollten Sie noch kein SZ Plus-Abo haben, so finden Sie unter sz.de/ruheplus ein exklusives Probeabo zum Testen und Weiterhören. Mit einem Abo unterstützen Sie die Arbeit der SZ-Redaktion und damit den unabhängigen Journalismus.
Stefanie Schüler-Springorum, geboren 1962 in Hamburg, leitet seit 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Zuvor hat sie das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg geleitet. In ihrem neuesten Buch „Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes“ schildert die Historikerin die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft aus Sicht der Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden.
„Man muss demokratisch stabil bleiben.“
Diskussionen über Opfer- und Täterschaft seien zu lange verkürzt geführt worden, betont die Historikerin. Im Gespräch mit Carolin Emcke legt Schüler-Springorum die Gründe dafür dar. Unter anderem nennt sie ein „deutsches Überlegenheitsgefühl“, das die Gesellschaft auch nach dem Ende des Nationalsozialismus und im Übergang zur Demokratie zusammengehalten habe.
Schließlich geht es im Podcast noch darum, wie die Erinnerung an die vergangene Geschichte auch nach vielen Jahren noch aufrecht gehalten werden kann. Schüler-Springorum beklagt, dass vielen Menschen heute das Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Geschichte fehle. Gleichzeitig plädiert sie bei dem Thema für mehr Gelassenheit. Auch ohne intensive Geschichtsstudien sei es möglich, „demokratisch stabil“ zu bleiben. „Man muss einfach hoffen, dass genug Spuren gelegt sind, auf die man sich beziehen kann.“
Empfehlung von Stefanie Schüler-Springorum
Moderation, Redaktion: Carolin Emcke
 View all episodes
View all episodes


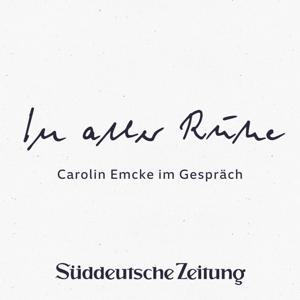 By Süddeutsche Zeitung & Carolin Emcke
By Süddeutsche Zeitung & Carolin Emcke




5
33 ratings

Die Demokratisierung der Bundesrepublik nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs wird häufig verklärt. Gerade die Unterdrückungserfahrungen von Minderheiten werden im Rückblick ausgeblendet. Darüber spricht Carolin Emcke im Podcast mit der Historikerin Stefanie Schüler-Springorum. Sie erzählt, wie auch lange nach dem Ende des Krieges Kontinuitäten aus der Zeit des Nationalsozialismus bestanden haben.
Ein Hinweis: Ab der nächsten Folge hören Sie diesen Podcast nur noch mit einem SZ Plus-Abo. Sollten Sie noch kein SZ Plus-Abo haben, so finden Sie unter sz.de/ruheplus ein exklusives Probeabo zum Testen und Weiterhören. Mit einem Abo unterstützen Sie die Arbeit der SZ-Redaktion und damit den unabhängigen Journalismus.
Stefanie Schüler-Springorum, geboren 1962 in Hamburg, leitet seit 2011 das Zentrum für Antisemitismusforschung an der Technischen Universität Berlin. Zuvor hat sie das Institut für die Geschichte der deutschen Juden in Hamburg geleitet. In ihrem neuesten Buch „Unerwünscht. Die westdeutsche Demokratie und die Verfolgten des NS-Regimes“ schildert die Historikerin die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft aus Sicht der Menschen, die im Nationalsozialismus verfolgt wurden.
„Man muss demokratisch stabil bleiben.“
Diskussionen über Opfer- und Täterschaft seien zu lange verkürzt geführt worden, betont die Historikerin. Im Gespräch mit Carolin Emcke legt Schüler-Springorum die Gründe dafür dar. Unter anderem nennt sie ein „deutsches Überlegenheitsgefühl“, das die Gesellschaft auch nach dem Ende des Nationalsozialismus und im Übergang zur Demokratie zusammengehalten habe.
Schließlich geht es im Podcast noch darum, wie die Erinnerung an die vergangene Geschichte auch nach vielen Jahren noch aufrecht gehalten werden kann. Schüler-Springorum beklagt, dass vielen Menschen heute das Interesse an einer Auseinandersetzung mit der Geschichte fehle. Gleichzeitig plädiert sie bei dem Thema für mehr Gelassenheit. Auch ohne intensive Geschichtsstudien sei es möglich, „demokratisch stabil“ zu bleiben. „Man muss einfach hoffen, dass genug Spuren gelegt sind, auf die man sich beziehen kann.“
Empfehlung von Stefanie Schüler-Springorum
Moderation, Redaktion: Carolin Emcke

216 Listeners
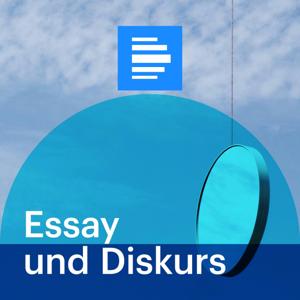
20 Listeners

12 Listeners

41 Listeners

48 Listeners

23 Listeners

10 Listeners

65 Listeners

1 Listeners

98 Listeners

63 Listeners

27 Listeners

26 Listeners

9 Listeners

5 Listeners

7 Listeners
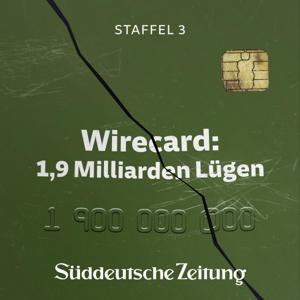
3 Listeners

37 Listeners

4 Listeners

0 Listeners