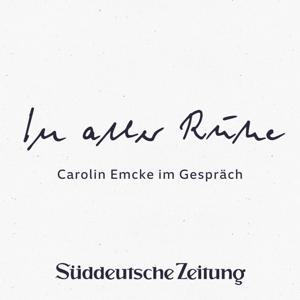Spätestens seit dem Ausbruch der Coronapandemie ist klar, dass die Wissenschaft ein Glaubwürdigkeitsproblem hat. Zumindest in einigen Teilen der Bevölkerung. Forscherinnen und Forschern wurde lautstark vorgeworfen, eine politische Agenda zu verfolgen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die etwa für Impfungen oder Masken warben, wurden diffamiert und bedroht. Und der wissenschaftliche Prozess – das langsame Annähern an die Wahrheit, mitunter auch im Streit – galt plötzlich als unseriös.
Was können Forscherinnen und Forscher diesem Misstrauen entgegensetzen? Das fragt Carolin Emcke in dieser Folge des Podcasts den Präsidenten der Max-Planck-Gesellschaft, Patrick Cramer. Außerdem geht es im Gespräch um die Vorteile von internationaler Forschungszusammenarbeit – und die damit verbundenen Risiken.
Cramer, geboren 1969 in Stuttgart, ist Chemiker und Molekularbiologe. Er erhielt für seine Forschungsarbeiten zur Transkription von Genen eine Vielzahl renommierter Auszeichnungen. Er war geschäftsführender Direktor am Max-Planck-Institut für multidisziplinäre Naturwissenschaften. Seit 2023 bestimmt er als Präsident der Max-Planck-Gesellschaft die Leitlinien der Institution.
Risiken abwägen und Grenzen klar definieren
Im Gespräch mit Carolin Emcke erzählt Patrick Cramer, wie er selbst angefeindet und bedroht wurde, nachdem er sich in Pandemiezeiten öffentlich zum Coronavirus geäußert hatte. "Dass es polarisiert wird, dass die Sprache schnell rau wird, dass beleidigt wird", beobachte der Molekularbiologe inzwischen auch bei anderen Themen, insbesondere bei Diskussionen in den sozialen Medien. Im Podcast erläutert Cramer, wie er als Forscher damit umgeht – und welche Ursachen er für diese Entwicklungen sieht.
Anschließend geht es um die Frage, wie internationale Forschungsarbeit garantiert werden kann, wenn autoritäre Regime weltweit an Einfluss gewinnen. Cramer betont, dass es immer auch möglich sein müsse, für wissenschaftliche Projekte mit Ländern wie etwa China zu kooperieren. Für ihn ist die Autonomie der Forschung das höchste Gut. Zugleich, betont der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, müssten vor jeder Zusammenarbeit aber Risiken abgewägt und – falls nötig – rote Linien gezogen werden. "Man muss den kulturellen Hintergrund sehen, die politische Entwicklung, die geopolitische Position", plädiert Cramer für die Einzelfallbetrachtung. Dafür habe die Max-Planck-Gesellschaft eine entsprechende Handhabe entwickelt, die er im Gespräch mit Carolin Emcke vorstellt.
Dialog zwischen Forschung und Politik verbessern
Abschließend betont Cramer die Bedeutung von Diversität in der Forschung. Es brauche unterschiedliche Perspektiven, um originelle Einfälle zu ermöglichen. Deshalb fordert der Präsident der Max-Planck-Gesellschaft mit Hinblick auf die derzeitige Migrationsdebatte, dass die Bundesregierung weiterhin die Zuwanderung von Fach- und Führungskräften fördert. "Wenn wir die Willkommenskultur nicht mehr haben, wenn wir den roten Teppich nicht mehr ausrollen können", sagt er, "werden wir nicht mehr die Top-Talente der Welt anziehen, so wie wir es jetzt tun."
Ebenso plädiert Cramer dafür, dass Politik die Expertise der Wissenschaft stärker in Entscheidungsprozesse einbezieht. Er fordert die Einrichtung eines wissenschaftlichen Chefberaters im Kabinett, so wie es ihn bereits in anderen Länder gebe – etwa in Großbritannien, Kanada und den USA. "Alles, was wir brauchen, um Innovation zu generieren, um die Gesellschaft auf die Zukunft vorzubereiten, könnte man dort bündeln." So könne nicht nur das Wissenschaftsministerium gestärkt werden, sondern auch die Politik stärker mit Fachexpertise aus der Forschung versorgt werden.
Empfehlung von Patrick Cramer
Patrick Cramer empfiehlt "Ravenous: Otto Warburg, the Nazis and the Search for the Cancer-Diet Connection", erschienen bei der Liveright Publishing Corporation.
Liveright Publishing Corporation
Weil geopolitische Konflikte auf der Welt auch die Wissenschaft beeinflussen, empfiehlt Patrick Cramer ein Buch, dass diesen Zusammenhang abbildet: „Otto Warburg, the Nazis, and the Search for the Cancer-Diet Connection“ von Sam Apple. Warburg war einer der ersten Forscher, der eine Verbindung zwischen Krebs, Ernährung und Stoffwechsel hergestellt hat, außerdem der einzige deutsche Forscher mit jüdischer Herkunft, der auf Weisung Adolf Hitlers bis zum Ende der Naziherrschaft Direktor der Kaiser-Wilhelm-Gesellschaft bleiben durfte, dem Vorgänger der Max-Planck-Gesellschaft. Warburgs Forschung hat die Krebsforschung weltweit vorangebracht. Doch zur Zeit des Nationalsozialismus verlor deutsche Forschung im Ausland an Einfluss. Sam Apple zeigt in seiner Biografie, welche Auswirkungen dies auf die Krebsforschung hatte.
Moderation, Redaktion: Carolin Emcke
Redaktionelle Betreuung: Ann-Marlen Hoolt
Produktion: Imanuel Pedersen
Bildrechte Cover: Christoph Mukherjee/Max-Planck-Gesellschaft/Bearbeitung SZ