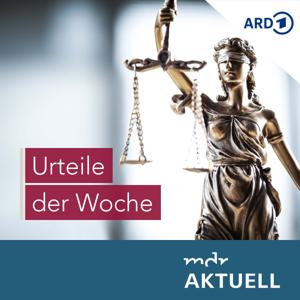Gut oder böse? Schwarz oder weiß? Oder gibt es etwas dazwischen? "Ambiguitätstoleranz", die Fähigkeit zum Aushalten von Graubereichen und Mehrdeutigkeit, wird von Psychologen heute für ein wichtiges Persönlichkeitsmerkmal gehalten, um das Leben in einer komplizierten, krisenhaften Welt zu ertragen. Entdeckt wurde dieser Wesenszug von Else Frenkel-Brunswick. Else Frenkel war sechs Jahre alt, als ihre jüdische Familie nach antisemitischen Pogromen in Lwiw (in der heutigen Ukraine) ihre Heimat verließ und nach Wien flüchtete. Nach dem Abitur begann die begabte junge Frau zunächst Mathematik- und Physik zu studieren, wechselte aber bald zur Psychologie. Else widmete sich der Biografieforschung und befasste sich intensiv mit der Entwicklung von Jugendlichen. Nebenher absolvierte eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin. 1938 musste sie erneut alles aufgeben. Nach dem Anschluss Österreichs an das Nationalsozialistische Deutschland floh sie in die USA. Dort heiratete sie noch im selben Jahr ihren Freund und Kollegen Egon Brunswik. Die Forscherin wandte sich in den 1940er Jahren der Antisemitismus- und Vorurteilsforschung zu und war maßgeblich an den Studien zur autoritären Persönlichkeit von Theodor W. Adorno, Nevitt Sanford und Daniel J. Levinson beteiligt. Ihr Anteil jedoch blieb über viele Jahre hinweg unerwähnt. Auch eine Professur hat sie trotz zahlreicher Ehrungen nie bekommen. Heute erinnert das 2020 gegründete Else-Frenkel-Brunswik-Institut für Demokratieforschung in Leipzig an die Wissenschaftlerin. Eine Vertriebene und Getriebene, die auch an den Zeitläuften zerbrach. Else Frenkel-Brunswik nahm sich 1958 das Leben, drei Jahre nach dem Suizid ihres Mannes.





 View all episodes
View all episodes


 By SR
By SR