
Sign up to save your podcasts
Or




Ein Schuh ist nicht einfach ein Schuh. Die anfängliche Schutzfunktion, zu der man sich Gras und Rinde um die Füße wickelte, wurde mit raffinierteren Aufgaben aufgeladen. Schuh erzählt von Politik und Macht, von Wahn, Obsession und Erotik - er verlangt präzises Handwerk und ist skulpturales Bauwerk für den Fuß. Von Barbara Knopf
Credits
Autorin dieser Folge: Barbara Knopf
Regie: Christiane Klenz
Es sprachen: Katja Bürkle, Friedrich Schloffer
Technik: Adele Messmer
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview:
Isabella Belting, Kunsthistorikerin
Albert Bertl Kreca – „Schuh-Bertl“
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir:
ALLES GESCHICHTE - HISTORY VON RADIOWISSEN
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Frauen ins Rampenlicht! Der Instagramkanal frauen_geschichte versorgt Sie regelmäßig mit spannenden Posts über Frauen, die Geschichte schrieben. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks. EXTERNER LINK | INSTAGRAMKANAL frauen_geschichte
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZSP
Der Schnabelschuh stammt jetzt aus dem Mittelalter, 12., 13. Jahrhundert. Der hat sich übrigens sehr lange tatsächlich gehalten, immer wieder in verschiedenen Formen. Damals war noch nicht der Absatz das Dominante, sondern wirklich die Schuhspitze. Und die hat sich dann in einer Art verlängert, die irgendwann natürlich nicht mehr von alleine stand, sondern ans Knie gebunden werden musste, damit der Herr überhaupt mit diesen Schuhen laufen kann. Man hat es ernst genommen, weil es eben ein Symbol war für jemanden, der nicht arbeiten muss. 0.32
Erzählerin
So erzählt es die Kunsthistorikerin Isabella Belting. Sie leitet die Sammlung Mode/Textilien im – derzeit geschlossenen – Münchner Stadtmuseum. These boots are made for walking? Ein sehr funktional gedachter Satz.
MUSIK 2 ( Diamonds (Bridgerton - Season Two) 1’05)
In Wirklichkeit betreten wir mit dem Schuh sofort symbolisches Terrain. Es geht um Status. Ansehen. Macht. Reichtum. Spiel. Erotik. Und um Wahn. Ein irrationaler Faktor lauert in diesen Objekten am unteren Ende des Körpers. All diese Schnallen und Schleifchen, das noppenhäutige Krokodilleder, die pergamentene Schlangenhaut, der Samt, die Seide, der Lack, die hauchdünnen Riemchen über all den Aussparungen für die Haut, das nackte Fleisch, an Ferse, Fessel, Zehen oder anderen Wölbungen des Fußes, geformt wie ein Dekolleté. Eine Spiegelung des Körpers eigentlich, ein Abbild en miniature.
2 ZSP:
Gerade bei den Damen im Barock und Rokoko fing es dann an, dass der Absatz in dieser ganz besonders eleganten, geschwungenen Form modern wurde. Das war dann eben auch ein Absatz, der in der Mitte schmal wird und nach unten ein bisschen breiter wird. Man kann sich fast vorstellen, dass das wie so ein kleiner Körper ist, der in der Korsage steckt. Man kann sagen, dass der Fuß, der in diesen Schuh schlüpft, wie der Körper ist, der in ein Kleid schlüpft. Also der Absatz hat damit auch ein sehr erotisches Aussehen bekommen.
MUSIK 3 ( Eloise & Theo („Bridgerton“ – Season Two)
Erzählerin
Der Schuh ist eine Skulptur, an deren Ausformungen seit Jahrtausenden gefeilt wird. Gesellschaftliche Vorstellungen lassen sich darin ablesen, Konstrukte von Schönheit, auch quälerische wie im Märchen, wo die bösen Stiefschwestern des armen Aschenputtels sich Ferse und Zehen abhieben, um in den anmutig kleinen Pantoffel zu passen und den Prinzen zu bekommen. Form Follows Gewohnheiten. Den wechselnden Bedürfnissen einer Gesellschaft. So hatten Ritter, Reiter, in Sänften Getragene oder Fußgänger höchst unterschiedliche Schuhbedürfnisse. Für die Gegenwart müsste man hinzufügen: auch Radler, Bergsteiger, Sportler oder Astronauten. Eine Rückwirkung auf die Form unserer Füße blieb da nicht aus, schrieb der Architekt und Gesellschaftskritiker Adolf Loos aus Wien in seinen satirischen Essays Ornament & Verbrechen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts – der noch nichts wissen konnte von der modernen Schuhindustrie und ihren mannigfaltigen Produkten:
ZITAT:
„Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Und so tun es auch unsere Füße. Bald werden sie klein, bald groß, bald spitz, bald breit. Und der Schuster macht nun bald große, bald kleine, bald spitze, bald breite Schuhe. Das geht allerdings nicht so einfach. Von Saison zu Saison wechseln unsere Fußformen nicht. Dazu braucht es Jahrhunderte oder zum Mindesten eines Menschenalters. (…) Aber der Schuster muß sich streng an die jeweilige Fußform halten. Will er kleine Schuhe einführen, so muss er geduldig warten, bis das großfüßige Geschlecht abgestorben ist.“ (Ornament und Verbrechen, Metro Verlag, Seite 29)
MUSIK 4 ( Jane Monheit: A Shine On Your Shoes 0’10)
Erzählerin
Genau das ist der Zwiespalt: Geht es nach der konkreten Anlage des Fußes? Oder nach einer abstrakten Idee? So, wie erst ein linker und ein rechter Schuh ein Paar ergeben – und ein Fuß trotzdem nie dem anderen gleicht, so liegt in den Schuhen selbst eine Ambivalenz: Sind sie doch einerseits phantastische Schöpfungen -andererseits bodenständiges Handwerk. Selten beides gleichzeitig.
ATMO Schleifen
3 ZSP
Da mache ich jetzt gerade einen Schuh, der asymmetrisch ist, also fußkonform ist. Das ist eigentlich auch eine alte Technik. Und die meisten Schuhe sind heute nicht mehr fußkomform. Also die schaden eigentlich dem Fuß.
MUSIK 5 ( G.Rag y Los Hermanos Patchekos: Ein Mann sieht Sand 0’40)
Erzählerin
Besuch beim „Schuh-Bertl“ in München. Der Schuh Bertl hat eine gewisse Prominenz, weil er dem bayerischen Papst Benedikt seine roten Schuhe angefertigt hat. Auch der britische König bekam, als er noch Prinz Charles war, bayerische Haferlschuhe geschenkt aus Bertls Werkstatt, in der der Himmel voller Leisten hängt.
ATMO Schleifen
Erzählerin
Wenn man mit Albert Bertl Kreca, dem Schuster und Schuhmacher in der schwarzen Cordhose spricht, inmitten der alten Hämmer, Zangen, den Ambossen und Nähmaschinen, einem Chaos, in dem sich der große Mann schlafwandlerisch bewegt, bekommt man eine Vorstellung von der Sorgfalt und der Handwerkskunst, mit der aus einem Stück Leder und einer Sohle ein schöner, haltbarer Schuh entsteht, an einer Nähmaschine, angetrieben von Hand und Fuß:
ATMO Nähmaschine
4 ZSP
Ich mache Schuhe seit 40 Jahren. Meine Spezialität sind genähte Schuhe, also ich mache rahmen- und zwiegenähte Schuhe. Ein zwiegenähter Schuh, sagt ja der Name schon, ist zweifach genäht. Ein rahmengenähter ist eigentlich auch zweifach genäht, aber du siehst nur eine Naht, also die Naht hier. Ein guter Schuh ist für mich, so ist auch meine Philosophie, ein Schuh, der so regional wie möglich gebaut wird. Langlebig ist, reparabel ist. Das ist ein guter Schuh, der gut passt. Und immer noch aus Leder. Ganz klassisch. Aber reparabel sein muss.
MUSIK 6 ( Achim Zweschper: Walking Tension 0’55)
Erzählerin
Wie wird nun ein Schuh draus? Am Anfang, vor Zehntausenden von Jahren, in der späten Steinzeit, wickelte man sich Gras, Schnur oder Fell um die Füße, zum Schutz. Lange gingen die meisten barfuß, der Schuh war ein Luxusobjekt. Die Sandale gilt als die älteste erhaltene Schuhform, ihre Blütezeit lag in der griechischen Antike, aber mit der dünnen flachen Sohle und einem einfachen Riemen hat sich dieses Urmodell bis heute als Flip-Flop erhalten. Der reine Schutz wurde schnell zum Schmuck und die Fußbekleidung wechselte ihr Aussehen entsprechend nach den jeweiligen kulturellen Einflüssen der Ägypter, Assyrer, Phönizier, Perser oder Hebräer. Mal bog man die Sohle vorne hoch zum Schutz der Zehen, mal schnürte man sich Riemen die Wade entlang, mal bestickte man die neuen Schlupfschuhe, die Pantoffeln, mit denen sich in der westlichen Wahrnehmung der Reiz des Orientalismus verband. Halbschuhe boten Halt. Stiefel kamen in Mode, Postillonstiefel, Stulpenstiefel und natürlich Reiterstiefel. An ihnen lässt sich gut zeigen, wie sich in einer offenbar schon früh vernetzten Welt kulturelle Erfindungen und Einflüsse kreuzten und wie sie weiterentwickelt wurden. Als Reiter in Persien in ihren Steigbügeln Halt suchten, wurde eine Form entwickelt, um nicht abzurutschen: eine Art Absatz. Und der fand bald reißenden Absatz am französischen Hofe, erklärt Isabella Belting:
5 ZSP
Im Rokoko ist es so, und davor im Barock, dass tatsächlich der Absatz aufkommt, der die Männer erhöhen soll über die andere Gesellschaft. Dieser Absatz hat bei Männern ein gewisses Stolzieren bewirkt. Und so hat sich das dann langsam auch in die Mode entwickelt, dass der Herr bei Hofe – und die Herrscher – gerne Absätze getragen haben. Und wenn es der Herrscher direkt war, dann eben auch mit rotem Absatz. Rot war immer ein Zeichen sozusagen der ganz oberen Hierarchie und der Monarchie.
Erzählerin
Nach der Französischen Revolution war die Farbe Rot mit dem Blut der Guillotinen verknüpft, und die Epoche der hohen Schuhe für Männer, Herrscher wie Bürger, war ein für alle Mal passé. Bis heute eigentlich. Mal abgesehen von einigen Dragqueens oder auch experimentierfreudigen Männern. Und jenen die lieber versteckte Absätze im Innenschuh tragen, um größer zu wirken. Aber wie das immer so ist in der Mode und eben auch bei der Fußbekleidung: nichts verliert sich ganz. Auch das Rot ist wieder aufgetaucht. Als signalrote Schuhsohle in den Kreationen von Christian Louboutin. Sie kommunizieren: Ich bin erotisch, begehrenswert und teuer. Ein absolutes Statussymbol. Der Schnabel ist sozusagen auf die Sohle gewandert.
MUSIK 7 (Lady Gaga: Yoü And I (You And I) 0‘15
MUSIK 8 (Sign Of The Times (stripped)(„Bridgerton“ – Season Two) 1’10)
Erzählerin
Zeig mir Deinen Schuh, und ich sag Dir, wer Du bist, was Du zählst und was Du tust, ob Du Bauer bist oder Arbeiter, Handwerker, Patrizier oder Adeliger. Selbst auf der Bühne steckte jeder Rollentypus im eigenen Schuhtyp: Der Komödiant trug den sogenannten Soccus, der tatsächlich aussah wie eine heruntergerollte Socke, während der Tragödiendarsteller seine Verse auf hohen Kothurnen deklamierte. Heute lautet die Devise: Anything goes -und man wundert sich, was alles geht. Die britische Designerin Vivienne Westwood kreierte so mörderisch hohe Plateauschuhe, dass das Supermodel Naomi Campbell auf dem Catwalk herabstürzte. Und Lady Gaga, die auf ebensolchen Plateauhufen auftrat, aber ohne hinteren Absatz, die Ferse also nicht abgestützt, musste über Wadenmuskeln verfügen wie ein bayerischer Schuhplattler. Letztlich aber sind auch diese Plateau-Gebilde nur eine Variation bereits vergangener „Extrem“mode wie sie im Venedig des 16. Jahrhunderts aufkam, erläutert die Kunsthistorikerin Isabella Belting:
6 ZSP
Es gibt die Chopinen oder Zoccoli aus Venedig. Man sieht, dass der Absatz also wirklich schon eine Höhe hat. Bei diesem Modell etwa 30 Zentimeter. Diese Absätze waren oft aus Holz oder Kork und dann mit Leder praktisch umkleidet und auch schön geschmückt und bedruckt und bestickt, je nachdem. Und oben schlüpfte man einfach nur ganz oben in so eine Art Lasche wie in einem Pantoffel. Die Damen in Venedig, allen voran die Kurtisanen, sind mit denen durch Venedig stolziert. Natürlich am Arm einer Zofe, weil alleine konnte man damit nicht laufen. Man ist aufgefallen; man hat natürlich auch durch die Höhe von dem Absatz sich ein bisschen von dem Straßenschmutz geschützt…Nachttöpfe, Pferdedreck, aller Schmutz landete auf der Straße. Es hat sich eine ganze Weile erhalten, weil es eben auch ein Machtsymbol war, sich über die anderen zu erheben.
Erzählerin
Immer neue Kaprizen, Entwürfe, Zumutungen, Kunstwerke. Designer meißeln millimetergenau an ein paar Quadratzentimeter Raum. Andere schaffen für den Fuß ein Bett. Skulpteure die einen, Handwerker die anderen.
MUSIK 9 ( G.Rag y Los Hermanos Patchekos: Jazz di Monaco 0‘15)
In jedem handwerklich gearbeiteten Schuh steckt ein Universum des Wissens. Der Schuh Bertl hat vier Bücher geschriebenen, das über Haferlschuhe gilt als Standardwerk. Und er zieht alte Bücher zu Rate, 2000 hat er gesammelt:
9 ZSP (endet mit Atmo/ Blättern zum Drübergehen, hinten spielen mit dieser sehr kurzen Atmo, er ist noch mal zu hören): Original 1763, so wie das das Original von1604 ist oder diese Bücher fünfzehnhundertnochwas . Da ist die Enzyklopodie von Diderot, das ist Band C, Cordonnier… also Schuster im Französischen heißt Cordonnier.
BLÄTTERN noch mal kurz Wort
Erzählerin
Die Enzyklopädie des französischen Universalgelehrten Denis Diderot, der auch dem Schuster, dem Cordonnier, eine Seite darin gewidmet hat. Der Bertl schlägt sie auf. Originalausgabe, 18. Jahrhundert, schwerer Ledereinband, goldgeprägtes Muster, altes Papier. Eine Zukunft sieht Albert Bertl Kreca nicht für seinen Beruf:
10 ZSP
Ich glaube das Handwerk, das Schusterhandwerk wird aussterben. Es wird immer noch ein paar Schuster geben, so Edelschuster. Wenn du im Internet schaust, da gibt es einige, dann kosten auch die Schuhe 3,5,4.000 Euro. Die versuchen, Fuß zu fassen und Business zu machen. Aber allgemein, der Schuster wird aus unserem Stadtbild verschwinden.
MUSIK 10 ( Andreas Suttner: Walking 1 0’35)
Erzählerin
In den Händen eines Schusters offenbart ein Schuh nicht nur seine Stabilität oder Schönheit, sondern auch seine Fragilität. Die Lederzunge kann ihm arg beansprucht raushängen. Abgetreten und ramponiert ist er. Löchrig vielleicht. Die Ösen für die Bänder zerrissen, die Riemchen baumelnd. Das Leben hat ihm mitgespielt. Ob sein Lebenszyklus noch mal verlängert wird, hängt von der pflegenden Liebe seines Besitzers und vom Material ab.
Apropos Material: Verlagert in Billiglohnländer in Asien, unter Missachtung von Arbeitsschutz und Umweltbelastungen, kommen in der globalen Schuhherstellung immer wieder hochgiftige Chemikalien zum Einsatz – zum Beispiel beim Gerben von Leder. Arbeiter, häufig auch Kinder, sind diesen in schuhproduzierenden Ländern wie Indien oft ohne Schutz ausgesetzt. Nachhaltige Produktion in Europa oder gar der Region hilft da nur zum Teil. Pflanzlich gegerbtes Leder und Materialien wie Naturkautschuk, Fasern von Bananen, Kaktus oder Ananas, können die Schwemme von Billigprodukten nicht ausgleichen.
MUSIK 11 ( Nancy Sinatra: These Boots Are Made For Walking 0’20)
MUSIK 12 (Son Lux: Switch Shoes To The Wrong Fell 1’00)
Erzählerin
Das ist die ökologische Seite des Themas. Und dann gibt es noch die psychologischen Deutungen. Schuhe entfesseln Phantasien, kokettieren mit Schlüsselreizen, in vielen Schattierungen, vom Puderquasten-Pantöffelchen der 1950er Jahre bis zu den Schnürungen und Latexinszenierungen und auf die Spitze getriebenen Requisiten der Fetischszene. Ein Spiel um sexuelle Dominanz oder Unterwerfung. Manche Menschen erregen sich am Geruch getragener Damenschuhe. Der Übergang vom Fetisch zum modischen Accessoire ist fließend. Modedesigner frönen ihm, Künstler setzen ihn visuell in Szene. Helmut Newtons „Nudes“, die nackten Frauen in High Heels, Rudolf Schlichters Frauenakte in hochgeknöpften Stiefeln. Der Maler der Neuen Sachlichkeit soll seine Frau und Muse „Stiefelchen“ genannt haben.
Was für eine Freiheit, Schuhe zu tragen, wie man will! Männer, Frauen, ob hetero oder queer, cis, nonbinär oder trans, können hochhackige Highheels tragen oder Sandalen, deren Fußbett aussieht wie ein trockengelegtes Schlammflussbett. Und in beiden sexy aussehen. Oder eben nicht. Ganz nach Belieben. An der Absatzhöhe und dem Klackklack der Stilettos muss sich jedenfalls kein Emanzipationsstreit mehr entzünden. Und kollektive Zwänge bleiben hoffentlich historisch.
MUSIK 13 ( Michi Koerner: Glassy Drop 0’15)
12 ZSP
Also für uns jetzt aus westlichem Blick findet man das natürlich ganz schrecklich, so einen winzigen kleinen Schuh in der Hand zu haben, wie wir hier sehen, der nicht mal die Länge einer Handfläche hat – und da passte der Fuß rein, er passte natürlich nicht rein, weil auch der Fuß von Chinesinnen von Natur aus nicht so klein war, das ist natürlich ein völlig verkrüppelter Fuß. Dass ein Schuh sozusagen eine Art ist, jemanden zu unterwerfen oder zu knechten, sieht man ja dann an diesen doch ja sehr gruseligen Lotus-Schuhen.
MUSIK 14 ( Michi Koerner: Glassy Drop 0’30)
Erzählerin
Isabella Belting hält eine Art Seidentäschchen in der Hand, mit denen die Chinesinnen, denen die Füße gebunden wurden, in kleinen Schritten tippeln konnten. Sie kaschierten eine brutale Methode, die bis ins 20. Jahrhundert hinein noch praktiziert wurde: Das Binden der Füße war jahrhundertelang ein Ritual der gehobenen Gesellschaft in China. Eine Demonstration von Wohlstand, eine Frau mit gebundenen Füßen musste nicht arbeiten -sie konnte ja kaum gehen.
13 ZSP
Es ist tatsächlich eine Folter, wenn man sich das durchliest. Die 4 Zehen, wurden gebrochen und nach innen gebunden, und das einzige, das noch als stabiles Glied da war, war nur der große Zeh. Und die wurden extrem gebunden und geschnürt, es muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Aber die Mütter haben es im besten Glauben gemacht, weil sie dachten, ihre Töchter haben dann ein besseres Leben, ein gutes Leben - also ausgewickelt hat man den Fuß nie gezeigt.
Erzählerin
Schuhe sind Lebensbegleiter. Wenn es gut läuft, baut man eine Beziehung zu ihnen auf. Sieht man irgendwo Schuhe, die liegengeblieben sind, ist das eine Irritation, die sofort Gedanken in Gang setzt, wem diese Schuhe wohl gehören mögen und warum sie da alleine stehen. Noch schlimmer, wenn es nur ein einzelner ist.
MUSIK 15 ( Giora Feidman: Main shikhelekh varfoylt – Mkh tsudieygelekh 0’45)
Und geradezu erschütternd ist der Anblick jener Fotodokumente auf denen haufenweise zurückgebliebene Kinderschuhe zu sehen sind. Sie gehörten jüdischen Kindern, die im KZ Auschwitz ermordet wurden. Hier zeigt sich am deutlichsten, dass der Schuh ein Gegenstand ist, der nahezu als ein Teil des Körpers empfunden werden kann.
Die Geschichte einer Gesellschaft lässt sich an ihrer Fußbekleidung erzählen. Soziale Entwicklungen, ästhetische Vorstellungen, Überfluss -oder auch Not, wie manche Exemplare verdeutlichen, die in die Sammlung des Münchner Stadtmuseums gewandert sind, wie Isabella Belting erklärt:
14 ZSP
Dass diese Kriegs- und Nahkriegsschuhe was ganz Besonderes sind, hat man sicher in dem Moment erkannt, wenn man es in der Hand hatte – die jetzt mal erstmal per se materiell kein Wert haben, sondern wirklich aus Resten zusammengestückt und zusammengeflickt wurden. Alte Autoreifen, Nägel, aus Gummi, aus irgendwelchen Pappedeckeln zusammen gehämmert, genäht -und wir sehen den und freuen uns riesig, weil das so ein wahnsinnig interessantes Stück Kulturgeschichte ist und eben so etwas Berührendes hat.
Erzählerin
Der Schuh ist Indikator dynamischer Veränderungen, durch die Jahrhunderte hindurch -und mit ihm unser Fuß, wie der stets zu mokanten Beobachtungen aufgelegte Wiener Architekt Adolf Loos in seinem Buch Ornament und Verbrechen um 1908 herum notiert:
MUSIK 16 ( Mortage Stomp 0’40)
ZITAT
„Aber schon im Laufe dieses Jahrhunderts begann der menschliche Fuß eine Wandlung durchzumachen. Unsere sozialen Verhältnisse haben es mit sich gebracht, dass wir auch von Jahr zu Jahr schneller gehen. (…) So langsam zu schreiten, als sich die Leute in früheren Zeiten fortbewegten, wäre uns heute unmöglich. Dazu sind wir zu nervös. (…) Also gehen wir schneller. Das heißt mit anderen Worten, daß wir uns mit der großen Zehe immer stärker vom Erdboden abstoßen. Und tatsächlich wird unsere große Zehe immer kräftiger und stärker. (…) Durch eigene Kraft vorwärts kommen heißt die Parole für das nächste Jahrhundert.“
Ornament und Verbrechen, Metro Verlag, Seite 31 ff)
Erzählerin
Adolf Loos konnte nicht ahnen, dass gut 100 Jahre nach seinen Betrachtungen die Verkörperung eines einzigen Schuhs zum Vollstrecker unserer Lebensweise geworden ist: bequem, schnell und allzeit mobil voranzukommen.
MUSIK 17 ( Dr. Der: Still D.R.E. 0’55)
Der Turnschuh, der Sneaker, hat sich in alle Bereiche hineingeschlichen. Wird zu jedem Style getragen. Jederzeit. Überall. Von allen. Der Sneaker ist Wegwerfware, Kultobjekt, Sammlerfetisch. In den Luxusboutiquen nahe der Piazza San Marco in Venedig wird er auf Säulchen und Sockeln inszeniert wie Diamantware oder die finale Goldreserve. Ein Schuh, der nicht mehr Handwerk ist und nicht mehr architektonische Skulptur. Mögen Soziologen der nahen und ferneren Zukunft herausfinden, welche Essenz unserer Zeit darin fußt.
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.5
8080 ratings

Ein Schuh ist nicht einfach ein Schuh. Die anfängliche Schutzfunktion, zu der man sich Gras und Rinde um die Füße wickelte, wurde mit raffinierteren Aufgaben aufgeladen. Schuh erzählt von Politik und Macht, von Wahn, Obsession und Erotik - er verlangt präzises Handwerk und ist skulpturales Bauwerk für den Fuß. Von Barbara Knopf
Credits
Autorin dieser Folge: Barbara Knopf
Regie: Christiane Klenz
Es sprachen: Katja Bürkle, Friedrich Schloffer
Technik: Adele Messmer
Redaktion: Nicole Ruchlak
Im Interview:
Isabella Belting, Kunsthistorikerin
Albert Bertl Kreca – „Schuh-Bertl“
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Noch mehr Interesse an Geschichte? Dann empfehlen wir:
ALLES GESCHICHTE - HISTORY VON RADIOWISSEN
Skurril, anrührend, witzig und oft überraschend. Das Kalenderblatt erzählt geschichtliche Anekdoten zum Tagesdatum. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks.
DAS KALENDERBLATT
Frauen ins Rampenlicht! Der Instagramkanal frauen_geschichte versorgt Sie regelmäßig mit spannenden Posts über Frauen, die Geschichte schrieben. Ein Angebot des Bayerischer Rundfunks. EXTERNER LINK | INSTAGRAMKANAL frauen_geschichte
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
Radiowissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | Radiowissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ZSP
Der Schnabelschuh stammt jetzt aus dem Mittelalter, 12., 13. Jahrhundert. Der hat sich übrigens sehr lange tatsächlich gehalten, immer wieder in verschiedenen Formen. Damals war noch nicht der Absatz das Dominante, sondern wirklich die Schuhspitze. Und die hat sich dann in einer Art verlängert, die irgendwann natürlich nicht mehr von alleine stand, sondern ans Knie gebunden werden musste, damit der Herr überhaupt mit diesen Schuhen laufen kann. Man hat es ernst genommen, weil es eben ein Symbol war für jemanden, der nicht arbeiten muss. 0.32
Erzählerin
So erzählt es die Kunsthistorikerin Isabella Belting. Sie leitet die Sammlung Mode/Textilien im – derzeit geschlossenen – Münchner Stadtmuseum. These boots are made for walking? Ein sehr funktional gedachter Satz.
MUSIK 2 ( Diamonds (Bridgerton - Season Two) 1’05)
In Wirklichkeit betreten wir mit dem Schuh sofort symbolisches Terrain. Es geht um Status. Ansehen. Macht. Reichtum. Spiel. Erotik. Und um Wahn. Ein irrationaler Faktor lauert in diesen Objekten am unteren Ende des Körpers. All diese Schnallen und Schleifchen, das noppenhäutige Krokodilleder, die pergamentene Schlangenhaut, der Samt, die Seide, der Lack, die hauchdünnen Riemchen über all den Aussparungen für die Haut, das nackte Fleisch, an Ferse, Fessel, Zehen oder anderen Wölbungen des Fußes, geformt wie ein Dekolleté. Eine Spiegelung des Körpers eigentlich, ein Abbild en miniature.
2 ZSP:
Gerade bei den Damen im Barock und Rokoko fing es dann an, dass der Absatz in dieser ganz besonders eleganten, geschwungenen Form modern wurde. Das war dann eben auch ein Absatz, der in der Mitte schmal wird und nach unten ein bisschen breiter wird. Man kann sich fast vorstellen, dass das wie so ein kleiner Körper ist, der in der Korsage steckt. Man kann sagen, dass der Fuß, der in diesen Schuh schlüpft, wie der Körper ist, der in ein Kleid schlüpft. Also der Absatz hat damit auch ein sehr erotisches Aussehen bekommen.
MUSIK 3 ( Eloise & Theo („Bridgerton“ – Season Two)
Erzählerin
Der Schuh ist eine Skulptur, an deren Ausformungen seit Jahrtausenden gefeilt wird. Gesellschaftliche Vorstellungen lassen sich darin ablesen, Konstrukte von Schönheit, auch quälerische wie im Märchen, wo die bösen Stiefschwestern des armen Aschenputtels sich Ferse und Zehen abhieben, um in den anmutig kleinen Pantoffel zu passen und den Prinzen zu bekommen. Form Follows Gewohnheiten. Den wechselnden Bedürfnissen einer Gesellschaft. So hatten Ritter, Reiter, in Sänften Getragene oder Fußgänger höchst unterschiedliche Schuhbedürfnisse. Für die Gegenwart müsste man hinzufügen: auch Radler, Bergsteiger, Sportler oder Astronauten. Eine Rückwirkung auf die Form unserer Füße blieb da nicht aus, schrieb der Architekt und Gesellschaftskritiker Adolf Loos aus Wien in seinen satirischen Essays Ornament & Verbrechen, zu Beginn des 20. Jahrhunderts – der noch nichts wissen konnte von der modernen Schuhindustrie und ihren mannigfaltigen Produkten:
ZITAT:
„Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns in ihnen. Und so tun es auch unsere Füße. Bald werden sie klein, bald groß, bald spitz, bald breit. Und der Schuster macht nun bald große, bald kleine, bald spitze, bald breite Schuhe. Das geht allerdings nicht so einfach. Von Saison zu Saison wechseln unsere Fußformen nicht. Dazu braucht es Jahrhunderte oder zum Mindesten eines Menschenalters. (…) Aber der Schuster muß sich streng an die jeweilige Fußform halten. Will er kleine Schuhe einführen, so muss er geduldig warten, bis das großfüßige Geschlecht abgestorben ist.“ (Ornament und Verbrechen, Metro Verlag, Seite 29)
MUSIK 4 ( Jane Monheit: A Shine On Your Shoes 0’10)
Erzählerin
Genau das ist der Zwiespalt: Geht es nach der konkreten Anlage des Fußes? Oder nach einer abstrakten Idee? So, wie erst ein linker und ein rechter Schuh ein Paar ergeben – und ein Fuß trotzdem nie dem anderen gleicht, so liegt in den Schuhen selbst eine Ambivalenz: Sind sie doch einerseits phantastische Schöpfungen -andererseits bodenständiges Handwerk. Selten beides gleichzeitig.
ATMO Schleifen
3 ZSP
Da mache ich jetzt gerade einen Schuh, der asymmetrisch ist, also fußkonform ist. Das ist eigentlich auch eine alte Technik. Und die meisten Schuhe sind heute nicht mehr fußkomform. Also die schaden eigentlich dem Fuß.
MUSIK 5 ( G.Rag y Los Hermanos Patchekos: Ein Mann sieht Sand 0’40)
Erzählerin
Besuch beim „Schuh-Bertl“ in München. Der Schuh Bertl hat eine gewisse Prominenz, weil er dem bayerischen Papst Benedikt seine roten Schuhe angefertigt hat. Auch der britische König bekam, als er noch Prinz Charles war, bayerische Haferlschuhe geschenkt aus Bertls Werkstatt, in der der Himmel voller Leisten hängt.
ATMO Schleifen
Erzählerin
Wenn man mit Albert Bertl Kreca, dem Schuster und Schuhmacher in der schwarzen Cordhose spricht, inmitten der alten Hämmer, Zangen, den Ambossen und Nähmaschinen, einem Chaos, in dem sich der große Mann schlafwandlerisch bewegt, bekommt man eine Vorstellung von der Sorgfalt und der Handwerkskunst, mit der aus einem Stück Leder und einer Sohle ein schöner, haltbarer Schuh entsteht, an einer Nähmaschine, angetrieben von Hand und Fuß:
ATMO Nähmaschine
4 ZSP
Ich mache Schuhe seit 40 Jahren. Meine Spezialität sind genähte Schuhe, also ich mache rahmen- und zwiegenähte Schuhe. Ein zwiegenähter Schuh, sagt ja der Name schon, ist zweifach genäht. Ein rahmengenähter ist eigentlich auch zweifach genäht, aber du siehst nur eine Naht, also die Naht hier. Ein guter Schuh ist für mich, so ist auch meine Philosophie, ein Schuh, der so regional wie möglich gebaut wird. Langlebig ist, reparabel ist. Das ist ein guter Schuh, der gut passt. Und immer noch aus Leder. Ganz klassisch. Aber reparabel sein muss.
MUSIK 6 ( Achim Zweschper: Walking Tension 0’55)
Erzählerin
Wie wird nun ein Schuh draus? Am Anfang, vor Zehntausenden von Jahren, in der späten Steinzeit, wickelte man sich Gras, Schnur oder Fell um die Füße, zum Schutz. Lange gingen die meisten barfuß, der Schuh war ein Luxusobjekt. Die Sandale gilt als die älteste erhaltene Schuhform, ihre Blütezeit lag in der griechischen Antike, aber mit der dünnen flachen Sohle und einem einfachen Riemen hat sich dieses Urmodell bis heute als Flip-Flop erhalten. Der reine Schutz wurde schnell zum Schmuck und die Fußbekleidung wechselte ihr Aussehen entsprechend nach den jeweiligen kulturellen Einflüssen der Ägypter, Assyrer, Phönizier, Perser oder Hebräer. Mal bog man die Sohle vorne hoch zum Schutz der Zehen, mal schnürte man sich Riemen die Wade entlang, mal bestickte man die neuen Schlupfschuhe, die Pantoffeln, mit denen sich in der westlichen Wahrnehmung der Reiz des Orientalismus verband. Halbschuhe boten Halt. Stiefel kamen in Mode, Postillonstiefel, Stulpenstiefel und natürlich Reiterstiefel. An ihnen lässt sich gut zeigen, wie sich in einer offenbar schon früh vernetzten Welt kulturelle Erfindungen und Einflüsse kreuzten und wie sie weiterentwickelt wurden. Als Reiter in Persien in ihren Steigbügeln Halt suchten, wurde eine Form entwickelt, um nicht abzurutschen: eine Art Absatz. Und der fand bald reißenden Absatz am französischen Hofe, erklärt Isabella Belting:
5 ZSP
Im Rokoko ist es so, und davor im Barock, dass tatsächlich der Absatz aufkommt, der die Männer erhöhen soll über die andere Gesellschaft. Dieser Absatz hat bei Männern ein gewisses Stolzieren bewirkt. Und so hat sich das dann langsam auch in die Mode entwickelt, dass der Herr bei Hofe – und die Herrscher – gerne Absätze getragen haben. Und wenn es der Herrscher direkt war, dann eben auch mit rotem Absatz. Rot war immer ein Zeichen sozusagen der ganz oberen Hierarchie und der Monarchie.
Erzählerin
Nach der Französischen Revolution war die Farbe Rot mit dem Blut der Guillotinen verknüpft, und die Epoche der hohen Schuhe für Männer, Herrscher wie Bürger, war ein für alle Mal passé. Bis heute eigentlich. Mal abgesehen von einigen Dragqueens oder auch experimentierfreudigen Männern. Und jenen die lieber versteckte Absätze im Innenschuh tragen, um größer zu wirken. Aber wie das immer so ist in der Mode und eben auch bei der Fußbekleidung: nichts verliert sich ganz. Auch das Rot ist wieder aufgetaucht. Als signalrote Schuhsohle in den Kreationen von Christian Louboutin. Sie kommunizieren: Ich bin erotisch, begehrenswert und teuer. Ein absolutes Statussymbol. Der Schnabel ist sozusagen auf die Sohle gewandert.
MUSIK 7 (Lady Gaga: Yoü And I (You And I) 0‘15
MUSIK 8 (Sign Of The Times (stripped)(„Bridgerton“ – Season Two) 1’10)
Erzählerin
Zeig mir Deinen Schuh, und ich sag Dir, wer Du bist, was Du zählst und was Du tust, ob Du Bauer bist oder Arbeiter, Handwerker, Patrizier oder Adeliger. Selbst auf der Bühne steckte jeder Rollentypus im eigenen Schuhtyp: Der Komödiant trug den sogenannten Soccus, der tatsächlich aussah wie eine heruntergerollte Socke, während der Tragödiendarsteller seine Verse auf hohen Kothurnen deklamierte. Heute lautet die Devise: Anything goes -und man wundert sich, was alles geht. Die britische Designerin Vivienne Westwood kreierte so mörderisch hohe Plateauschuhe, dass das Supermodel Naomi Campbell auf dem Catwalk herabstürzte. Und Lady Gaga, die auf ebensolchen Plateauhufen auftrat, aber ohne hinteren Absatz, die Ferse also nicht abgestützt, musste über Wadenmuskeln verfügen wie ein bayerischer Schuhplattler. Letztlich aber sind auch diese Plateau-Gebilde nur eine Variation bereits vergangener „Extrem“mode wie sie im Venedig des 16. Jahrhunderts aufkam, erläutert die Kunsthistorikerin Isabella Belting:
6 ZSP
Es gibt die Chopinen oder Zoccoli aus Venedig. Man sieht, dass der Absatz also wirklich schon eine Höhe hat. Bei diesem Modell etwa 30 Zentimeter. Diese Absätze waren oft aus Holz oder Kork und dann mit Leder praktisch umkleidet und auch schön geschmückt und bedruckt und bestickt, je nachdem. Und oben schlüpfte man einfach nur ganz oben in so eine Art Lasche wie in einem Pantoffel. Die Damen in Venedig, allen voran die Kurtisanen, sind mit denen durch Venedig stolziert. Natürlich am Arm einer Zofe, weil alleine konnte man damit nicht laufen. Man ist aufgefallen; man hat natürlich auch durch die Höhe von dem Absatz sich ein bisschen von dem Straßenschmutz geschützt…Nachttöpfe, Pferdedreck, aller Schmutz landete auf der Straße. Es hat sich eine ganze Weile erhalten, weil es eben auch ein Machtsymbol war, sich über die anderen zu erheben.
Erzählerin
Immer neue Kaprizen, Entwürfe, Zumutungen, Kunstwerke. Designer meißeln millimetergenau an ein paar Quadratzentimeter Raum. Andere schaffen für den Fuß ein Bett. Skulpteure die einen, Handwerker die anderen.
MUSIK 9 ( G.Rag y Los Hermanos Patchekos: Jazz di Monaco 0‘15)
In jedem handwerklich gearbeiteten Schuh steckt ein Universum des Wissens. Der Schuh Bertl hat vier Bücher geschriebenen, das über Haferlschuhe gilt als Standardwerk. Und er zieht alte Bücher zu Rate, 2000 hat er gesammelt:
9 ZSP (endet mit Atmo/ Blättern zum Drübergehen, hinten spielen mit dieser sehr kurzen Atmo, er ist noch mal zu hören): Original 1763, so wie das das Original von1604 ist oder diese Bücher fünfzehnhundertnochwas . Da ist die Enzyklopodie von Diderot, das ist Band C, Cordonnier… also Schuster im Französischen heißt Cordonnier.
BLÄTTERN noch mal kurz Wort
Erzählerin
Die Enzyklopädie des französischen Universalgelehrten Denis Diderot, der auch dem Schuster, dem Cordonnier, eine Seite darin gewidmet hat. Der Bertl schlägt sie auf. Originalausgabe, 18. Jahrhundert, schwerer Ledereinband, goldgeprägtes Muster, altes Papier. Eine Zukunft sieht Albert Bertl Kreca nicht für seinen Beruf:
10 ZSP
Ich glaube das Handwerk, das Schusterhandwerk wird aussterben. Es wird immer noch ein paar Schuster geben, so Edelschuster. Wenn du im Internet schaust, da gibt es einige, dann kosten auch die Schuhe 3,5,4.000 Euro. Die versuchen, Fuß zu fassen und Business zu machen. Aber allgemein, der Schuster wird aus unserem Stadtbild verschwinden.
MUSIK 10 ( Andreas Suttner: Walking 1 0’35)
Erzählerin
In den Händen eines Schusters offenbart ein Schuh nicht nur seine Stabilität oder Schönheit, sondern auch seine Fragilität. Die Lederzunge kann ihm arg beansprucht raushängen. Abgetreten und ramponiert ist er. Löchrig vielleicht. Die Ösen für die Bänder zerrissen, die Riemchen baumelnd. Das Leben hat ihm mitgespielt. Ob sein Lebenszyklus noch mal verlängert wird, hängt von der pflegenden Liebe seines Besitzers und vom Material ab.
Apropos Material: Verlagert in Billiglohnländer in Asien, unter Missachtung von Arbeitsschutz und Umweltbelastungen, kommen in der globalen Schuhherstellung immer wieder hochgiftige Chemikalien zum Einsatz – zum Beispiel beim Gerben von Leder. Arbeiter, häufig auch Kinder, sind diesen in schuhproduzierenden Ländern wie Indien oft ohne Schutz ausgesetzt. Nachhaltige Produktion in Europa oder gar der Region hilft da nur zum Teil. Pflanzlich gegerbtes Leder und Materialien wie Naturkautschuk, Fasern von Bananen, Kaktus oder Ananas, können die Schwemme von Billigprodukten nicht ausgleichen.
MUSIK 11 ( Nancy Sinatra: These Boots Are Made For Walking 0’20)
MUSIK 12 (Son Lux: Switch Shoes To The Wrong Fell 1’00)
Erzählerin
Das ist die ökologische Seite des Themas. Und dann gibt es noch die psychologischen Deutungen. Schuhe entfesseln Phantasien, kokettieren mit Schlüsselreizen, in vielen Schattierungen, vom Puderquasten-Pantöffelchen der 1950er Jahre bis zu den Schnürungen und Latexinszenierungen und auf die Spitze getriebenen Requisiten der Fetischszene. Ein Spiel um sexuelle Dominanz oder Unterwerfung. Manche Menschen erregen sich am Geruch getragener Damenschuhe. Der Übergang vom Fetisch zum modischen Accessoire ist fließend. Modedesigner frönen ihm, Künstler setzen ihn visuell in Szene. Helmut Newtons „Nudes“, die nackten Frauen in High Heels, Rudolf Schlichters Frauenakte in hochgeknöpften Stiefeln. Der Maler der Neuen Sachlichkeit soll seine Frau und Muse „Stiefelchen“ genannt haben.
Was für eine Freiheit, Schuhe zu tragen, wie man will! Männer, Frauen, ob hetero oder queer, cis, nonbinär oder trans, können hochhackige Highheels tragen oder Sandalen, deren Fußbett aussieht wie ein trockengelegtes Schlammflussbett. Und in beiden sexy aussehen. Oder eben nicht. Ganz nach Belieben. An der Absatzhöhe und dem Klackklack der Stilettos muss sich jedenfalls kein Emanzipationsstreit mehr entzünden. Und kollektive Zwänge bleiben hoffentlich historisch.
MUSIK 13 ( Michi Koerner: Glassy Drop 0’15)
12 ZSP
Also für uns jetzt aus westlichem Blick findet man das natürlich ganz schrecklich, so einen winzigen kleinen Schuh in der Hand zu haben, wie wir hier sehen, der nicht mal die Länge einer Handfläche hat – und da passte der Fuß rein, er passte natürlich nicht rein, weil auch der Fuß von Chinesinnen von Natur aus nicht so klein war, das ist natürlich ein völlig verkrüppelter Fuß. Dass ein Schuh sozusagen eine Art ist, jemanden zu unterwerfen oder zu knechten, sieht man ja dann an diesen doch ja sehr gruseligen Lotus-Schuhen.
MUSIK 14 ( Michi Koerner: Glassy Drop 0’30)
Erzählerin
Isabella Belting hält eine Art Seidentäschchen in der Hand, mit denen die Chinesinnen, denen die Füße gebunden wurden, in kleinen Schritten tippeln konnten. Sie kaschierten eine brutale Methode, die bis ins 20. Jahrhundert hinein noch praktiziert wurde: Das Binden der Füße war jahrhundertelang ein Ritual der gehobenen Gesellschaft in China. Eine Demonstration von Wohlstand, eine Frau mit gebundenen Füßen musste nicht arbeiten -sie konnte ja kaum gehen.
13 ZSP
Es ist tatsächlich eine Folter, wenn man sich das durchliest. Die 4 Zehen, wurden gebrochen und nach innen gebunden, und das einzige, das noch als stabiles Glied da war, war nur der große Zeh. Und die wurden extrem gebunden und geschnürt, es muss sehr, sehr schmerzhaft gewesen sein. Aber die Mütter haben es im besten Glauben gemacht, weil sie dachten, ihre Töchter haben dann ein besseres Leben, ein gutes Leben - also ausgewickelt hat man den Fuß nie gezeigt.
Erzählerin
Schuhe sind Lebensbegleiter. Wenn es gut läuft, baut man eine Beziehung zu ihnen auf. Sieht man irgendwo Schuhe, die liegengeblieben sind, ist das eine Irritation, die sofort Gedanken in Gang setzt, wem diese Schuhe wohl gehören mögen und warum sie da alleine stehen. Noch schlimmer, wenn es nur ein einzelner ist.
MUSIK 15 ( Giora Feidman: Main shikhelekh varfoylt – Mkh tsudieygelekh 0’45)
Und geradezu erschütternd ist der Anblick jener Fotodokumente auf denen haufenweise zurückgebliebene Kinderschuhe zu sehen sind. Sie gehörten jüdischen Kindern, die im KZ Auschwitz ermordet wurden. Hier zeigt sich am deutlichsten, dass der Schuh ein Gegenstand ist, der nahezu als ein Teil des Körpers empfunden werden kann.
Die Geschichte einer Gesellschaft lässt sich an ihrer Fußbekleidung erzählen. Soziale Entwicklungen, ästhetische Vorstellungen, Überfluss -oder auch Not, wie manche Exemplare verdeutlichen, die in die Sammlung des Münchner Stadtmuseums gewandert sind, wie Isabella Belting erklärt:
14 ZSP
Dass diese Kriegs- und Nahkriegsschuhe was ganz Besonderes sind, hat man sicher in dem Moment erkannt, wenn man es in der Hand hatte – die jetzt mal erstmal per se materiell kein Wert haben, sondern wirklich aus Resten zusammengestückt und zusammengeflickt wurden. Alte Autoreifen, Nägel, aus Gummi, aus irgendwelchen Pappedeckeln zusammen gehämmert, genäht -und wir sehen den und freuen uns riesig, weil das so ein wahnsinnig interessantes Stück Kulturgeschichte ist und eben so etwas Berührendes hat.
Erzählerin
Der Schuh ist Indikator dynamischer Veränderungen, durch die Jahrhunderte hindurch -und mit ihm unser Fuß, wie der stets zu mokanten Beobachtungen aufgelegte Wiener Architekt Adolf Loos in seinem Buch Ornament und Verbrechen um 1908 herum notiert:
MUSIK 16 ( Mortage Stomp 0’40)
ZITAT
„Aber schon im Laufe dieses Jahrhunderts begann der menschliche Fuß eine Wandlung durchzumachen. Unsere sozialen Verhältnisse haben es mit sich gebracht, dass wir auch von Jahr zu Jahr schneller gehen. (…) So langsam zu schreiten, als sich die Leute in früheren Zeiten fortbewegten, wäre uns heute unmöglich. Dazu sind wir zu nervös. (…) Also gehen wir schneller. Das heißt mit anderen Worten, daß wir uns mit der großen Zehe immer stärker vom Erdboden abstoßen. Und tatsächlich wird unsere große Zehe immer kräftiger und stärker. (…) Durch eigene Kraft vorwärts kommen heißt die Parole für das nächste Jahrhundert.“
Ornament und Verbrechen, Metro Verlag, Seite 31 ff)
Erzählerin
Adolf Loos konnte nicht ahnen, dass gut 100 Jahre nach seinen Betrachtungen die Verkörperung eines einzigen Schuhs zum Vollstrecker unserer Lebensweise geworden ist: bequem, schnell und allzeit mobil voranzukommen.
MUSIK 17 ( Dr. Der: Still D.R.E. 0’55)
Der Turnschuh, der Sneaker, hat sich in alle Bereiche hineingeschlichen. Wird zu jedem Style getragen. Jederzeit. Überall. Von allen. Der Sneaker ist Wegwerfware, Kultobjekt, Sammlerfetisch. In den Luxusboutiquen nahe der Piazza San Marco in Venedig wird er auf Säulchen und Sockeln inszeniert wie Diamantware oder die finale Goldreserve. Ein Schuh, der nicht mehr Handwerk ist und nicht mehr architektonische Skulptur. Mögen Soziologen der nahen und ferneren Zukunft herausfinden, welche Essenz unserer Zeit darin fußt.

117 Listeners

73 Listeners
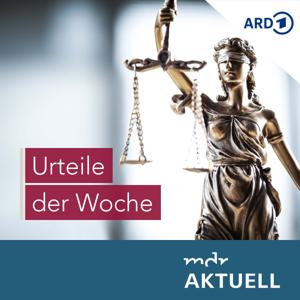
2 Listeners

53 Listeners
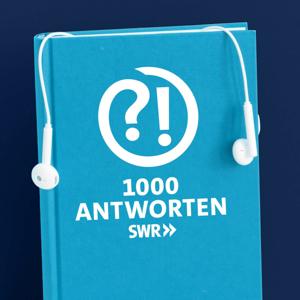
7 Listeners

7 Listeners

14 Listeners

51 Listeners

9 Listeners

4 Listeners

110 Listeners

27 Listeners

0 Listeners

16 Listeners

2 Listeners

43 Listeners

16 Listeners

35 Listeners

45 Listeners

2 Listeners

0 Listeners

1 Listeners

30 Listeners

36 Listeners

5 Listeners

21 Listeners
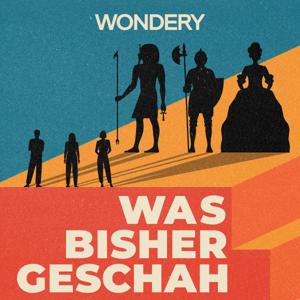
22 Listeners

0 Listeners

4 Listeners