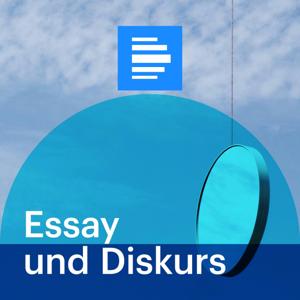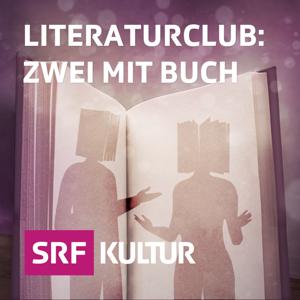Natürlich klingt es vermessen, 100 Seiten über das „Buch der Bücher“, die „Heilige Schrift“, aber die Autorin Johanna Haberer erinnert daran, dass die Bibel selbst lange nichts anderes war als eine Sammlung von unzusammenhängenden Texten, deren Bestand sich fortlaufend änderte, denn lange war umstritten, was gehört dazu, was nicht.
Und erst nachdem das Christentum über die Jahrhunderte ein Bild von sich entwickelt hatte, gab es so etwas wie eine Richtschnur für den richtigen Glauben und damit für die Festlegung des Kanons.
Aber damit beginnen schon die Probleme, die sich in dem lapidaren Satz zusammenfassen lassen:
Auf die Bibel berufen sich Juden wie Christen.
Quelle: Johanna Haberer – Bibel. 100 Seiten
Existiert die „jüdisch-christliche Kultur“ wirklich?
Doch ist das wirklich wahr? Gibt es die „jüdisch-christliche Kultur“, von der Johanna Haberer spricht? Denn die existiert ja nur aus christlicher Perspektive, nicht aus jüdischer. Wer wüsste als Nichtjude – Hand aufs Herz – wirklich etwas vom Judentum.
Die vielbeschworene jüdische Kultur ist nichts anderes als die, die die Christen in einem Akt kultureller Aneignung für sich erfunden und ausgelegt haben. Schon der Name Altes Testament unterstellt, dass die Geschichte des Judentums als eine Art historische Vorstufe abgeschlossen gewesen sei, um dann von den Christen in eine neue Dimension überführt zu werden.
Wenn Johanna Haberer also schreibt:
Diese beiden Testamente, wie wir den jüdischen und den christlichen Teil der heiligen Schrift nennen,
Quelle: Johanna Haberer – Bibel. 100 Seiten
dann meint das „wir“ eine klar christliche Perspektive, und kein jüdischer Gläubiger würde diesen Satz unterschreiben, weil die hebräische Bibel nicht nur weitergeführt, sondern selbst erst als endgültiger Korpus fixiert wurde, als parallel dazu die Kanonbildung auf der christlichen Seite von statten ging. Man hat es also mit zwei eigenständigen, in Konkurrenz sich entwickelnden Religionen zu tun.
Ein 2000 Jahre alter Text trifft auf unsere Wirklichkeit
Natürlich weiß Johanna Haberer dies alles, sie war schließlich Professorin für evangelische Theologie und ist nebenher mit ihrer Schwester Sabine Rückert eine der zwei Pfarrerstöchter, die in ihrem erfolgreichen Podcast die Bibel auf unsere Wirklichkeit treffen lassen.
Aber der Hang zur Aktualisierung führt zu begrifflichen Unschärfen und historischen Ungenauigkeiten, die uns einen bald 2000 Jahre alte Textkorpus leicht zugänglich machen wollen, sozusagen barrierefrei und anschlußfähig. Beispiel:
In der Bibel wurzelt die Idee der Menschenrechte
Quelle: Johanna Haberer – Bibel. 100 Seiten
Aber ist das wirklich so? Die Menschenwürde wurde bis ins 18. Jahrhundert als ein Gütesiegel für eine tugendhafte Lebensweise angesehen, sie war einem nicht von Geburt an gegeben. Bei antiken Denkern wie Cicero, bei christlichen wie Nikolaus von Kues oder Pico della Mirandola, den klassischen Theoretikern der Menschenwürde, bildete sie ein anzustrebendes Ziel, keine Voraussetzung.
Erst Immanuel Kant verankerte sie im menschlichen Leben selbst. Lange Jahre hat sich die Kirche gegen diese Lesart gesträubt, ja sie bekämpft, um erst nach 1945 die gesetzesmäßige Verankerung der Würde in den Menschenrechten langsam zu akzeptieren.
Oder ein anderes Beispiel:
Die Freiheitsrechte unserer demokratischen Gesellschaft sind ohne das biblische Fundament nicht denkbar.
Quelle: Johanna Haberer – Bibel. 100 Seiten
Sind die Freiheitsrechte ohne die Bibel als Fundament denkbar?
Das hätte Papst Pius IX sicher anders gesehen, als er 1864 seine „Liste der Irrtümer“ der Moderne veröffentlichte, zu der die „Freiheitsrechte der demokratischen Gesellschaft“ eben gehörten. Nun ist Johanna Haberer Protestantin, siehe Pfarrerstochter, muss also nicht dem Papst folgen, aber auch Martin Luther beschränkte seine Freiheitsrechte auf Glaubensdinge, die er von einer wohlwollenden Obrigkeit am besten abgesichert sah, die konnte undemokratisch sein, wie sie wollte.
Vielleicht steckt hier ein Grundproblem des Büchleins, nämlich dass eine fast 2000-jährige Interpretationsgeschichte der Bibel einfach zugunsten unserer Gegenwart abgeräumt wird. Denn gleich zu Beginn heißt es:
Aber auch für finstere Kräfte wird die Bibel zur Kronzeugin: Auf sie pochen Kriegstreiber, Sektengründer, Verbrecher und Verrückte!
Quelle: Johanna Haberer – Bibel. 100 Seiten
Nur, darunter sind natürlich auch Päpste und Reformatoren. Warum sollte ihr Wort, ihre mit Bibelzitaten hinterlegten Taten weniger gelten? Wer entscheidet darüber, welche Auslegung die richtige ist? Ist es nur die jeweils historisch letzte? Das wäre banal.
Die Bibel – „menschlich gelesen“
Natürlich ist es schöner, wenn man den Turmbau zu Babel nicht als Geschichte menschlicher Hybris liest, sondern als von Gott gewollte Diversitätsbildung oder den Sündenfall des zweiten Schöpfungsberichts „ohne – Zitat – sündenverliebte Moralbrille“ als Genese des menschlichen Bewusstseins und nicht als Ursprung der Erbsünde.
Doch so leicht wird man die nicht los. Die Bibel – „menschlich gelesen“ lautet das Motto von Johanna Haberer. Aber so verwandelt sie sich in ein Buch unter Büchern.