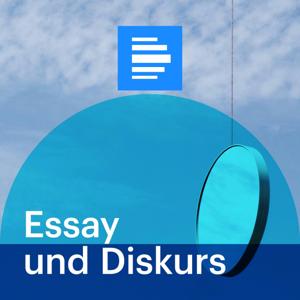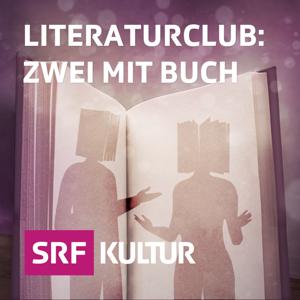Ein neuer Krimi aus Japan erzählt von Morden, die aufgeklärt werden, weil die Opfer rätselhafte Zeichnungen hinterlassen haben.
„Seltsame Bilder” heißt er, der Autor ist Uketsu. Inzwischen weiß man, dass es sich bei Uketsu um einen Mann handelt. Und der ist vielleicht auch ein bisschen seltsam: Er tritt nur in einem schwarzen Ganzkörperanzug und mit einer weißen Maske auf, die ans „Nō“-Theater erinnert. Seine Stimme lässt Uketsu verzerren.
Uketsu ist Youtuber, Internetautor, er macht Fotoinstallationen und er ist Zeichner. Drei Krimis hat er bislang geschrieben. „Seltsame Bilder” war sein Debüt und das wurde nun auch ins Deutsche übersetzt. Der Krimikritiker und Publizist Thomas Wörtche im Gespräch über den Roman.
Anonymität als PR Stunt
SWR Kultur: Herr Wörtche, auf YouTube kann man etliche, so niedlich gruselige Kurzfilme von Uketsu finden. Sein Kanal hat 1,75 Millionen Abonnenten. Wie wirkt denn Uketsus Performance auf Sie?
Thomas Wörtche: Sie haben es schön gesagt: niedlich und gruselig. Mir würde vielleicht noch ein klein wenig albern einfallen. Das ist, betrachtet in den Parametern der Aufmerksamkeitsökonomie, natürlich ein sehr geschickter Schachzug. Sich zu verfremden, sich unkenntlich zu machen, mit einer Maske aufzutreten und komische Stimmlagen zu pflegen, das hat einen hohen Verfremdungseffekt.
SWR Kultur: Und er ist auch anonym, das trägt zur Rätselhaftigkeit bei. Dass Autoren anonym bleiben wollen, das ist kein Einzelfall. Viele publizieren unter Pseudonym. B. Traven zum Beispiel, Elena Ferrante...
Thomas Wörtche: ...Ettore Schmitz alias Italo Svevo. Im Krimi-Bereich gibt es das natürlich auch: Gore Vidal als Edgar Box. In Deutschland: Cora Stephan als Anne Chaplet. Oder ein Wesen, das weder geschlechtlich noch namentlich definiert ist, namens Kim Koplin. Das ist völlig normal, das ist gar nichts Besonderes.
SWR Kultur: Sie lesen das nicht als Teil der Gruselstrategie?
Thomas Wörtche: Nein, überhaupt nicht. Ich lese das als Teil der PR-Strategie.
Mordfälle und kuriose Zeichnungen
SWR Kultur: „Seltsame Bilder”: Darin geht es um mehrere Morde, verteilt auf mehrere Jahrzehnte, nicht chronologisch erzählt. Ein Kind erschlägt seine Mutter, eine Schwangere stirbt bei der Geburt, zwei Männer werden in ihren Zelten erschlagen und die Opfer haben Zeichnungen hinterlassen.
Das ist das Besondere an diesen Geschichten. Und diese Zeichnungen, die helfen schließlich bei der Aufklärung der Mordserie. Die sind im Buch auch abgedruckt. Was für Bilder sind das?
Thomas Wörtche: Das sind merkwürdige Bilderrätsel. Im ersten Fall von der Frau, die beim Geburt ihres Kindes stirbt, da müssen wir fünf Bilder zusammenfügen. Obwohl er eigentlich immer nur von drei Bildern spricht, aber es geht um fünf Bilder. Wenn man die dreht und entschlüsselt, kommt man darauf, dass es ein Mord ist.
Die Herren, die im Zelt erschlagen werden, die malen unter seltsamen Umständen Bergketten ab, wo der Sonnenstand und die Perspektive eine Rolle spielt. Das sind natürlich Sachen, die kaum zu rekonstruieren sind, gerade die Sachen mit den Bergbildern. Er erzählt uns, dass der, der erschlagen wird, sozusagen mit den Händen hinter dem Rücken eine Skizze einer Bergkette liefert. Das ist schon ein bisschen arg gewagt, würde ich sagen.
Andererseits gibt es auch andere, nicht-textliche Elemente: Timetables, merkwürdige Buchstabenreihungen, die wir nicht verstehen, weil sie auf zwei japanischen Schriften beruhen, die eigentlich gar nichts zum Verständnis des Buches beitragen, sondern den Inhalt nochmal verdoppeln.
Nochmal das berühmte Spiel des klassischen „Whodunnit“. Mit den Zeittafeln: Wer war wann wo? Wo waren sie um 18.17 Uhr und wo waren sie um 18.18 Uhr? Also das Spiel verdoppelt dadurch, dass er das nochmal grafisch umsetzt. Das ist dann eher... redundant.
Mehr Schein als Rätsel
SWR Kultur: Ich fand die Idee, in einem Krimi mit Bildern und Bildinterpretation zu arbeiten erstmal sehr, sehr gut. Aber dann gibt es diese zwei Arten von Bildern: Das eine sind die Rätselbilder, die der Erzähler entschlüsselt und wir dann eben auch mit ihm. Das andere sind im Grunde nur in Grafiken umgesetzter Text, könnte man sagen.
Da wird ein Zeitstrahl aufgezeichnet. Da steht dann, welche Figur von wann bis wann ein Alibi hatte. Das haben wir aber im Text alles schon gelesen, das bringt irgendwie nicht viel.
Thomas Wörtche: Nein, das bringt überhaupt nicht viel. Und vor allem ist das ja auch uralt, das ist ja keineswegs innovativ. Da sind wir wieder beim klassischen „Whodunnit“, wo das sehr oft gemacht wurde, dass Pläne oder Bilder beigelegt wurden.
Bei John Dickson Carr, Ellery Greene, Freeman Wills Crofts... Ich glaube sogar auch bei Agatha Christie, da bin ich mir nicht ganz sicher. Eigentlich bei sehr, sehr vielen Autorinnen und Autoren des „Golden Age" ist das so.
Gerade beim „Locked-Room Mystery" ist das sehr berühmt, also beim Rätsel des verschlossenen Zimmers: Da wird das Zimmer skizziert, damit man sieht, dass da ja keiner reinkommt. Dann wird eben mit Taschenspielertricks - wie ich das nenne - wird das dann aufgelöst und das ist natürlich hier genau dasselbe Verfahren.
Alles erklärt, nichts gedacht
SWR Kultur: Ich dachte ja zuerst, dass das ein Krimi zum Mitraten sei. Das ist aber nicht, es wird einem alles, durch und durch erklärt.
Thomas Wörtche: Keine Chance! Es wird erklärt und ist auch außerhalb jeder menschlichen Vernunft. Irgendjemand wird zwangsgefüttert, um den Mageninhalt auf eine bestimmte Todeszeit festlegen zu können. Das ist völlig bizarr. Genau wie das Malen, halb erschlagen, mit einer Hand hinterm Rücken. Das sind lauter so Sachen, die einfach nur konstruiert sind und die einem keine Chance geben zum Miträtseln.
Und außerdem geben die Bilder und auch der Text kein Material zum Miträtseln. Es wird alles auserzählt. Die Fakten werden einem um die Ohren gehauen, aber diese Fakten sind natürlich alle erfunden, also alle nachgeliefert. Die folgen keiner logischen Kette, sondern allein der Willkür des Autors.
Allwissender Erzähler führt hinters Licht
SWR Kultur: Ich habe mich zwischendurch mal gefragt: Wer ist hier eigentlich der Erzähler? Der kennt seine Figuren und ihr Erleben sehr gut. Er erzählt immer aus einer Perspektive. Das fand ich schon ziemlich unheimlich. Effektvoll, in dem Sinne war es auch gelungen.
Aber zunehmend fühlte ich mich von diesem Erzähler, der irgendwie alles weiß, aber immer nur so Schritt für Schritt alles preisgibt, so ein bisschen hinters Licht gefühlt.
Thomas Wörtche: Er spielt sozusagen der Erzähler als Gott. Der allwissende Erzähler, ein uralter Trick. Der ist aber, wenn man das mal ideologiekritisch wenden würde, die Zentralperspektive. Und die Zentralperspektive lässt überhaupt nichts anderes zu. Sie ist sozusagen diktatorisch.
Das Diktatorische ist dann: Immer noch ein neues Kaninchen aus dem Hut zu ziehen. Noch eine Beziehung zwischen Personen zu enthüllen, ohne die man den Roman eigentlich gar nicht verstehen könnte, aber die sehr spät nachgeliefert wird und so weiter und so fort.
Hype trifft auf Ernüchterung
SWR Kultur: Uketsus Krimis wurden in Japan ziemlich gefeiert, dort ist er ein Bestseller-Autor. Jetzt erscheinen in etlichen Ländern Übersetzungen seiner Romane. Der Krimi „Seltsame Bilder” stand im Mai auch auf Platz 1 der deutschen Krimi-Bestenliste. Da kam er offenbar gut an. Der Lübbe-Verlag bringt schon Ende Oktober Uketsus nächstes Buch heraus, „Seltsame Häuser".
Ich verstehe den Hype um die Figur Uketsu durchaus, aber den Hype um die Romane verstehe ich nach der Lektüre nicht so ganz. Sie, glaube ich, auch nicht?
Thomas Wörtche: Nicht so richtig. Ich verstehe natürlich, dass die optische Aufmachung, auch das Buchdesign, originell ist. Die Sprache übrigens, das würde ich noch gerne anmerken, die Sprache ist wirklich sehr, sehr schlicht. Es gibt keine Rezeptionshürden.
Das möchte er auch. Er sagt in einem Interview, er möchte jetzt nicht literarisch sein, sondern er möchte auf möglichst breite Akzeptanz stoßen. Das ist ihm gelungen. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum das Ding so abgeht und gefeiert wird.