
Sign up to save your podcasts
Or




Pfützen gelten als kleinste Gewässer. Die Ökosysteme, die sich darin ausbilden, sind hingegen bunt und vielfältig. Bakterien und Algen, Bärtierchen und Amöben, Mückenlarven und Kaulquappen. Gleich nach dem Regen wuselt das Leben und selbst in ausgetrockneten Lachen ist noch was los. Von Susi Weichselbaumer (BR 2024)
Credits
Autorin dieser Folge: Susi Weichselbaumer
Regie: Susi Weichselbaumer
Es sprachen: Katja Amberger, Burchard Dabinnus, Diana Gaul
Technik: Andreas Lucke
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
Rainer Meckenstock, Professor für Aquatische Mikrobiologie an der Universität Duisburg-Essen ;
Herwig Stibor, Professor für Aquatische Ökologie an der LMU;
Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München
Diese hörenswerten Folgen von radioWissen könnten Sie auch interessieren:
Gartenteich - Paradies für Seerosen und Co
JETZT ANHÖREN
Grundwasser - Ein geheimnisvoller Lebensraum
JETZT ANHÖREN
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Wie wir ticken - Euer Psychologie Podcast
Wie gewinne ich die Kraft der Zuversicht? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Der neue Psychologie Podcast von SWR2 Wissen und Bayern 2 Radiowissen gibt Euch Antworten. Wissenschaftlich fundiert und lebensnach nimmt Euch "Wie wir ticken" mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Immer mittwochs, exklusiv in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
ZUM PODCAST
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ATMO Spielplatz 1/ MUSIK Sandbath 0.47 min
ERZÄHLERIN
Am Nachmittag auf dem Spielplatz – es hat den ganzen Morgen über geregnet. Zwischen Rutsche und Klettergerüst stehen große, kleine, mittlere Pfützen.
1 ZU 4
V: Ihhhh / W: Da versickert man! GELÄCHTER
ERZÄHLERIN
Für die Kinder in den knallbunten Gummistiefeln ist es ein einziges Schlammfest.
2 ZU 5
Q: Ja!!! PLATSCH Juhu!!!
ATMO/ MUSIK ENDE
ERZÄHLER
Herwig Stibor teilt diese Begeisterung. Er ist Professor für Aquatische Ökologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München –
ERZÄHLERIN
Und leidenschaftlicher Pfützenforscher:
3 ZU Stibor 16:53
Allein die faszinierenden Abläufe in diesem Ökosystem sollten einem Respekt abfordern.
ERZÄHLERIN
Denn: Obschon die Forschung sie führt als die kleinsten stehenden Gewässer, die obendrein oft nur kurze Zeit existieren: In Pfützen und Lachen tobt enorm viel –
ERZÄHLER
Und vielfältiges Leben.
MUSIK Lightfooted reduced 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Wasser im Wald.
ATMO WALD/ MUSIK Field Day 0.47 min
ERZÄHLERIN
Die Waldbäume reihen sich dicht an dicht. Durch die grünen Wipfel dringt ab und an ein Sonnenstrahl. Der Regenschauer ist vorbei. Es riecht nach feuchter Erde. In den Kuhlen auf dem Waldboden stehen Wasserlachen. Wenn das Licht durch die Äste auf die Wasseroberfläche trifft, schillern Regenbogenfarben in bunten Schlieren. Es spiegelt und glänzt.
ERZÄHLER
Wie ein Ölfilm.
ERZÄHLERIN
Ist aber keiner!
4 ZU Meckenstock (0.00)
Sondern das ist ein ganz hauchdünner Eisen- oder Manganfilm.
ERZÄHLERIN
Erklärt Prof. Rainer Meckenstock. Er ist Umweltmikrobiologe an der Universität Duisburg-Essen.
5 ZU Meckenstock (0.00)
Und der entsteht dadurch, dass da Mikroorganismen sind, die reduziertes Eisen, was aus dem Untergrund rauskommt, oxidieren. Und dann fällt es als Rost praktisch aus an der Grenzschicht zwischen Wasser und Luft. Und bildet so einen ganz dünnen Film, der eben aussieht wie ein Ölfilm.
ERZÄHLER
Schnappt man sich einen herumliegenden Stock oder ein Stück abgefallener Rinde und stochert damit in der Pfütze, verziehen sich die Schlieren nicht wie bei einem Ölfilm und bilden neue buntschillernde Muster.
ERZÄHLERIN
Sondern: Sie brechen.
ERZÄHLER
Wie Eisschollen.
ERZÄHLERIN
Quasi Eisen-Eisschollen.
MUSIK Tangerine
ERZÄHLER
Mikroorganismen, die Pfützen quasi rosten lassen, sind nicht die einzigen, die sofort aktiv werden, sobald sich auf dem Waldboden oder überhaupt auf lehmig-erdigem Untergrund irgendwo in einer Mulde Wasser ansammelt. Abermillionen Kleinstlebewesen warten im Untergrund nur darauf, dass sich etwas Neues tut.
ERZÄHLERIN
Eine Pfütze entsteht.
ERZÄHLER
Um selbst tätig zu werden und zu nutzen, was die Lache hergibt.
ATMO/ MUSIK ENDE
6 ZU Meckenstock (1.33)
Wenn da viel Organik ist in der Pfütze, sagen wir mal im Wald sind viele Blätter runtergefallen, dann ist da viel organisches Material. Dann gibt es sofort Mikroorganismen, die sich darüber her machen und das abbauen.
ERZÄHLERIN
Da sind Bakterien, die Sauerstoff umsetzen. Die nächsten verzichten auf Sauerstoffe und bauen Nitrat um. Daraus bilden sie elementaren Stickstoff.
ERZÄHLER
Wieder andere Bakterien mögen Sulfat und reduzieren es zu Schwefelwasserstoff.
7 ZU Meckenstock (1.33)
Und dann stinkt es so. Das ist der Schlamm, der sich im Boden bildet, der dann so stinkt und so schwarz ist. Das sind meistens Eisensulfide, die eben durch die mikrobielle Atmung da entstanden sind.
MUSIK Going to work
ERZÄHLERIN
Millionen verschiedener Bakterienarten übernehmen also verschiedenste Umsetzungsjobs in der Pfütze. Und: Sie arbeiten nach System.
ERZÄHLER
Exakter nach einem Schicht-Plan. An der Oberfläche dümpelt etwa, wer Sauerstoff braucht. Organismen, die Nitrat bevorzugen und veratmen, ziehen ein paar Stockwerke tiefer ein…
8 ZU (Meckenstock (3.42))
Und dann zum Schluss, ganz unten, da sind die Methanogenen, und die machen aus dem organischen Material Methan. Und das bubbelt dann so hoch. Wenn man mit dem Stock reingeht in den Schlamm, dann kommen die Blasen hoch. Das ist meistens Methan und CO2.
MUSIK ENDE/ ATMO WALD
ERZÄHLER
Mikrobieller Schichtbetrieb also…
ERZÄHLERIN
Und zwar von ziemlich jetzt auf gleich in dieser kleinen Lache, die sich eben erst auf dem Waldboden gebildet hat. Da ist der Regen noch gar nicht vorbei, wirbelt es schon. Forschende wie Rainer Meckenstock zählen bis zu einer Milliarde Mikroorganismen pro Milliliter Pfützenwasser. Und diese Winzlinge ackern kräftig.
MUSIK Moviated Work 0.56 min
ERZÄHLERIN
Nach wenigen Tagen zieht sich da durchaus ein ansehnlicher Biofilm über die Wasseroberfläche. Grünalgen und Jochalgen machen sich breit. Goldalgen – die aussehen wie kleine Schmuckstücke, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut.
ERZÄHLER
Die mikrobielle Gemeinschaft gedeiht.
ERZÄHLERIN
Und bekommt kontinuierlich Zuwachs, beschreibt der Münchner Professor für Aquatische Ökologie, Herwig Stibor.
9 ZU (4 Stibor 1.46)
Dann kann so eine Pfütze recht schnell genug Bakterien und Algen haben, um andere Tiere wie kleine einzellige Pantoffeltierchen oder Glockentierchen zu ernähren.
ERZÄHLER
Eingetragen werden neue Bewohner auch per Wind, als blinde Passagiere im Federkleid von Vögeln, die einen Trinkstopp einlegen oder Badepause machen.
MUSIK Sandbath 0.45/ ATMO Spielplatz 1
ERZÄHLERIN
Manch Zuzügler klebt an der Sohle des Kindergummistiefels und platscht mit von Wasserloch zu Wasserloch.
10 ZU (4 Stibor 1.46)
Und dann reicht es irgendwann auch für Insektenlarven.
ERZÄHLERIN
Mücken lieben Lachen, auch schon die ganz flachen hier auf dem Spielplatz. Ungefähr sechs Zentimeter tief ist das Wasser. Breit ist die Pfütze vielleicht wie zweimal die Arme von Mama, Papa, Oma oder Babysitter ausgestreckt.
11 ZU (0.29) 6
M: Da schwimmen so weiße kleine Dinger rum und ich glaube, das sind so eine Art Eier, die Mücken oder Fliegen abgelegt haben.
ERZÄHLER
Könnte sein und wäre typisch für kleine stehende Gewässer wie diese Art Pfütze:
MUSIK Lightfooted 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die Spielplatz-Pfütze.
MUSIK Healthy balance 0.48 min
ERZÄHLERIN
Baut man fleißig Matschdämme oder lässt Schiffchen aus Blättern in den Lachen zwischen Bolzplatz und Schaukel treiben, stößt man nicht selten auf längliche Eier, kleiner als ein Millimeter, weiß bis bräunlich-schwarz, die aneinanderkleben wie Stifte in einer Box. Oder zusammen winzige Kreise bilden, die aussehen wie Unterteller.
ERZÄHLER
Viele verschiedene Mückenarten verteilen ihre Eier in Pfützen, oft bis zu 200 (Eier) auf einen Rutsch. Die Larven sind in so einer Spielplatzlache rundum versorgt. Sie ernähren sich von Pflanzenteilchen im Wasser. Zum Atmen rudern sie regelmäßig an die Oberfläche. Nach zwei bis drei Wochen starten sie los in die Luft – als fertige Mücken.
MUSIK ENDE / ATMO SPIELPLATZ
ERZÄHLERIN
Das Ökosystem Pfütze kennt viele Lebensläufe. Die meisten erkundet man am besten unterm Mikroskop. In jedem Tropfen Wasser aus der Pfütze auf dem Spielplatz –
ERZÄHLER
Ist etwas geboten.
MUSIK Bonsai dub (f) 1.10 min
ERZÄHLER
Wasserflöhe wuseln umher. Das sind winzige Krebse, ein bis drei Millimeter etwa. Durchsichtig-weiß wirken ihre runden Körperchen ein bisschen pummelig. Die im Verhältnis großen schwarzen Knopfaugen schauen immer etwas erstaunt drein.
ERZÄHLER
Und Achtung: Sie heißen Flöhe, weil sie auf ihren langen verästelten Fühlern hüpfen wie Flöhe.
ERZÄHLERIN
Richtig scharf stellen muss man das Mikroskop, um Wimperntierchen zu sehen. Die sind in der Regel nur 10 bis 300 Mikrometer lang. Überall am ovalen Körper stehen kleine Haare ab –
ERZÄHLER
Wie eine Punk-Frisur, nur eben rundherum.
ERZÄHLERIN
Mit den Härchen rudern die Wimperntierchen durchs Wasser. Den nahezu durchsichtigen Rädertierchen stehen auch die Haare zu Berge, allerdings nur am Kopf. Fürs Vorwärtskommen setzen sie statt auf Wimpernkraft auf den langen Schwanz, mit dem sich prima rudern lässt. Auch wenn er kaum länger ist als 0,1 Millimeter.
ERZÄHLER
Eine gewisse Manövrierfähigkeit ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil: Das Ökosystem Pfütze ist kein Mikro-Idyll.
MUSIK Dust Bowl 0.32 min
ERZÄHLER
Da müssen Rädertierchen und Fadenwurm beispielsweise durchaus den knubbeligen Bärtierchen entkommen. Die steuern sie sonst mit ihren acht moppeligen Beinchen an, stechen den Rüssel ein und saugen das Opfer aus. Ist mal kein Opfer in Sicht, mögen es Bärtierchen genauso vegetarisch. Pflanzenteile und Algen genügen.
ERZÄHLERIN
Genügen ist denn auch eines der Schlagworte, wenn es um Leben, besser Überleben in der Pfütze geht. Und das schon seit geraumer Zeit. Charles Darwins Evolutionstheorie löst Mitte des 19. Jahrhunderts eine regelrechte Pfützenbegeisterung bei Forschenden aus. Bald ranken sich zahlreiche Theorien und spekulative Erklärversuche darum, wie Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, Menschen – einfach alles entstanden sein könnte aus Matsch.
ERZÄHLER
Die Idee von der Pfütze als alleiniger Ursuppe ist inzwischen passé. Jüngste Studien zeigen, dass die Bausteine des Lebens wohl von Meteoriten auf die Erde gebracht wurden. Kohlenstoff, Wasserstoff, Aminosäuren, Metalle und so weiter.
ERZÄHLERIN
Trotzdem: Irgendwo und wie mussten diese Elemente auf der Erde zusammengesetzt werden.
ERZÄHLER
In Pfützen vielleicht, meinen manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
MUSIK House of glass (d) 1.10 min
ERZÄHLER
2012 testeten Forschende der Universität Oldenburg in einem Experiment folgende Hypothese: Nicht die großen weiten Ozeane sind der Ursprung des Lebens, sondern kleine Lachen. Diese überschaubaren Wasserstellen seien durch Dämpfe und Gase entstanden, die aus den Tiefen der Erde aufgestiegen sind.
ERZÄHLERIN
Zeitlich reden wir da von irgendwann vor rund 3,8 Milliarden Jahren. Vulkane gibt es damals etliche auf dem Planeten, es brodelt und kocht. In der Atmosphäre ist kaum Sauerstoff, dafür jede Menge Kohlendioxid.
ERZÄHLER
In den vulkanischen Gebieten dampft es kräftig, Gase treten aus und kühlen an der Oberfläche ab. Dadurch bilden sich temporäre Teiche und Tümpel. Darin sammeln sich Mineralien und andere Grundbausteine für Einzeller. Voilá: Erstes Leben entsteht.
ERZÄHLERIN
Zumindest theoretisch und im Modell.
MUSIKENDE
ERZÄHLERIN
Ob die Pfütze nun wirklich der Anfang allen Seins ist – darüber diskutiert die Forschung bestimmt noch eine geraume Weile weiter. Was hingegen klar ist: Eine unscheinbare Pfütze kann genügen, um in kürzester Zeit ein vielfältiges Ökosystem aufblühen zu lassen.
ERZÄHLER
Aber nicht jede Kategorie von Lache taugt fürs pralle Leben:
MUSIK Lightfooted reduced
ZITATORIN
Nächstes Pfützenbeispiel: Die Pfütze auf der Straße.
ATMO Straße
ERZÄHLER
Unmittelbar nach dem Regenguss steht das Wasser in den Schlaglöchern auf der Fahrbahn. In kleinen Senken sammelt es sich neben dem Bürgersteig. Autoreifen lassen es hoch aufspritzen. Triefende Passanten schimpfen hinterher.
12 ZU (Meckenstock (18.47))
Also eine Pfütze auf dem Asphalt, die wird zu schnell austrocknen.
ERZÄHLERIN
Urteilt der Duisburger Umweltökologe Rainer Meckenstock. Ein paar Tage braucht es schon, bis sich ein Ökosystem entwickelt. Am besten einige Wochen. Zudem ist auf Teer, Asphalt und Beton oft wenig geboten an organischem Material, woraus mehr entstehen könnte als mikrobakterielles Leben.
ERZÄHLER
Andere Untersuchungsobjekte sind da idealer für Pfützenforscher:
13 ZU (Meckenstock (18.47))
Der Truppenübungsplatz, der ist ziemlich gut, nicht. Dadurch, dass die schweren Fahrzeuge den Boden so verdichten, dass der wasserundurchlässig wird. Und dann kann sich da schon sehr gut das Wasser stauen und bleibt jetzt auch längere Zeit da drin. Und das reicht ja dann sogar aus, dass da dann Frösche kommen und Kröten und drin laichen und Molche.
ATMO Wiese/ Tümpel
ERZÄHLER
Kröten, Unken und Molche wählen solche länger stehenden und etwas tieferen Lachen auf Übungsplätzen oder Äckern gerne als Kinderstube für ihre Kaulquappen. Kein Wunder: Hier gibt es kaum Feinde.
ERZÄHLERIN
In Tümpel oder See wird man schnell mal von Fischen gefressen.
MUSIK Tangerine 1.10 min
ERZÄHLER
In der Lache darf man in Ruhe groß werden. Zudem ist es kuschelig, das Wasser wärmt sich schnell auf, die Pfütze wirkt wie ein Brutkasten. Nach 41 Tagen wird aus einer Larve mit Kiemen und Schwanz eine fertige kleine Gelbbauchunke. Fünf Zentimeter groß. Wittert sie Gefahr, stülpt sie ihr Hinterteil nach oben. Eine quietschgelbe Bauchseite schlägt den Angreifer in die Flucht.
ERZÄHLERIN
Nett!
ERZÄHLER
Effektiv. Gelbbauchunken gab es auf der Erde schon vor den Dinosauriern.
ERZÄHLERIN
Trotzdem: 41 Entwicklungstage sind für Pfützenbewohner reichlich. Minikreuzottern schaffen das erheblich schneller: 17 Tage im Pfützenwasser und man schlängelt an Land weiter.
ERZÄHLER
Wobei, auch das ist womöglich zu lange. Denn: Pfützen werden zunehmend rar.
14 ZU (Meckenstock (18.47))
Bei uns wird jeder Graben unnützerweise immer sauber gemacht, damit das ordentlich aussieht, und dementsprechend läuft alles ab und durch. Und dann bleiben wenig Lebensräume zurück für solche Tiere.
MUSIK Field Day 0.45 min
ERZÄHLERIN
Rauchschwalben sieht man immer seltener. Ein Grund: Es fehlen Pfützen. Schwalben nutzen den Lehm aus Lachen für den Nestbau. Wo keine Lache, da keine Schwalbenfamilie.
ERZÄHLER
Und auch keine Schmetterlingsnachkommen. Schmetterlinge mögen am liebsten Blumennektar. Der ist reich an Zucker, hat aber wenig Nährstoffe.
ERZÄHLERIN
Vor allem keine, die Schmetterlinge benötigen für die Fortpflanzung.
ERZÄHLER
Der Kurort Schlammpfütze ist voller Salze und Mineralien.
ERZÄHLERIN
Schmettterlings-Männchen machen sich damit fit.
ERZÄHLER
Weibchen auch.
ERZÄHLERIN
Lachenmatsch verbessert die Lebensfähigkeit der Eier.
MUSIK ENDE
ERZÄHLER
Tatsächlich ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger Platz für Kurschlammpackungen für Schmetterlinge oder Matschbaumärkte für nistende Schwalben. Kleinstgewässer wie Pfützen verschwinden. Mehr und mehr Flächen werden versiegelt. Wege und Stege sind muldenfrei begradigt. Wasser soll in erster Linie ablaufen. Auch weil der Klimawandel zunehmend Starkregen bringt, der eben keine heimeligen Lachen entstehen lässt, sondern wertvollen fruchtbaren Boden wegschwemmt. Zugleich machen Hitze- und Dürreperioden Pfützen den Gar aus.
ERZÄHLER
Aber: Einige Pfützenbewohnerinnen und -bewohner haben sich in den vielen Jahrtausenden der Evolution darauf vorbereitet, dass es eben in der Natur der Pfütze liegt, auch mal auszutrocknen.
ERZÄHLERIN
Manchmal hat man Glück und kann per Anhalter eine Pfütze weiterreisen, die vielleicht länger nass bleibt: Im Gefieder eines trinkenden Vogels. Im Fell eines Hundes, der durchs Wasser springt. An der Sohle eines Kindergummistiefels.
ERZÄHLERIN
Nicht selten hat man aber auch Pech. Aus winzigem Wellengang wird weite Wüste…
MUSIK Lightfooted reduced 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die ausgetrocknete Pfütze
MUSIK Sandbath 1.15 min
ERZÄHLER
Fast schon philosophisch mutet die Erkenntnis von Pfützenforschenden wie dem Münchner Aquaökologen Stibor an: Nur weil man eine Pfütze nicht sieht, heißt das nicht, sie wäre nicht da. Sie ist halt für den Moment –
ERZÄHLERIN
Oder eine geraume Weile –
ERZÄHLER
Schlichtweg wasserlos.
15 ZU Stibor 0.19
Das bedeutet, dass die Organismen, die in einer Pfütze leben, damit gut klarkommen müssen.
ERZÄHLERIN
Fürs Klarkommen nennt Stibor verschiedene Strategien:
ERZÄHLER
Strategie 1: Die Generationszeiten etlicher Pfützenbewohner sind kurz, vielleicht nur einen Tag lang oder weniger, wie bei Bakterien, Amöben oder Pantoffeltierchen.
ERZÄHLERIN
Strategie 2: Nur die ersten Entwicklungsstadien finden in der Pfütze statt. Nach zwei Wochen startet die erwachsene Mücke ins luftige Leben, nach zwei drei Wochen hüpft die Unke an Land.
ERZÄHLER
Besonders spannend für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist Strategie 3: Viele Organismen, die in Pfützen leben, können sogenannte Dauerstadien einnehmen. Sich flexibel anpassen, wenn es trocken wird um sie herum.
16 ZU Stibor 1.46
Die wissen, dass diese Pfütze austrocknet und können rechtzeitig Stadien ausbilden, also Eier oder Dauerstadion von adulten oder juvenilen Tieren, die dann dieses Austrocknen überstehen können. Und wenn die dann per Wind oder einen anderen Transportweg wieder in eine Pfütze oder ein Gewässer kommen, dann würde dieses Dauerstadium wieder zum aktiven Dasein erweckt werden. Und dann schlüpft zum Beispiel wieder ein Moostierchen oder Bärtierchen.
ERZÄHLERIN
Auch Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München, interessiert sich speziell für diese Dauerstadien. Dazu weiß die Forschung noch gar nicht viel.
ERZÄHLER
Lange dachte man, es wäre einfach eine Art Sicherheitsmodus, um Wochen, Monate, Jahre zu überdauern.
ERZÄHLERIN
Offenbar gibt es jedoch Arten, die eine Trockenperiode sogar unbedingt brauchen.
17 ZU Hendrich 4.25
Dann ist diese Trockenphase absolute Bedingung, dass die Eier sich entwickeln und wenn irgendwann dann Wasser kommt, dass die aufgehen können. Das gilt für die ganzen Urzeitkrebse, die bei vielen Kindern beliebt sind, die kann man ja so als Baukasten kaufen und zuhause dann züchten.
MUSIK Dust Bowl
ERZÄHLERIN
Kiemenfußkrebse gehören in diese Kategorie Urzeit. Die kompakte Körperform mit den langen Fühlern vorne und den auslaufenden Schwanzenden hat sich seit Jahrmillionen nicht verändert. Deshalb hielten sie die Expertinnen und Experten für unverwüstlich. Internationale Vergleichsstudien zeigen jetzt: Diese Tiere sind anspruchsvoll.
18 ZU Hendrich 7.00
Die brauchen ausschließlich diese temporären Gewässer in unterschiedlichen Ausprägungen, manche eben diese reinen Sandgewässer, mit Lehmboden, anderen kommen auch im Wald vor oder auf überstauten Wiesen.
ERZÄHLER
Welcher Kiemenfußkrebs wo was warum am liebsten mag – diese Frage ist offen. Forschende der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung haben zum Beispiel Fußspuren von Elefanten in Namibia untersucht, in denen sich Wasser angesammelt hat. Schon binnen weniger Tage hatten mehr als 400 Organismen die rund 30 Zentimeter tiefen Löcher besiedelt. Neben Urzeitkrebsen auch Wasser- und Schwimmkäfer und jede Menge Stechmücken. Und die erwiesen sich als besonders reisefreudig. Wie sich einzelne Stämme verteilen in die umliegenden Pfützen, das ist eines der großen Forschungsthemen derzeit. Vor allem, wenn es um die Verbreitung von lebensbedrohlichen Krankheiten geht wie Dengefieber oder Zika.
ERZÄHLERIN
Ein anderes Augenmerk der Forschenden: Mikroorganismen, die aus dem Boden Metalle holen und verstoffwechseln, so dass sich oben auf der Pfütze Schlieren bilden –
ERZÄHLER
Wie die das machen –
ERZÄHLERIN
Ist ein Rätsel.
19 ZU (Meckenstock (22:49))
Was mich interessieren würde, das wären zum Beispiel diese Eisen- und Manganfilme auf diesen Wasseroberflächen, welche Mikroorganismen sind daran beteiligt diese zu bilden, welche findet man da drin? Wie sind die Prozesse dazu?
ERZÄHLERIN
Erzählt Umweltökologe Mertenstock.
20 ZU (Meckenstock (22:49))
Eine Kollegin von mir, die junge Wissenschaftlerin bei mir die Lisa Voskuhl, die entwickelt jetzt ein ganz tolles Forschungsgebiet, wo sie sich Ölfilme auf dem Wasser anschaut und sich anschaut: Wie schnell werden denn solche Ölfirmen abgebaut? Und was sind da für Prozesse dahinter? Wann werden diese Ölfilme schnell abgebaut? Wann werden sie langsam abgebaut? Was ja da eine sehr praktische Anwendung hat in Bezug auf Ölunfälle, im Meer oder auch im Süßwasser in Seen, Flüssen, Teichen, Pfützen. Wie schnell werden solche Ölfirmen abgebaut, und welche Prozesse sind daran beteiligt?
ERZÄHLERIN
Das Kleinstgewässer Pfütze als Modell für die ganz großen Ökosysteme. Diesen Ansatz wollen die Forschenden weiter nutzen und mehr erfahren, über die Entwicklung des Lebens auf der Erde.
ATMO SPIELPLATZ
ERZÄHLER
Und auch die zweite große Gruppe der Lachen-Fans, neben der Wissenschaft, wird weiter den Pfützen auf den Grund gehen: Die Gummistefel-Fraktion.
MUSIK Lightfooted / Sandbath C1587790 103
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die von Kinderfüßen durchtobte Pfütze
ERZÄHLERIN
Auf dem Spielplatz wird es langsam dunkel. Die Matschhosen sind starr vor Dreck. Die Zehen nass und klamm. Abendessen ist längst überfällig.
ERZÄHLER
Macht nichts. Man hat noch nicht geklärt, zu welcher Tierart welche Nachkommen gehören…
21 ZU (1.45)
M: In der Lache hüpfen kleine Sachen rum, das sind vielleicht die Kinder von denen.
 View all episodes
View all episodes


 By Bayerischer Rundfunk
By Bayerischer Rundfunk




4.6
8282 ratings

Pfützen gelten als kleinste Gewässer. Die Ökosysteme, die sich darin ausbilden, sind hingegen bunt und vielfältig. Bakterien und Algen, Bärtierchen und Amöben, Mückenlarven und Kaulquappen. Gleich nach dem Regen wuselt das Leben und selbst in ausgetrockneten Lachen ist noch was los. Von Susi Weichselbaumer (BR 2024)
Credits
Autorin dieser Folge: Susi Weichselbaumer
Regie: Susi Weichselbaumer
Es sprachen: Katja Amberger, Burchard Dabinnus, Diana Gaul
Technik: Andreas Lucke
Redaktion: Iska Schreglmann
Im Interview:
Rainer Meckenstock, Professor für Aquatische Mikrobiologie an der Universität Duisburg-Essen ;
Herwig Stibor, Professor für Aquatische Ökologie an der LMU;
Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München
Diese hörenswerten Folgen von radioWissen könnten Sie auch interessieren:
Gartenteich - Paradies für Seerosen und Co
JETZT ANHÖREN
Grundwasser - Ein geheimnisvoller Lebensraum
JETZT ANHÖREN
Und noch eine besondere Empfehlung der Redaktion:
Wie wir ticken - Euer Psychologie Podcast
Wie gewinne ich die Kraft der Zuversicht? Warum ist es gesund, dankbar zu sein? Der neue Psychologie Podcast von SWR2 Wissen und Bayern 2 Radiowissen gibt Euch Antworten. Wissenschaftlich fundiert und lebensnach nimmt Euch "Wie wir ticken" mit in die Welt der Psychologie. Konstruktiv und auf den Punkt. Immer mittwochs, exklusiv in der ARD Audiothek und freitags überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört.
ZUM PODCAST
Wir freuen uns über Feedback und Anregungen zur Sendung per Mail an [email protected].
RadioWissen finden Sie auch in der ARD Audiothek:
ARD Audiothek | RadioWissen
JETZT ENTDECKEN
Das vollständige Manuskript gibt es HIER.
Lesen Sie einen Ausschnitt aus dem Manuskript:
ATMO Spielplatz 1/ MUSIK Sandbath 0.47 min
ERZÄHLERIN
Am Nachmittag auf dem Spielplatz – es hat den ganzen Morgen über geregnet. Zwischen Rutsche und Klettergerüst stehen große, kleine, mittlere Pfützen.
1 ZU 4
V: Ihhhh / W: Da versickert man! GELÄCHTER
ERZÄHLERIN
Für die Kinder in den knallbunten Gummistiefeln ist es ein einziges Schlammfest.
2 ZU 5
Q: Ja!!! PLATSCH Juhu!!!
ATMO/ MUSIK ENDE
ERZÄHLER
Herwig Stibor teilt diese Begeisterung. Er ist Professor für Aquatische Ökologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München –
ERZÄHLERIN
Und leidenschaftlicher Pfützenforscher:
3 ZU Stibor 16:53
Allein die faszinierenden Abläufe in diesem Ökosystem sollten einem Respekt abfordern.
ERZÄHLERIN
Denn: Obschon die Forschung sie führt als die kleinsten stehenden Gewässer, die obendrein oft nur kurze Zeit existieren: In Pfützen und Lachen tobt enorm viel –
ERZÄHLER
Und vielfältiges Leben.
MUSIK Lightfooted reduced 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Wasser im Wald.
ATMO WALD/ MUSIK Field Day 0.47 min
ERZÄHLERIN
Die Waldbäume reihen sich dicht an dicht. Durch die grünen Wipfel dringt ab und an ein Sonnenstrahl. Der Regenschauer ist vorbei. Es riecht nach feuchter Erde. In den Kuhlen auf dem Waldboden stehen Wasserlachen. Wenn das Licht durch die Äste auf die Wasseroberfläche trifft, schillern Regenbogenfarben in bunten Schlieren. Es spiegelt und glänzt.
ERZÄHLER
Wie ein Ölfilm.
ERZÄHLERIN
Ist aber keiner!
4 ZU Meckenstock (0.00)
Sondern das ist ein ganz hauchdünner Eisen- oder Manganfilm.
ERZÄHLERIN
Erklärt Prof. Rainer Meckenstock. Er ist Umweltmikrobiologe an der Universität Duisburg-Essen.
5 ZU Meckenstock (0.00)
Und der entsteht dadurch, dass da Mikroorganismen sind, die reduziertes Eisen, was aus dem Untergrund rauskommt, oxidieren. Und dann fällt es als Rost praktisch aus an der Grenzschicht zwischen Wasser und Luft. Und bildet so einen ganz dünnen Film, der eben aussieht wie ein Ölfilm.
ERZÄHLER
Schnappt man sich einen herumliegenden Stock oder ein Stück abgefallener Rinde und stochert damit in der Pfütze, verziehen sich die Schlieren nicht wie bei einem Ölfilm und bilden neue buntschillernde Muster.
ERZÄHLERIN
Sondern: Sie brechen.
ERZÄHLER
Wie Eisschollen.
ERZÄHLERIN
Quasi Eisen-Eisschollen.
MUSIK Tangerine
ERZÄHLER
Mikroorganismen, die Pfützen quasi rosten lassen, sind nicht die einzigen, die sofort aktiv werden, sobald sich auf dem Waldboden oder überhaupt auf lehmig-erdigem Untergrund irgendwo in einer Mulde Wasser ansammelt. Abermillionen Kleinstlebewesen warten im Untergrund nur darauf, dass sich etwas Neues tut.
ERZÄHLERIN
Eine Pfütze entsteht.
ERZÄHLER
Um selbst tätig zu werden und zu nutzen, was die Lache hergibt.
ATMO/ MUSIK ENDE
6 ZU Meckenstock (1.33)
Wenn da viel Organik ist in der Pfütze, sagen wir mal im Wald sind viele Blätter runtergefallen, dann ist da viel organisches Material. Dann gibt es sofort Mikroorganismen, die sich darüber her machen und das abbauen.
ERZÄHLERIN
Da sind Bakterien, die Sauerstoff umsetzen. Die nächsten verzichten auf Sauerstoffe und bauen Nitrat um. Daraus bilden sie elementaren Stickstoff.
ERZÄHLER
Wieder andere Bakterien mögen Sulfat und reduzieren es zu Schwefelwasserstoff.
7 ZU Meckenstock (1.33)
Und dann stinkt es so. Das ist der Schlamm, der sich im Boden bildet, der dann so stinkt und so schwarz ist. Das sind meistens Eisensulfide, die eben durch die mikrobielle Atmung da entstanden sind.
MUSIK Going to work
ERZÄHLERIN
Millionen verschiedener Bakterienarten übernehmen also verschiedenste Umsetzungsjobs in der Pfütze. Und: Sie arbeiten nach System.
ERZÄHLER
Exakter nach einem Schicht-Plan. An der Oberfläche dümpelt etwa, wer Sauerstoff braucht. Organismen, die Nitrat bevorzugen und veratmen, ziehen ein paar Stockwerke tiefer ein…
8 ZU (Meckenstock (3.42))
Und dann zum Schluss, ganz unten, da sind die Methanogenen, und die machen aus dem organischen Material Methan. Und das bubbelt dann so hoch. Wenn man mit dem Stock reingeht in den Schlamm, dann kommen die Blasen hoch. Das ist meistens Methan und CO2.
MUSIK ENDE/ ATMO WALD
ERZÄHLER
Mikrobieller Schichtbetrieb also…
ERZÄHLERIN
Und zwar von ziemlich jetzt auf gleich in dieser kleinen Lache, die sich eben erst auf dem Waldboden gebildet hat. Da ist der Regen noch gar nicht vorbei, wirbelt es schon. Forschende wie Rainer Meckenstock zählen bis zu einer Milliarde Mikroorganismen pro Milliliter Pfützenwasser. Und diese Winzlinge ackern kräftig.
MUSIK Moviated Work 0.56 min
ERZÄHLERIN
Nach wenigen Tagen zieht sich da durchaus ein ansehnlicher Biofilm über die Wasseroberfläche. Grünalgen und Jochalgen machen sich breit. Goldalgen – die aussehen wie kleine Schmuckstücke, wenn man sie unter dem Mikroskop anschaut.
ERZÄHLER
Die mikrobielle Gemeinschaft gedeiht.
ERZÄHLERIN
Und bekommt kontinuierlich Zuwachs, beschreibt der Münchner Professor für Aquatische Ökologie, Herwig Stibor.
9 ZU (4 Stibor 1.46)
Dann kann so eine Pfütze recht schnell genug Bakterien und Algen haben, um andere Tiere wie kleine einzellige Pantoffeltierchen oder Glockentierchen zu ernähren.
ERZÄHLER
Eingetragen werden neue Bewohner auch per Wind, als blinde Passagiere im Federkleid von Vögeln, die einen Trinkstopp einlegen oder Badepause machen.
MUSIK Sandbath 0.45/ ATMO Spielplatz 1
ERZÄHLERIN
Manch Zuzügler klebt an der Sohle des Kindergummistiefels und platscht mit von Wasserloch zu Wasserloch.
10 ZU (4 Stibor 1.46)
Und dann reicht es irgendwann auch für Insektenlarven.
ERZÄHLERIN
Mücken lieben Lachen, auch schon die ganz flachen hier auf dem Spielplatz. Ungefähr sechs Zentimeter tief ist das Wasser. Breit ist die Pfütze vielleicht wie zweimal die Arme von Mama, Papa, Oma oder Babysitter ausgestreckt.
11 ZU (0.29) 6
M: Da schwimmen so weiße kleine Dinger rum und ich glaube, das sind so eine Art Eier, die Mücken oder Fliegen abgelegt haben.
ERZÄHLER
Könnte sein und wäre typisch für kleine stehende Gewässer wie diese Art Pfütze:
MUSIK Lightfooted 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die Spielplatz-Pfütze.
MUSIK Healthy balance 0.48 min
ERZÄHLERIN
Baut man fleißig Matschdämme oder lässt Schiffchen aus Blättern in den Lachen zwischen Bolzplatz und Schaukel treiben, stößt man nicht selten auf längliche Eier, kleiner als ein Millimeter, weiß bis bräunlich-schwarz, die aneinanderkleben wie Stifte in einer Box. Oder zusammen winzige Kreise bilden, die aussehen wie Unterteller.
ERZÄHLER
Viele verschiedene Mückenarten verteilen ihre Eier in Pfützen, oft bis zu 200 (Eier) auf einen Rutsch. Die Larven sind in so einer Spielplatzlache rundum versorgt. Sie ernähren sich von Pflanzenteilchen im Wasser. Zum Atmen rudern sie regelmäßig an die Oberfläche. Nach zwei bis drei Wochen starten sie los in die Luft – als fertige Mücken.
MUSIK ENDE / ATMO SPIELPLATZ
ERZÄHLERIN
Das Ökosystem Pfütze kennt viele Lebensläufe. Die meisten erkundet man am besten unterm Mikroskop. In jedem Tropfen Wasser aus der Pfütze auf dem Spielplatz –
ERZÄHLER
Ist etwas geboten.
MUSIK Bonsai dub (f) 1.10 min
ERZÄHLER
Wasserflöhe wuseln umher. Das sind winzige Krebse, ein bis drei Millimeter etwa. Durchsichtig-weiß wirken ihre runden Körperchen ein bisschen pummelig. Die im Verhältnis großen schwarzen Knopfaugen schauen immer etwas erstaunt drein.
ERZÄHLER
Und Achtung: Sie heißen Flöhe, weil sie auf ihren langen verästelten Fühlern hüpfen wie Flöhe.
ERZÄHLERIN
Richtig scharf stellen muss man das Mikroskop, um Wimperntierchen zu sehen. Die sind in der Regel nur 10 bis 300 Mikrometer lang. Überall am ovalen Körper stehen kleine Haare ab –
ERZÄHLER
Wie eine Punk-Frisur, nur eben rundherum.
ERZÄHLERIN
Mit den Härchen rudern die Wimperntierchen durchs Wasser. Den nahezu durchsichtigen Rädertierchen stehen auch die Haare zu Berge, allerdings nur am Kopf. Fürs Vorwärtskommen setzen sie statt auf Wimpernkraft auf den langen Schwanz, mit dem sich prima rudern lässt. Auch wenn er kaum länger ist als 0,1 Millimeter.
ERZÄHLER
Eine gewisse Manövrierfähigkeit ist nicht zuletzt deshalb wichtig, weil: Das Ökosystem Pfütze ist kein Mikro-Idyll.
MUSIK Dust Bowl 0.32 min
ERZÄHLER
Da müssen Rädertierchen und Fadenwurm beispielsweise durchaus den knubbeligen Bärtierchen entkommen. Die steuern sie sonst mit ihren acht moppeligen Beinchen an, stechen den Rüssel ein und saugen das Opfer aus. Ist mal kein Opfer in Sicht, mögen es Bärtierchen genauso vegetarisch. Pflanzenteile und Algen genügen.
ERZÄHLERIN
Genügen ist denn auch eines der Schlagworte, wenn es um Leben, besser Überleben in der Pfütze geht. Und das schon seit geraumer Zeit. Charles Darwins Evolutionstheorie löst Mitte des 19. Jahrhunderts eine regelrechte Pfützenbegeisterung bei Forschenden aus. Bald ranken sich zahlreiche Theorien und spekulative Erklärversuche darum, wie Tiere, Pflanzen, Pilze, Bakterien, Menschen – einfach alles entstanden sein könnte aus Matsch.
ERZÄHLER
Die Idee von der Pfütze als alleiniger Ursuppe ist inzwischen passé. Jüngste Studien zeigen, dass die Bausteine des Lebens wohl von Meteoriten auf die Erde gebracht wurden. Kohlenstoff, Wasserstoff, Aminosäuren, Metalle und so weiter.
ERZÄHLERIN
Trotzdem: Irgendwo und wie mussten diese Elemente auf der Erde zusammengesetzt werden.
ERZÄHLER
In Pfützen vielleicht, meinen manche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
MUSIK House of glass (d) 1.10 min
ERZÄHLER
2012 testeten Forschende der Universität Oldenburg in einem Experiment folgende Hypothese: Nicht die großen weiten Ozeane sind der Ursprung des Lebens, sondern kleine Lachen. Diese überschaubaren Wasserstellen seien durch Dämpfe und Gase entstanden, die aus den Tiefen der Erde aufgestiegen sind.
ERZÄHLERIN
Zeitlich reden wir da von irgendwann vor rund 3,8 Milliarden Jahren. Vulkane gibt es damals etliche auf dem Planeten, es brodelt und kocht. In der Atmosphäre ist kaum Sauerstoff, dafür jede Menge Kohlendioxid.
ERZÄHLER
In den vulkanischen Gebieten dampft es kräftig, Gase treten aus und kühlen an der Oberfläche ab. Dadurch bilden sich temporäre Teiche und Tümpel. Darin sammeln sich Mineralien und andere Grundbausteine für Einzeller. Voilá: Erstes Leben entsteht.
ERZÄHLERIN
Zumindest theoretisch und im Modell.
MUSIKENDE
ERZÄHLERIN
Ob die Pfütze nun wirklich der Anfang allen Seins ist – darüber diskutiert die Forschung bestimmt noch eine geraume Weile weiter. Was hingegen klar ist: Eine unscheinbare Pfütze kann genügen, um in kürzester Zeit ein vielfältiges Ökosystem aufblühen zu lassen.
ERZÄHLER
Aber nicht jede Kategorie von Lache taugt fürs pralle Leben:
MUSIK Lightfooted reduced
ZITATORIN
Nächstes Pfützenbeispiel: Die Pfütze auf der Straße.
ATMO Straße
ERZÄHLER
Unmittelbar nach dem Regenguss steht das Wasser in den Schlaglöchern auf der Fahrbahn. In kleinen Senken sammelt es sich neben dem Bürgersteig. Autoreifen lassen es hoch aufspritzen. Triefende Passanten schimpfen hinterher.
12 ZU (Meckenstock (18.47))
Also eine Pfütze auf dem Asphalt, die wird zu schnell austrocknen.
ERZÄHLERIN
Urteilt der Duisburger Umweltökologe Rainer Meckenstock. Ein paar Tage braucht es schon, bis sich ein Ökosystem entwickelt. Am besten einige Wochen. Zudem ist auf Teer, Asphalt und Beton oft wenig geboten an organischem Material, woraus mehr entstehen könnte als mikrobakterielles Leben.
ERZÄHLER
Andere Untersuchungsobjekte sind da idealer für Pfützenforscher:
13 ZU (Meckenstock (18.47))
Der Truppenübungsplatz, der ist ziemlich gut, nicht. Dadurch, dass die schweren Fahrzeuge den Boden so verdichten, dass der wasserundurchlässig wird. Und dann kann sich da schon sehr gut das Wasser stauen und bleibt jetzt auch längere Zeit da drin. Und das reicht ja dann sogar aus, dass da dann Frösche kommen und Kröten und drin laichen und Molche.
ATMO Wiese/ Tümpel
ERZÄHLER
Kröten, Unken und Molche wählen solche länger stehenden und etwas tieferen Lachen auf Übungsplätzen oder Äckern gerne als Kinderstube für ihre Kaulquappen. Kein Wunder: Hier gibt es kaum Feinde.
ERZÄHLERIN
In Tümpel oder See wird man schnell mal von Fischen gefressen.
MUSIK Tangerine 1.10 min
ERZÄHLER
In der Lache darf man in Ruhe groß werden. Zudem ist es kuschelig, das Wasser wärmt sich schnell auf, die Pfütze wirkt wie ein Brutkasten. Nach 41 Tagen wird aus einer Larve mit Kiemen und Schwanz eine fertige kleine Gelbbauchunke. Fünf Zentimeter groß. Wittert sie Gefahr, stülpt sie ihr Hinterteil nach oben. Eine quietschgelbe Bauchseite schlägt den Angreifer in die Flucht.
ERZÄHLERIN
Nett!
ERZÄHLER
Effektiv. Gelbbauchunken gab es auf der Erde schon vor den Dinosauriern.
ERZÄHLERIN
Trotzdem: 41 Entwicklungstage sind für Pfützenbewohner reichlich. Minikreuzottern schaffen das erheblich schneller: 17 Tage im Pfützenwasser und man schlängelt an Land weiter.
ERZÄHLER
Wobei, auch das ist womöglich zu lange. Denn: Pfützen werden zunehmend rar.
14 ZU (Meckenstock (18.47))
Bei uns wird jeder Graben unnützerweise immer sauber gemacht, damit das ordentlich aussieht, und dementsprechend läuft alles ab und durch. Und dann bleiben wenig Lebensräume zurück für solche Tiere.
MUSIK Field Day 0.45 min
ERZÄHLERIN
Rauchschwalben sieht man immer seltener. Ein Grund: Es fehlen Pfützen. Schwalben nutzen den Lehm aus Lachen für den Nestbau. Wo keine Lache, da keine Schwalbenfamilie.
ERZÄHLER
Und auch keine Schmetterlingsnachkommen. Schmetterlinge mögen am liebsten Blumennektar. Der ist reich an Zucker, hat aber wenig Nährstoffe.
ERZÄHLERIN
Vor allem keine, die Schmetterlinge benötigen für die Fortpflanzung.
ERZÄHLER
Der Kurort Schlammpfütze ist voller Salze und Mineralien.
ERZÄHLERIN
Schmettterlings-Männchen machen sich damit fit.
ERZÄHLER
Weibchen auch.
ERZÄHLERIN
Lachenmatsch verbessert die Lebensfähigkeit der Eier.
MUSIK ENDE
ERZÄHLER
Tatsächlich ist in den letzten Jahrzehnten immer weniger Platz für Kurschlammpackungen für Schmetterlinge oder Matschbaumärkte für nistende Schwalben. Kleinstgewässer wie Pfützen verschwinden. Mehr und mehr Flächen werden versiegelt. Wege und Stege sind muldenfrei begradigt. Wasser soll in erster Linie ablaufen. Auch weil der Klimawandel zunehmend Starkregen bringt, der eben keine heimeligen Lachen entstehen lässt, sondern wertvollen fruchtbaren Boden wegschwemmt. Zugleich machen Hitze- und Dürreperioden Pfützen den Gar aus.
ERZÄHLER
Aber: Einige Pfützenbewohnerinnen und -bewohner haben sich in den vielen Jahrtausenden der Evolution darauf vorbereitet, dass es eben in der Natur der Pfütze liegt, auch mal auszutrocknen.
ERZÄHLERIN
Manchmal hat man Glück und kann per Anhalter eine Pfütze weiterreisen, die vielleicht länger nass bleibt: Im Gefieder eines trinkenden Vogels. Im Fell eines Hundes, der durchs Wasser springt. An der Sohle eines Kindergummistiefels.
ERZÄHLERIN
Nicht selten hat man aber auch Pech. Aus winzigem Wellengang wird weite Wüste…
MUSIK Lightfooted reduced 0.10 min
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die ausgetrocknete Pfütze
MUSIK Sandbath 1.15 min
ERZÄHLER
Fast schon philosophisch mutet die Erkenntnis von Pfützenforschenden wie dem Münchner Aquaökologen Stibor an: Nur weil man eine Pfütze nicht sieht, heißt das nicht, sie wäre nicht da. Sie ist halt für den Moment –
ERZÄHLERIN
Oder eine geraume Weile –
ERZÄHLER
Schlichtweg wasserlos.
15 ZU Stibor 0.19
Das bedeutet, dass die Organismen, die in einer Pfütze leben, damit gut klarkommen müssen.
ERZÄHLERIN
Fürs Klarkommen nennt Stibor verschiedene Strategien:
ERZÄHLER
Strategie 1: Die Generationszeiten etlicher Pfützenbewohner sind kurz, vielleicht nur einen Tag lang oder weniger, wie bei Bakterien, Amöben oder Pantoffeltierchen.
ERZÄHLERIN
Strategie 2: Nur die ersten Entwicklungsstadien finden in der Pfütze statt. Nach zwei Wochen startet die erwachsene Mücke ins luftige Leben, nach zwei drei Wochen hüpft die Unke an Land.
ERZÄHLER
Besonders spannend für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist Strategie 3: Viele Organismen, die in Pfützen leben, können sogenannte Dauerstadien einnehmen. Sich flexibel anpassen, wenn es trocken wird um sie herum.
16 ZU Stibor 1.46
Die wissen, dass diese Pfütze austrocknet und können rechtzeitig Stadien ausbilden, also Eier oder Dauerstadion von adulten oder juvenilen Tieren, die dann dieses Austrocknen überstehen können. Und wenn die dann per Wind oder einen anderen Transportweg wieder in eine Pfütze oder ein Gewässer kommen, dann würde dieses Dauerstadium wieder zum aktiven Dasein erweckt werden. Und dann schlüpft zum Beispiel wieder ein Moostierchen oder Bärtierchen.
ERZÄHLERIN
Auch Lars Hendrich, Insektenspezialist an der Zoologischen Staatssammlung München, interessiert sich speziell für diese Dauerstadien. Dazu weiß die Forschung noch gar nicht viel.
ERZÄHLER
Lange dachte man, es wäre einfach eine Art Sicherheitsmodus, um Wochen, Monate, Jahre zu überdauern.
ERZÄHLERIN
Offenbar gibt es jedoch Arten, die eine Trockenperiode sogar unbedingt brauchen.
17 ZU Hendrich 4.25
Dann ist diese Trockenphase absolute Bedingung, dass die Eier sich entwickeln und wenn irgendwann dann Wasser kommt, dass die aufgehen können. Das gilt für die ganzen Urzeitkrebse, die bei vielen Kindern beliebt sind, die kann man ja so als Baukasten kaufen und zuhause dann züchten.
MUSIK Dust Bowl
ERZÄHLERIN
Kiemenfußkrebse gehören in diese Kategorie Urzeit. Die kompakte Körperform mit den langen Fühlern vorne und den auslaufenden Schwanzenden hat sich seit Jahrmillionen nicht verändert. Deshalb hielten sie die Expertinnen und Experten für unverwüstlich. Internationale Vergleichsstudien zeigen jetzt: Diese Tiere sind anspruchsvoll.
18 ZU Hendrich 7.00
Die brauchen ausschließlich diese temporären Gewässer in unterschiedlichen Ausprägungen, manche eben diese reinen Sandgewässer, mit Lehmboden, anderen kommen auch im Wald vor oder auf überstauten Wiesen.
ERZÄHLER
Welcher Kiemenfußkrebs wo was warum am liebsten mag – diese Frage ist offen. Forschende der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung haben zum Beispiel Fußspuren von Elefanten in Namibia untersucht, in denen sich Wasser angesammelt hat. Schon binnen weniger Tage hatten mehr als 400 Organismen die rund 30 Zentimeter tiefen Löcher besiedelt. Neben Urzeitkrebsen auch Wasser- und Schwimmkäfer und jede Menge Stechmücken. Und die erwiesen sich als besonders reisefreudig. Wie sich einzelne Stämme verteilen in die umliegenden Pfützen, das ist eines der großen Forschungsthemen derzeit. Vor allem, wenn es um die Verbreitung von lebensbedrohlichen Krankheiten geht wie Dengefieber oder Zika.
ERZÄHLERIN
Ein anderes Augenmerk der Forschenden: Mikroorganismen, die aus dem Boden Metalle holen und verstoffwechseln, so dass sich oben auf der Pfütze Schlieren bilden –
ERZÄHLER
Wie die das machen –
ERZÄHLERIN
Ist ein Rätsel.
19 ZU (Meckenstock (22:49))
Was mich interessieren würde, das wären zum Beispiel diese Eisen- und Manganfilme auf diesen Wasseroberflächen, welche Mikroorganismen sind daran beteiligt diese zu bilden, welche findet man da drin? Wie sind die Prozesse dazu?
ERZÄHLERIN
Erzählt Umweltökologe Mertenstock.
20 ZU (Meckenstock (22:49))
Eine Kollegin von mir, die junge Wissenschaftlerin bei mir die Lisa Voskuhl, die entwickelt jetzt ein ganz tolles Forschungsgebiet, wo sie sich Ölfilme auf dem Wasser anschaut und sich anschaut: Wie schnell werden denn solche Ölfirmen abgebaut? Und was sind da für Prozesse dahinter? Wann werden diese Ölfilme schnell abgebaut? Wann werden sie langsam abgebaut? Was ja da eine sehr praktische Anwendung hat in Bezug auf Ölunfälle, im Meer oder auch im Süßwasser in Seen, Flüssen, Teichen, Pfützen. Wie schnell werden solche Ölfirmen abgebaut, und welche Prozesse sind daran beteiligt?
ERZÄHLERIN
Das Kleinstgewässer Pfütze als Modell für die ganz großen Ökosysteme. Diesen Ansatz wollen die Forschenden weiter nutzen und mehr erfahren, über die Entwicklung des Lebens auf der Erde.
ATMO SPIELPLATZ
ERZÄHLER
Und auch die zweite große Gruppe der Lachen-Fans, neben der Wissenschaft, wird weiter den Pfützen auf den Grund gehen: Die Gummistefel-Fraktion.
MUSIK Lightfooted / Sandbath C1587790 103
ZITATORIN
Typisches Pfützenbeispiel: Die von Kinderfüßen durchtobte Pfütze
ERZÄHLERIN
Auf dem Spielplatz wird es langsam dunkel. Die Matschhosen sind starr vor Dreck. Die Zehen nass und klamm. Abendessen ist längst überfällig.
ERZÄHLER
Macht nichts. Man hat noch nicht geklärt, zu welcher Tierart welche Nachkommen gehören…
21 ZU (1.45)
M: In der Lache hüpfen kleine Sachen rum, das sind vielleicht die Kinder von denen.

75 Listeners

18 Listeners
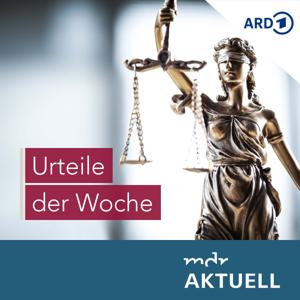
3 Listeners

50 Listeners

6 Listeners

5 Listeners

195 Listeners

20 Listeners

110 Listeners

103 Listeners

27 Listeners

48 Listeners

4 Listeners

9 Listeners

18 Listeners

18 Listeners

0 Listeners

40 Listeners

36 Listeners

62 Listeners

3 Listeners

2 Listeners

1 Listeners

29 Listeners

36 Listeners

16 Listeners

17 Listeners
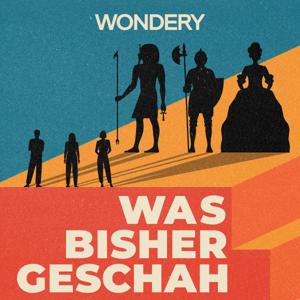
45 Listeners

0 Listeners

1 Listeners